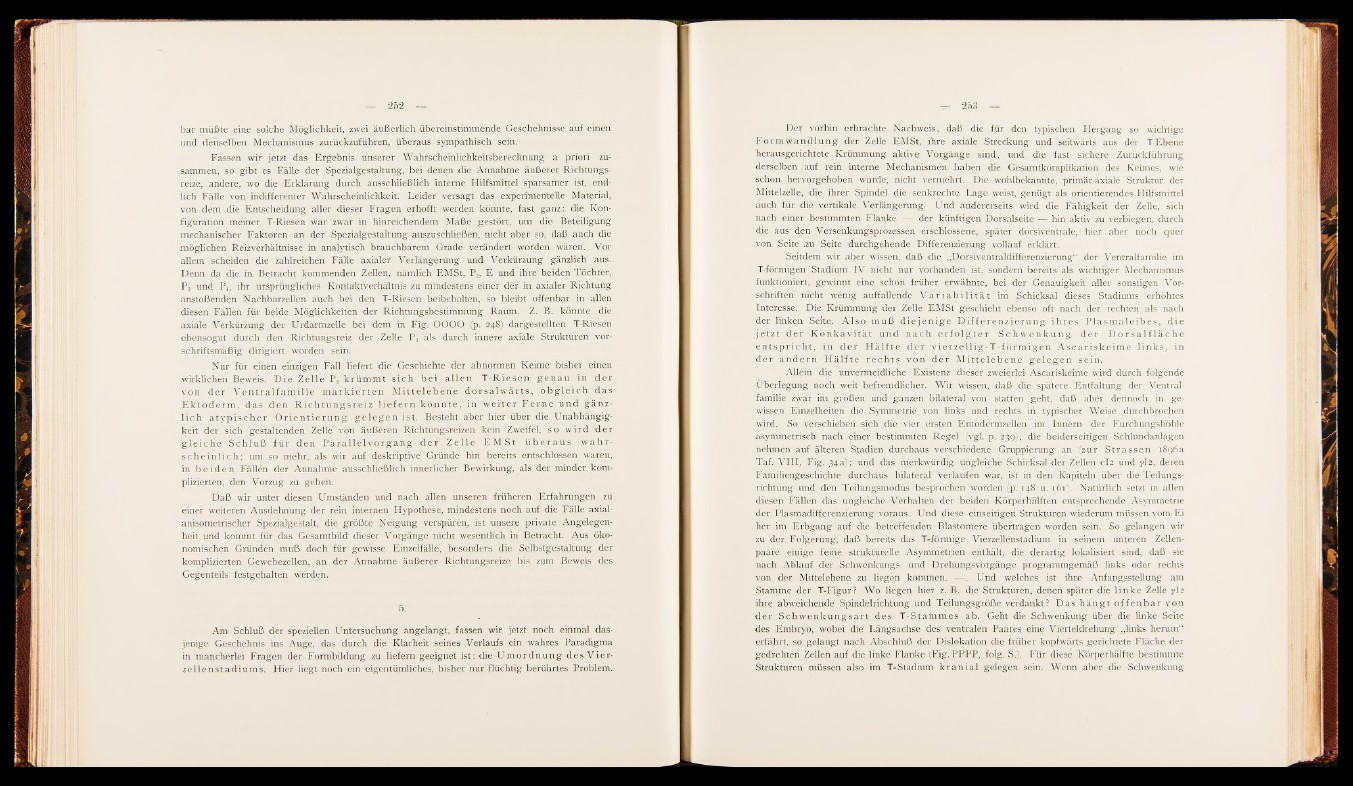
bar müßte eine solche Möglichkeit, zwei äußerlich übereinstimmende Geschehnisse auf einen
und denselben Mechanismus zurüekzuführen, überaus sympathisch sein.
Fassen wir jetzt das Ergebnis unserer Wahrscheinlichkeitsberechnung a priori zusammen,
so gibt es Fälle der Spezialgestaltung, bei denen die Annahme äußerer Richtungsreize,
andere, wo die Erklärung durch ausschließlich interne Hilfsmittel sparsamer ist, endlich
Fälle von indifferenter Wahrscheinlichkeit. Leider versagt das experimentelle Material,
von dem die Entscheidung aller dieser Fragen erhofft werden könnte, fast ganz: die Konfiguration
meiner T-Riesen war zwar in hinreichendem Maße gestört, um die Beteiligung
mechanischer Faktoren an der Spezialgestaltung auszuschließen, nicht aber so, daß auch die
möglichen Reizverhältnisse in analytisch brauchbarem Grade verändert worden wären. Vor
allem scheiden die zahlreichen Fälle axialer Verlängerung und Verkürzung gänzlich aus.
Denn da die in Betracht kommenden Zellen, nämlich EMSt, P 2, E und ihre beiden Tochter,
P 3 und P4, ihr ursprüngliches Kontaktverhältnis zu mindestens einer der in axialer Richtung
anstoßenden Nachbarzellen auch bei den T-Riesen beibehalten, so bleibt offenbar in allen
diesen Fällen für beide Möglichkeiten der Richtungsbestimmung Raum. Z. B. könnte die
axiale Verkürzung der Urdarmzelle bei dem in Fig. OOOO (p. 248) dargestellten T-Riesen
ebensogut durch den Richtungsreiz der Zelle P3 als durch innere axiale Strukturen vorschriftsmäßig
dirigiert worden sein.
Nur für einen einzigen F all liefert die Geschichte der abnormen Keime bisher einen
wirklichen Beweis. D i e Z e l l e P3 k r üm m t s i c h b e i a l l e n T -R i e s e n g e n a u in d e r
v o n d e r V e n t r a l f a m i l i e m a r k i e r t e n M i t t e l e b e n e d o r s a lw ä r t s , o b g l e i c h d a s
E k t o d e rm , d a s d e n R i c h t u n g s r e i z l i e f e r n k ö n n t e , Tn w e i t e r F e r n e u n d g ä n z l
i c h a t y p i s c h e r O r i e n t i e r u n g g e l e g e n is t . Besteht aber hier über die Unabhängigkeit
der sich gestaltenden Zelle von äußeren Richtungsreizen kein Zweifel, s o w i r d d e r
g l e i c h e S c h lu ß fü r d e n P a r a l l e l v o r g a n g d e r Z e l l e E M S t ü b e r a u s ^ w a h r s
c h e i n l i c h ; um so mehr, als wir auf deskriptive Gründe hin bereits entschlossen waren,
in b e i d e n Fällen der Annahme ausschließlich innerlicher Bewirkung, als der minder komplizierten,
den Vorzug zu geben.
D a ß wir unter diesen Umständen und nach allen unseren früheren Erfahrungen zu
einer weiteren Ausdehnung der rein internen Hypothese, mindestens noch auf die Fälle axial-
anisometrischer Spezialgestalt, die größte Neigung verspüren, ist unsere private Angelegenheit
und kommt für das Gesamtbild dieser Vo rgänge nicht wesentlich in Betracht. Aus ökonomischen
Gründen muß doch für gewisse Einzelfälle, besonders die Selbstgestaltung der
komplizierten Gewebezellen, an der Annahme äußerer Richtungsreize bis zum Beweis des
Gegenteils festgehalten werden.
5.
Am Schluß der speziellen Untersuchung angelangt, fassen wir jetzt noch einmal dasjenige
Geschehnis ins Auge, das durch die Klarheit seines Verlaufs ein wahres Paradigma
in mancherlei Fragen der Formbildung zu liefern geeignet ist: die U m o r d n u n g d e s V i e r z
e l le n s t a d iu m s . Hier liegt noch ein eigentümliches, bisher nur flüchtig berührtes Problem.
D e t vorhin erbrachte Nachweis, daß die für den typischen Hergang so wichtige
F o rm w a n d lu n g der Zelle EMSt, ihre axiale Streckung und seitwärts aus der T-Ebene
herausgerichtete Krümmung aktive Vorgänge sind, und die fast sichere Zurückführung
derselben auf rein interne Mechanismen haben die Gesamtkomplikation des Keimes, wie
schon hervorgehoben wurde, nicht vermehrt. Die wohlbekannte, primär-axiale Struktur der
Mittelzelle, die ihrer Spindel die senkrechte Lä g e weist, genügt als orientierendes Hilfsmittel
auch für die vertikale Verlängerung. Und andererseits wird die Fähigkeit der Zelle, sich
nach einer bestimmten Flanke — der künftigen Dorsalseite — hin aktiv zu verbiegen, durch
die aus den Versenkungsprozessen erschlossene, .später dorsiventrale, hier aber noch quer
von Seite .zu Seite durchgehende Differenzierung vollauf erklärt.
Seitdem wir aber wissen, daß die „Dorsiventraldifferenzierung“ der Ventralfamilie im
T-förmigen Stadium IV nicht nur vorhanden ist, sondern bereits als wichtiger Mechanismus
funktioniert, gewinnt eine schon früher erwähnte, bei der Genauigkeit aller sonstigen Vorschriften
nicht wenig auffallende V a r i a b i l i t ä t im Schicksal dieses Stadiums erhöhtes
Interesse. Die Krümmung der Zelle EM S t geschieht ebenso oft nach der rechten als nach
der linken Seite. A l s o m u ß d i e j e n i g e D i f f e r e n z i e r u n g ih r e s P l a sm a l e i b e s , d ie
j e t z t d e r K o n k a v i t ä t u n d n a c h e r f o l g t e r S c h w e n k u n g d e r D o r s a l f l ä c h e
e n t s p r i c h t , in d e r H ä l f t e d e r v i e r z e i l i g - T - f ö rm i g e n A s c a r i s k e im e l in k s , in
d e r ä n d e r n H ä l f t e r e c h t s v o n d e r M i t t e l e b e n e g e l e g e n s e in .
Allein die unvermeidliche Existenz dieser zweierlei Ascariskeime wird durch folgende
Überlegung noch weit befremdlicher. Wir wissen, daß die spätere Entfaltung der Ventral-
familie zwar im großen und ganzen bilateral von statten geht, daß aber dennoch in ge wissen
Einzelheiten die Symmetrie von links und rechts in typischer Weise durchbrochen
wird. So verschieben sich die vier ersten Entodermzellen im Innern der Furchungshöhle
asymmetrisch nach einer bestimmten Regel (vgl. p. 239); die beiderseitigen Schlundanlagen
nehmen auf älteren Stadien durchaus verschiedene Gruppierung an (zu r S t r a s s e n 1896a
Ta f. V I I I , Fig. 34ä); und das merkwürdig ungleiche Schicksal der Zellen el2 und yl2, deren
Familiengeschichte durchaus bilateral verlaufen war, ist in den Kapiteln über die Teilungs-
richtung und den Teilungsmodus besprochen worden (p. 148 u. 161). Natürlich setzt in allen
diesen Fällen das ungleiche Verhalten der beiden Körperhälften entsprechende Asymmetrie
der Plasmadifferenzierung voraus. Und diese einseitigen Strukturen wiederum müssen vom Ei
her im Erbgang auf die betreffenden Blastomere übertragen worden sein. So gelangen wir
zu der Folgerung, daß bereits das T-förmige Vierzellenstadium in seinem unteren Zellenpaare
einige feine strukturelle Asymmetrien enthält, die derartig lokalisiert sind, daß sie
nach Ablauf der Schwenkungs- und DrehungsVorgänge programmgemäß links oder rechts
von, der Mittelebene zu liegen k o m m e n . ,U n d welches, ist ihre Ahfangsstellung am
Stamme der T-Figur? Wo liegen hier z. B. die Strukturen, denen später die l in k e Zelle yI2
ihre abweichende Spindelrichtung und Teilungsgröße verdankt? D a s h ä n g t o f f e n b a r v o n
d e r S c h w e n k u n g s a r t d e s T - S t am m e s ab . Geht die Schwenkung über die linke Seite
des Embryo, wobei die Längsachse des ventralen Paares eine Vierteldrehung „links herum“
erfährt, so gelangt nach Abschluß der Dislokation die früher kopfwärts gerichtete Fläche der
gedrehten Zellen auf die linke Flanke (Fig. PP P P , folg. S.)'. Für diese Körperhälfte bestimmte
Strukturen müssen also im T-Stadium k r a n i a l gelegen sein. Wenn aber die Schwenkung