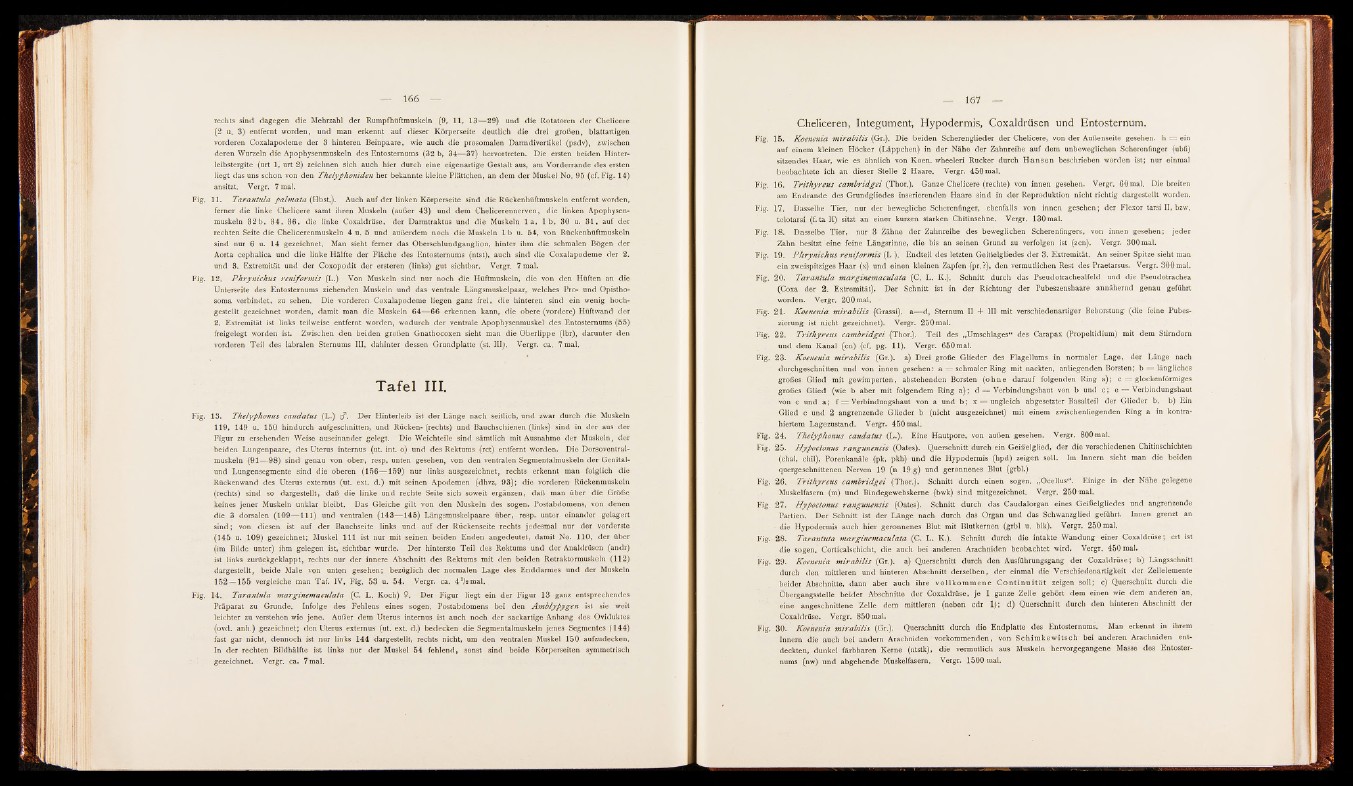
rechts sind dagegen die Mehrzahl der Rumpfhüftmuskeln (9, 1 1 , 1 3— 29) und die Rotatoren der Chelicere
(2 u. 3) entfernt worden, und man erkennt auf dieser Körperseite deutlich die drei großen, blattartigen
vorderen Coxalapodeme der 3 hinteren Beinpaare, wie auch die prosomalen Darmdivertikel (psdv), zwischen
deren Wurzeln die Apophysenmuskeln des Entosternums (32 b, 34— 37) hervortreten. Die ersten beiden Hinter-
leibstergite (urt 1, urt 2) zeichnen sich auch hier durch eine eigenartige Gestalt aus, am Vorderrande des ersten
liegt das uns schon von den Thelyphoniden her bekannte kleine Plättchen, an dem der Muskel No. 95 (cf. Fig. 14)
ansitzt. Vergr. 7 mal.
Fig. 1 1 . Tarantula palrnata (Hbst.). Auch auf der linken Körperseite sind die Rückenhüftmuskeln entfernt worden,
ferner die linke Chelicere samt ihren Muskeln (außer 43) und dem Chelicerennerven, die linken Apophysenmuskeln
3 2 b , 34 , 36, die linke Coxaldrüse, der Darmtraktus und die Muskeln l a , 1 b, 30 u. 3 1 , auf der
rechten Seite die Chelicerenmuskeln 4 u. 5 und außerdem noch die Muskeln l b u. 54, von Rückenhüftmuskeln
sind nur 6 u. 14 gezeichnet. Man sieht ferner das Oberschlundganglion, hinter ihm die schmalen Bögen der
Aorta cephalica und die linke Hälfte der Fläche des Entosternums (ntst), auch sind die Coxalapodeme der 2.
und 3. Extremität und der Coxopodit der ersteren (links) gut sichtbar. Vergr. 7 mal.
Fig. 12 . P hryn ich us renifortnis (L.) Von Muskeln sind nur noch die Hüftmuskeln, die von den Hüften an die
Unterseite des Entosternums ziehenden Muskeln und das ventrale Längsmuskelpaar, welches Pro- und Opistho-
soma verbindet, zu sehen. Die vorderen Coxalapodeme liegen ganz frei, die hinteren sind ein wenig hochgestellt
gezeichnet worden, damit man die Muskeln 64— 66 erkennen kann, die obere (vordere) Hüftwand der
2. Extremität ist links teilweise entfernt worden, wodurch der ventrale Apophysenmuskel des. Entosternums (55)
freigelegt worden ist. Zwischen den beiden großen Gnathocoxen sieht man die Oberlippe (lbr), darunter den
vorderen T eil des labralen Sternums III, dahinter dessen Grundplatte (st. III). Vergr. ca. 7.mal.
Tafel III.
Fig. 13. Thelyphonus caudatus (L.) cf. Der Hinterleib ist der Länge nach seitlich, und zwar durch die Muskeln
1 19 , 149 u. 150 hindurch aufgeschnitten, und Rücken-(rechts) und Bauchschienen (links) sind in der aus der
Figur zu ersehenden Weise auseinander gelegt. Die Weichteile sind sämtlich mit Ausnahme der Muskeln, der
beiden Lungenpaare, des Uterus internus (ut. int; o) und des Rektums (rct) entfernt worden. Die Dorsoventral-
muskeln (91— 98) sind genau von ober, resp, unten gesehen, von den ventralen Segmentalmuskeln der Genital-
und .Lungensegmente sind die oberen (15 6— 159) nur links ausgezeichnet, rechts erkennt man folglich die
Rückenwand des Uterus externus (ui. ext. d .) mit seinen Apodemen (dhvz, 93); die vorderen Rückenmuskeln
(rechts) sind so dargestellt, daß die linke und rechte Seite sich soweit ergänzen, daß man über die Größe
keines jener Muskeln unklar bleibt. Das Gleiche gilt von den Muskeln des sogen. Postabdomens, von denen
die 3 dorsalen (109— 1 1 1 ) und ventralen (14 3— 14 5 ) Längsmuskelpaare über, resp. unter einander gelagert
sind; von diesen ist auf der Bauchseite links und auf der Rückenseite rechts jedesmal nur der vorderste
(14 5 u. 109) gezeichnet; Muskel 1 1 1 ist nur mit seinen beiden Enden angedeutet, damit No. 1 10 , der über
(im Bilde unter) ihm gelegen ist, sichtbar wurde. Der hinterste T eil des Rektums und der Analdrüsen (andr)
ist links zurückgeklappt, rechts nur der innere Abschnitt des Rektums mit den beiden Retraktormuskeln (112)
dargestellt, beide Male von unten gesehen; bezüglich der normalen Lage des Enddarmes und der Muskeln
1 5 2— 15 5 vergleiche man Taf. IV, Fig. 53 u. 54. Vergr. ca. 4 I/ im a l..
Fig. 14. Tarantula marginemaculata (C. L . Koch) 9. Der Figur liegt ein der Figur 13 ganz entsprechendes
Präparat zu Grunde. Infolge des Fehlens eines sogen. Postabdomens bei den Amblypygen ist sie weit
leichter zu verstehen wie jene. Außer dem Uterus internus ist auch noch der sackartige Anhang des Oviduktes
(ovd. anh.) gezeichnet; den Uterus externus' (ut. ext. d.) bedecken die Segmentalmuskeln jenes Segmentes (144)
fast gar nicht, dennoch ist nur links 144 dargestellt, rechts nicht, um den ventralen Muskel 150 aufzudecken.
In der rechten Bildhälfte ist links nur der Muskel 54 fehlend, sonst sind beide Körperseiten symmetrisch
gezeichnet. Vergr. ca. 7 mal.
Cheliceren, Integument, Hypodermis, Coxaldrüsen und Entosternum.
Fig. 15. Koenenia mirabilis (Gr.). Die beiden Scherenglieder der Chelicere, von der Außenseite gesehen, h = ein
auf einem kleinen Höcker (Läppchen) in der Nähe der Zahnreihe auf dem unbeweglichen Scherenfinger (ubfi)
sitzendes Haar, wie es ähnlich von Koen. wheeleri Rucker durch H a n s en beschrieben worden ist; nur einmal
beobachtete ich an dieser Stelle 2 Haare. Vergr. 450 mal.
Fig. 16. Trithyreus catnbridgei (Thor.). Ganze Chelicere (rechte) von innen gesehen. Vergr. 60 mal. Die breiten
am Endrande des Grundgliedes inserierenden Haare sind in der Reproduktion nicht richtig dargestellt worden.
Fig. 17. Dasselbe -Tier, nur der bewegliche Scherenfinger, ebenfalls von innen gesehen; der Flexor tarsi II, bzw.
telotarsi. (f. ta II) sitzt an einer, kurzen starken Chitinsehne. Vergr. 130 mal.
Fjg. 18. Dasselbe T ie r, nur 3 Zähne der Zahnreihe des beweglichen Scherenfingers, von innen gesehen; jeder
Zahn besitzt eine feine Längsrinne, die bis an seinen Grund zu verfolgen ist (zcn). Vergr. 300 mal.
Fig. 19; P hryn ich us reniformis (L ). Endteil des letzten Geißelgliedes der 3. Extremität. An seiner Spitze sieht man
ein zweispitziges Haar (x) und einen kleinen Zapfen (pr.?), den vermutlichen Rest des Praetarsus. Vergr. 300 mal.
Fig. 20.: Tarantula marginemaculata (C. L . K.). Schnitt durch das Pseudotrachealfeld und die Pseudotrachea
(Coxa der 2. Extremität); Der Schnitt ist in der Richtung der Pubeszenshaare annähernd genau geführt
worden. Vergr. 200 mal.
Fig. 2 1 . Koenenia m ira bilis (Grassi). a— d, Sternum II + III mit verschiedenartiger Beborstung (die feine Pubes-
zierung ist nicht gezeichnet); Vergr. 250 mal.
Fig. 22. Trithyreus cambridgei (Thor.). T eil des „Umschlages“ des Carapax (Propeltidium) mit dem Stirndorn
und dem Kanal (cn) (cf. pg. 1 1 ), Vergr. 650 mal.
Fig. 23. Koenenia mirabilis (Gr.). a) Drei große Glieder des Flagellums in normaler Lage, der Länge nach
durchgeschnitten und von innen gesehen: a = schmaler Ring mit nackten, anliegenden Borsten; b = längliches
großes Glied mit gewimperten, abstehenden Borsten (o h n e darauf folgenden Ring a ) ; c = glockenförmiges
großes Glied (wie b aber mit folgendem Ring a); d ==■ Verbindungshaut von b und c ; e = Verbindungshaut
von c und a ; f — ’Verbindungshaut von a und b; x = ungleich abgesetzter Basalteil der Glieder b. b) Ein
Glied c und 2 angrenzende Glieder b (nicht ausgezeichnet) mit einem zwischenliegenden Ring a in kontrahiertem
Lagezustand. Vergr. 450 mal.
Fig. 24. Thelyphonus caudatus (L.). Eine Hautpore, von außen gesehen. Vergr. 800 mal.
Fig. 25. Hypoctonus rangunensis (Gates). Querschnitt durch ein Geißelglied,- der die verschiedenen Chitinschichten
(chal, chil), Porenkanäle (pk, pkh) und die Hypodermis (hpd) zeigen soll. Im Innern sieht man die beiden
quergeschnittenen Nerven 19 (n .19,g) und geronnenes Blut (grbl,)
Fig. 26. Trithyreus cambridgei (Thor.), Schnitt durch eineü sogen. „Ocellus“ . Einige in der Nähe gelegene
Muskelfasern (m) und Bindege webskerne (bwk) sind mitgezeichnet.- Vergr. 250 mal.
Fig. 27. Hypoctonus. rangunensis (Oates). Schnitt durch das Caudalorgan eines Geißelgliedes und angrenzende
Partien. Der Schnitt ist der Länge nach durch das Organ und das Schwanzglied geführt. Innen grenzt an
die Hypodermis auch hier geronnenes Blut mit Blutkernen (grbl u. blk). Vergr. 250 mal.
Fig.- 28. Tarantuta marginemaculata (C. L., K.),- Schnitt durch die intakte Wandung einer Coxaldrüse; crt ist
die sogen. Corticalschicht, die auch bei anderen Arachniden beobachtet wird, Vergr. 450 mal.
Fig. 29. Koenenia mirabilis (Gr.). a) Querschnitt durch den Ausführungsgang der Coxaldrüse; b) Längsschnitt
durch den mittleren und hinteren Abschnitt derselben, der einmal die Verschiedenartigkeit der Zellelemente
beider Abschnitte, dann aber auch ihre v o llk om m e n e C o n t in u i tä t zeigen s p l S ^ Querschnitt dui;ch die
Übergangsstelle beider Abschnitte der Coxaldrüse., je 1 . ganze Zelle gehört dem einen wie dem anderen an,
J eine angeschnittene Zelle dem mittleren (neben cdr 1); d) Querschnitt durch den hinteren Abschnitt der
Coxaldrüse. Vergr. 850 mal|gi^i
Fig. 30; Koenenia mirabilis (Gr.). Querschnitt durch die Endplatte des Entosternums. Man erkennt in ihrem
Innern die auch bei ändern Arachniden vorkommenden, von S e h im k ew its c h bei anderen Arachniden entdeckten,
dunkel farbbaren Kerne (ntstk), die vermutlich aus Muskeln hervorgegangene Masse des Entosternums
(nw) und abgehende Muskelfasern. Vergr. 1500 mal.