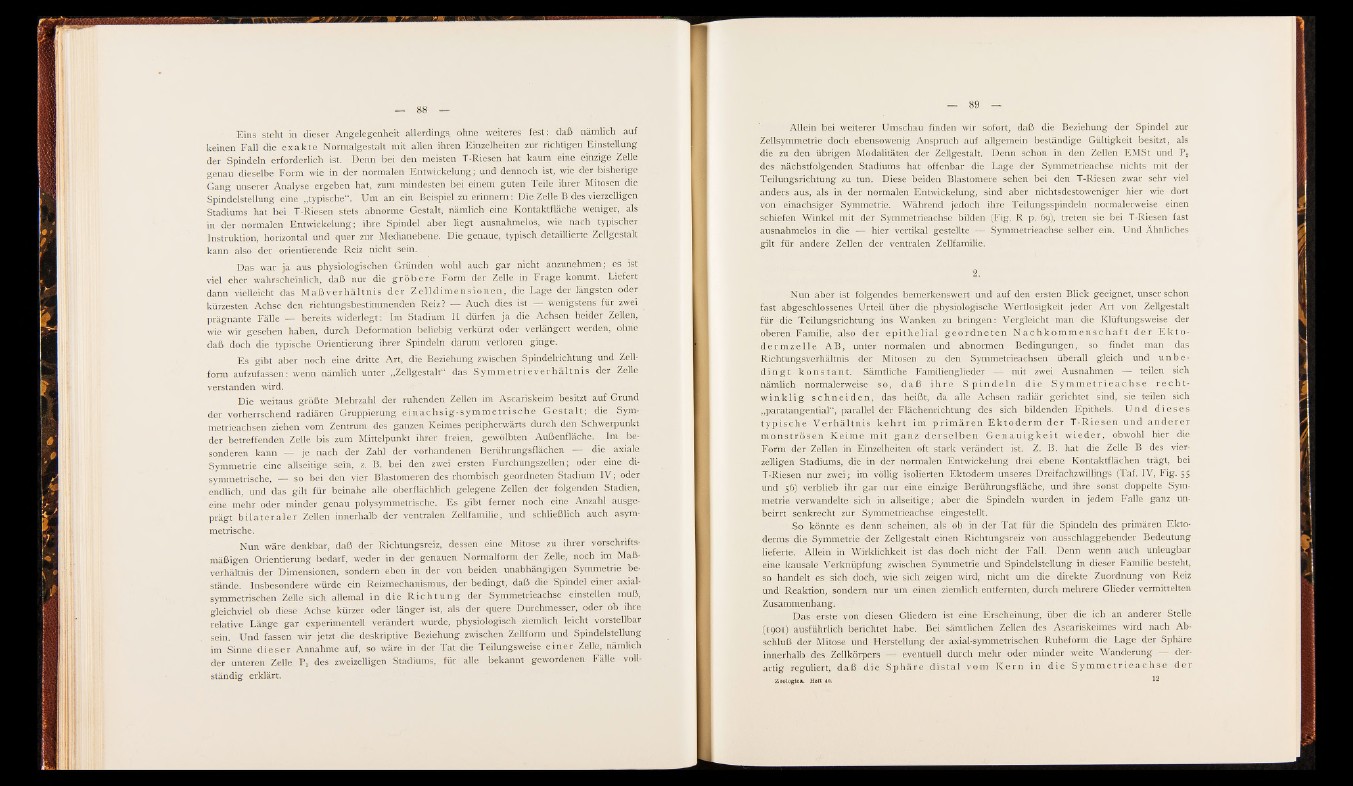
Eins steht in dieser Angelegenheit allerdings, ohne w e it« « -T e s t;* daß nämlich auf
keinen Fall die e x a k t è Nörmalgestalt mit allen ihren Einzelheiten zur richtigen Einstellung
der Spindeln erforderlich ist. Denn bei den meisten T-Riesen hat kaum eine einzige Zelle;’
genau dieselbe Form wie in der normalen Entwickelung; und d en n o ch i|t, wie der bisherige!;;
Gang unserer Analyse ergeben hat, zum mindiäten bei einem guten T e ife Ihrer Mitosen die
Spindelstellung eine „typische“ . Um an ein Beispiel zu erinnern : Die Zelle B des vierzelligen
Stadiums hat bei T-Riesen stets abnorme Gestalt, nämlich eine Kontaktfläche weniger, als
in der normalen Entwickelung; ihre Spindel aber f t g t au sn a hm e l^ wie nach typischer
Instruktion, horizontal und quer zur Medianebene. Die genaue, typisch detaillierte Zellgestalt
kann also der orientierende Reiz nicht sein.
Das war ja aus phy&iMgfcisciien Gründen wohj ||ßich gar nicht anzunehmen; es ist
viel eher wahrscheinlich, daß nur die g r o b e r e Form der Zelle in F ra g e kommt, f e i e r t
dann vielleicht das M a ß v e r h ä l t n i s 'ö e r Z e l ld im e n s i o n e n , die Lägt! der längsten oder
kürzesten Achse den richtungshèstimmenden Reiz? — Auch d ie s i s tH - jremgstens ’fj® zwei
prägnante Fälle -^ b e r e i t s w id e r le g t :'Im Stadium II dürfen ja die Achsen beider Zgljèn,
wie wir gesehen haben, durch“ In forma tion beliebig verkürzt oder verlängert werden, ohne;;;
daß doch die typische Orientierung ihrer Spindeln darum verloren gingë.
E s gib t aber noch . eine dritte Art, die Beziehiarg zwischen ijpindélriehtung und .Zellform
aufzufassen : wenn nämlich unter „Zeilgestai;“ das S y m m e t r i e v e r h ä l t n i s der Zelle
verstanden wird.
Die weitaus größte Mehrzahl der ruhenden Zellen im Ascariskeim besitzt auf Grund
der vorherrschend radiären/Gruppierung e in a .c .h s i g s y m m e t r i s c h c g e s t a l t ; die Symmetrieachsen
ziehen vom Zentrum des ganzen Keiméÿ.peripherwârts durch den Schwerpunkt
der betreffenden Zelle b is ’zum Mittelpunkt ihrer freien, -gewölbten' A u ß e n f lä c l« Im be.-.
sonderen kann B - je nach der Zahl der-yprhandenen Berührungsflächen ■— die axiale
Symmetrie eine allseitige sein, z. B:. %ei den zwei ersten i urchungszellen; oder eine di-
s ym m e t r iÿ h e lg Ë :S;o bei den vier Blastomeren des rhombiSph geordneten Stadium IV ; oder
endlich, und das gilt für beinahe alle, oberflächlich gelegene Zellen der Ä g e n ^ ^ p f a d i e n ,
eine mehr oder minder genau polysymmetrische,. E s gibt ferner noch eine Anzahl ausgeprägt
b i l a t e r a l e r Zellen innerhalb der ventralen Zellfamilie, und schließlich auch asym-
metrische.
Nun wäre denkbar, daß der Richtungsreiz, d e s sen 1 eine M ito se^ u ihrer vorschriftsmäßigen
Orientierung bedarf, weder in der genauen Normalform der Zelle; noch im M aßverhältnis
der Dimensionen, sondern eben in der von beiden unabhängigen1 Symmetrie bestände.
Insbesondere würde ein Reizmechanismus, der bedingt, daß die Spindel einer axial--
symmetrischen Zelle'--sich allemal in d i e R i c h t u n g der Symmetrieachse einstellen muß,
gleichviel ob diese Achse kürzer oder länger ist, als der | | e r e Durchmess;«, oder ob ihre1
relative Län ge gar experimentell verändert wurde, physiologisch ziemlich leicht vorstellbar
sein, ifln d fassen wir jetzt die deskriptive Beziehung zwischen Zellform und Spindelstellung
im Sinne d i filier Annahme auf, so wäre in der T a t die Teilungsweise e in e r Zell^’;nämlich
der unteren Zelle P! des- zweizeiligen Stadiums, für alle bekannt gewordenen- Fälle voll-
ständig erklärt.
Allein bei weiterer Umschau finden wir sofort, daß die Beziehung der Spindel zur
Zellsymmetrie doch ebensowenig Anspruch auf allgemein beständige Gültigkeit besitzt, als
die zu den übrigen Modalitäten der Zellgestalt. Denn schon in den Zellen EM St und P2
des nächstfolgenden Stadiums hat offenbar die La g e der Symmetrieachse nichts mit der
Teilungsrichtung zu tun. Diese beiden Blastomere sehen bei den T-Riesen zwar sehr viel
anders aus, als in der normalen Entwickelung, sind aber nichtsdestoweniger hier wie dort
von einachsiger Symmetrie. Während jedoch ihre Teilungsspindeln normalerweise einen
schiefen Winkel mit der Symmetrieachse bilden (Fig. R p. 69), treten sie bei T-Riesen fast
ausnahmelos im die — hier vertikal gestellte L- 1 Symmetrieachse selber ein. Und Ähnliches
gilt für andere Zellen der ventralen Zellfamilie.
2.
Nun aber ist folgendes bemerkenswert und auf den ersten Blick geeignet, unser schon
fast abgeschlossenes Urteil über die physiologische Wertlosigkeit jeder Art von Zellgestalt
für die Teilungsrichtung ins Wanken zu bringen: Vergleicht man die Klüftungsweise der
oberen Familie, also d e r e p i t h e l i a l g e o r d n e t e n N a c h k o m m e n s c h a f t d e r E k t o d
e rm z e lT e A B , unter normalen und abnormen Bedingungen, so findet man das
Richtungsverhältnis der Mitosen zu den Symmetrieachsen überall gleich und u n b e d
i n g t k o n s t a n t . Sämtliche F am ilie n g lie d e r^ r mit zwei Ausnahmen ■ ^ 1 teilen sich
nämlich normalerweise s o , d a ß i h r e iS p in d e ln d i e S y m m e t r i e a c h s e r e c h t w
i n k l i g s c h n e i d e n , das heißt, da alle Achsen radiär gerichtet sind, sie teilen sich
„paratangential“ , parallel der Flächenrichtung des sich bildenden Epithels. U n d d i e s e s
t y p i s c h e V e r h ä l t n i s k e h r t im p r im ä r e n E k t o d e rm d e r T -R i e s e n u n d a n d e r e r
m o n s t r ö s e n K e im e m it g a n z d e r s e lb e n G e n a u i g k e i t w i e d e r , obwohl hier die
Fortn der Zellen in Einzelheiten oft stark verändert ist. Z. B. hat die Zelle B des vierzelligen
Stadiums, die in der normalen Entwickelung drei ebene Kontaktflächen trägt, bei
T-Riesen nur zwei; im völlig isolierten Ektoderm unseres Dreifachzwillings (Taf. IV, F ig. 55
und 56) verblieb ihr gar nur eine einzige Berührungsfläche, und ihre sonst doppelte Symmetrie
verwandelte sich in allseitige; aber die Spindeln wurden in jedem Falle ganz unbeirrt
senkrecht zur Symmetrieachse eingestellt.
So könnte es denn scheinen, als ob in der T a t für die Spindeln des primären Ektoderms
die Symmetrie der Zellgestalt einen Richtungsreiz von ausschlaggebender Bedeutung
lieferte. Allein in Wirklichkeit ist das doch nicht der Fall. Denn wenn auch unleugbar
eine kausale Verknüpfung zwischen Symmetrie und Spindelstellung in diesef Familie besteht,
so handelt es sich doch, wie sich zeigen wird, nicht um die direkte Zuordnung von Reiz
und Reaktion, sondern nur um einen ziemlich entfernten, durch mehrere Glieder vermittelten
Zusammenhang.
Das erste von diesen Gliedern ist eine Erscheinung, über die ich an anderer Stelle
(1901) ausführlich berichtet habe. Bei sämtlichen Zellen des Ascariskeimes wird nach A b schluß
der Mitose und Herstellung der axial-symmetrischen Ruheform die La ge der Sphäre
innerhalb des Zellkörpers — eventuell durch mehr oder minder weite Wanderung — derartig
reguliert, d a ß die. S p h ä r e d i s t a l v om K e r n in d i e S y m m e t r i e a c h s e d e r
Zoologlca. Heft 40. 12