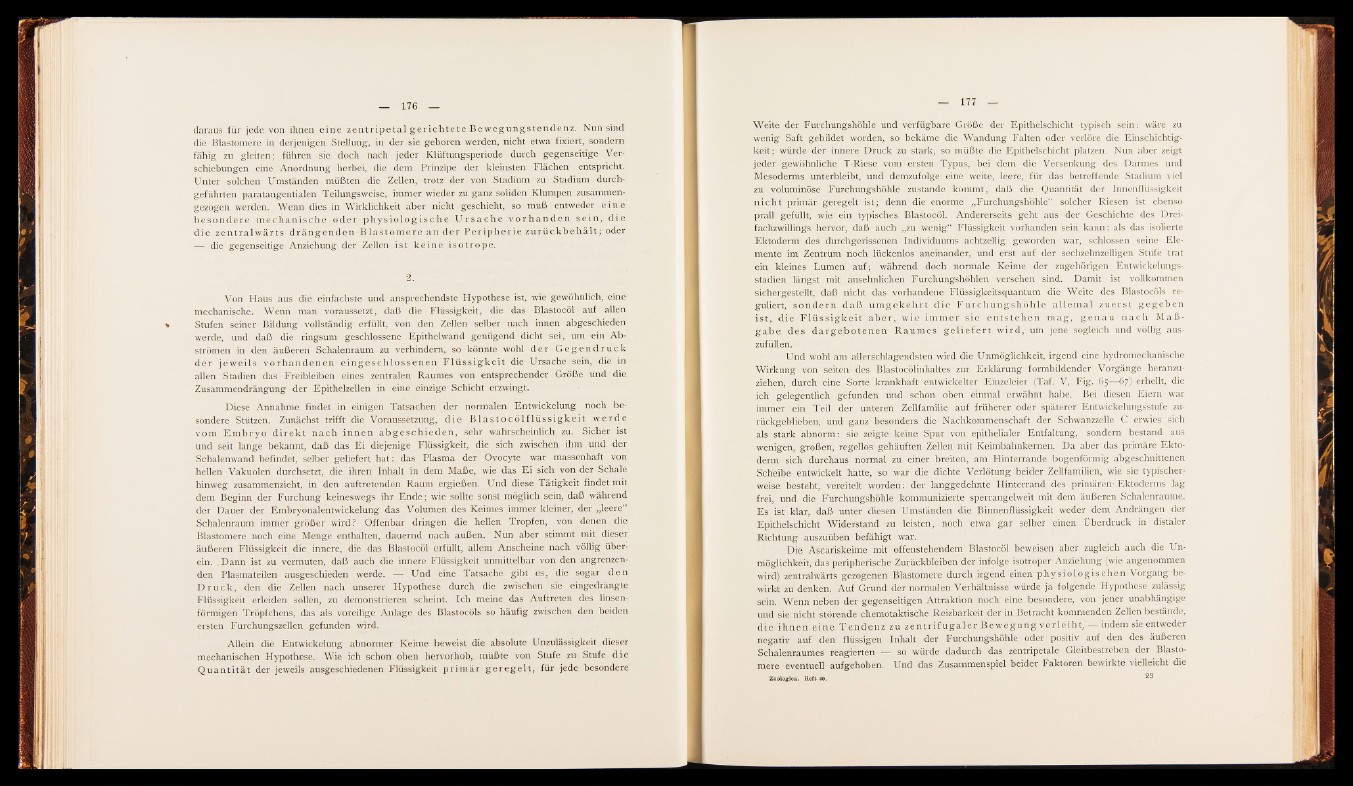
daraus für jede von ihnen e in e z e n t r ip e t a l g e r i c h t e t e B e w e g u n g s t e n d e n z . Nun sind
die Blastomere in derjenigen Stellung, in der sie geboren werden, nicht etwa fixiert, sondern
fähig zu gleiten; führen sie doch nach jeder Klüftungsperiode durch gegenseitige Ver-
schiebungen eine Anordnung herbei, die dem Prinzipe der kleinsten Flächen entspricht.
Unter solchen Umständen müßten die Zellen, trotz der von Stadium zu Stadium durchgeführten
paratangentialen Teilungsweise, immer wieder zu ganz soliden Klumpen zusammengezogen
werden. Wenn dies in Wirklichkeit aber nicht geschieht, so muß entweder e in e
b e s o n d e r e m e c h a n i s c h e o d e r p h y s i o l o g i s c h e U r s a c h e v o r h a n d e n s e i n , d i e
d i e z e n t r a lw ä r t s d r ä n g e n d e n B l a s t o m e r e a n d e r P e r i p h e r i e z u r ü c k b e h ä l t ; oder
— die gegenseitige Anziehung der Zellen i s t k e in e i s o t r o p e .
2.
Von Haus aus die einfachste und ansprechendste Hypothese ist, wie gewöhnlich, eine
mechanische. Wenn man voraussetzt, daß die Flüssigkeit, die das Blastocöl auf allen
% Stufen seiner Bildung vollständig erfüllt, von den Zellen selber nach innen abgeschieden
werde, und daß die ringsum geschlossene Epithelwand genügend dicht sei, um ein A b strömen
in den äußeren Schalenraum zu verhindern, so könnte wohl d e r G e g e n d r u c k
d e r j e w e i l s v o r h a n d e n e n e in g e s c h l o s s e n e n F l ü s s i g k e i t die Ursache sein, die in
allen Stadien das Freibleiben eines zentralen Raumes von entsprechender Größe und die
Zusammendrängung der Epithelzellen in eine einzige Schicht erzwingt.
Diese Annahme findet in einigen Tatsachen der normalen Entwickelung noch besondere
Stützen. Zunächst trifft die Voraussetzung, d i e B l a s t o c ö l f l ü s s i g k e i t .w e r d e
v om E m b r y o d i r e k t n a c h in n e n a b g e s c h i e d e n , sehr wahrscheinlich zu. Sicher ist
und seit lange bekannt, daß das E i diejenige Flüssigkeit, die sich zwischen ihm und der
Schalenwand befindet, selber geliefert hat: das Plasma der Ovocyte war massenhaft von
hellen Vakuolen durchsetzt, die ihren Inhalt in dem Maße, wie das E i sich von der Schale
hinweg zusammenzieht, in den auftretenden Raum ergießen. Und diese Tä tigkeit findet mit
dem Beginn der Furchung keineswegs ihr En d e ; wie sollte sonst möglich sein, daß während
der Dauer der Embryonalentwickelung das Volumen des Keimes immer kleiner, der „leere“
Schalenraum immer größer wird? Offenbar dringen die hellen Tropfen, von denen die
Blastomere noch eine Menge enthalten, dauernd nach außen. Nun aber stimmt mit dieser
äußeren Flüssigkeit die innere, die das Blastocöl erfüllt, allem Anscheine nach völlig überein.
.Dann ist zu vermuten, daß auch die innere Flüssigkeit unmittelbar von den angrenzenden
Plasmateilen ausgeschieden werde. 9 Und eine Tatsache gibt e s , die sogar d e n
D r u c k , den die Zellen nach unserer Hypothese durch die zwischen $ie eingedrängte
Flüssigkeit erleiden sollen, zu demonstrieren scheint. Ich meine das Auftreten des linsenförmigen
Tröpfchens, das als voreilige A nlage des Blastocöls so häufig zwischen den beiden
ersten Furchungszellen, gefunden wird.
Allein die Entwickelung abnormer Keime beweist die absolute Unzulässigkeit dieser
mechanischen Hypothese. W ie ich schon oben hervorhob, müßte von Stufe zu Stufe d ie
Q u a n t i t ä t der jeweils ausgeschiedenen Flüssigkeit p r im ä r g e r e g e l t , für jede besondere
Weite der Furchungshöhle und verfügbare Größe der Epithelschicht typisch sein: wäre zu
wenig Saft gebildet worden, so bekäme die Wandung Falten oder verlöre die Einschichtigke
it; würde der innere Druck zu stark, so müßte die Epithelschicht platzen. Nun aber zeigt
jeder gewöhnliche T-Riese vom ersten Typus, bei dem die Versenkung des Darmes und
Mesoderms unterbleibt, und demzufolge eine weite, leere, für das betreffende Stadium viel
zu voluminöse Furchungshöhle zustande kommt, daß die Quantität der Innenflüssigkeit
n i c h t primär geregelt ist; denn die enorme „Furchungshöhle“ solcher Riesen ist ebenso
prall gefüllt, wie ein typisches Blastocöl. Andererseits geht aus der Geschichte des Dreifachzwillings
hervor, daß auch „zu wenig“ Flüssigkeit vorhanden sein kann: als das isolierte
Ektoderm des durchgerissenen Individuums achtzeilig geworden war, schlossen seine E le mente
im Zentrum noch lückenlos aneinander, und ¿rst auf der sechzehnzelligen Stufe trat
ein kleines Lumen a u f ; während doch normale Keime der zugehörigen Entwickelungsstadien
längst mit ansehnlichen Furchungshöhlen versehen sind. Damit ist vollkommen
sichergestellt, daß nicht das vorhandene Flüssigkeitsquantum die Weite des Blastocöls reguliert,
s o n d e r n d a ß u m g e k e h r t d ie F u r c h u n g s h ö h l e a l l e m a l z u e r s t g e g e b e n
i s t , ’d ie F lü s s i g k e i t a b e r , w ie im m e r s i e e n t s t e h e n m a g , g e n a u n a c h M a ß g
a b e d e s d a r g e .b o t e n e n R a u m e s g e l i e f e r t w i r d , um jene sogleich und völlig auszufüllen.
Und wohl am allerschlagendsten wird die Unmöglichkeit, irgend eine hydromechanische
Wirkung von seiten des Blastocölinhaltes zur Erklärung formbildender Vorgänge heranzuziehen,
durch eine Sorte krankhaft entwickelter Einzeleier (Taf. V , Fig. 65S 67) erhellt, die
ich gelegentlich gefunden und schon oben einmal erwähnt habe. Bei diesen Eiern war
immer ein T e il der unteren Zellfamilie auf früherer oder späterer Entwickelungsstufe zurückgeblieben,
und ganz besonders die Nachkommenschaft der Schwanzzelle C erwies sich
als stark abnorm: sie zeigte keine Spur von epithelialer Entfaltung, sondern bestand aus
wenigen, großen, regellos gehäuften Zellen mit Keimbahnkernen. Da aber das primäre E k to derm
sich durchaus normal zu einer breiten, am Hinterrande bogenförmig abgeschnittenen
Scheibe entwickelt hatte, so war die dichte Verlötung beider Zellfamilien,, wie sie typischerweise
besteht, vereitelt worden: der langgedehnte Hinterrand des primären- Ektoderms lag
frei, und die Furchungshöhle kommunizierte sperrangelweit mit dem äußeren Schalenraume.
E s ist klar, daß unter diesen Umständen die Binnenflüssigkeit weder dem Andrängen der
Epithelschicht Widerstand zu leisten, noch etwa gar selber einen Überdruck in distaler
Richtung auszuüben befähigt war.
Die Ascariskeime mit offenstehendem Blastocöl beweisen aber zugleich auch die Unmöglichkeit,
das peripherische Zurückbleiben der infolge isotroper Anziehung (wie angenommen
wird) zentralwärts gezogenen Blastomere durch irgend einen p h y s i o lo g i s c h e n V o rgang bewirkt
zu denken. A u f Grund der normalen Verhältnisse würde ja folgende Hypothese zulässig
sein. Wenn neben der gegenseitigen Attraktion noch eine besondere, von jener unabhängige
und sie nicht störende chemotaktische Reizbarkeit der in Betracht kommenden Zellen bestände,
d ie ih n e n e in e T e n d e n z zu z e n t r i f u g a l e r B e w e g u n g v e r l e ih t , indem sie entweder
negativ auf den flüssigen Inhalt der Furchungshöhle oder positiv auf den des äußeren
Schalenraumes reagierten — so würde dadurch das zentripetale Gleitbestreben der Blastomere
eventuell aufgehoben. Und das Zusammenspiel beider Faktoren bewirkte vielleicht die
Zoologica. Heft 40.