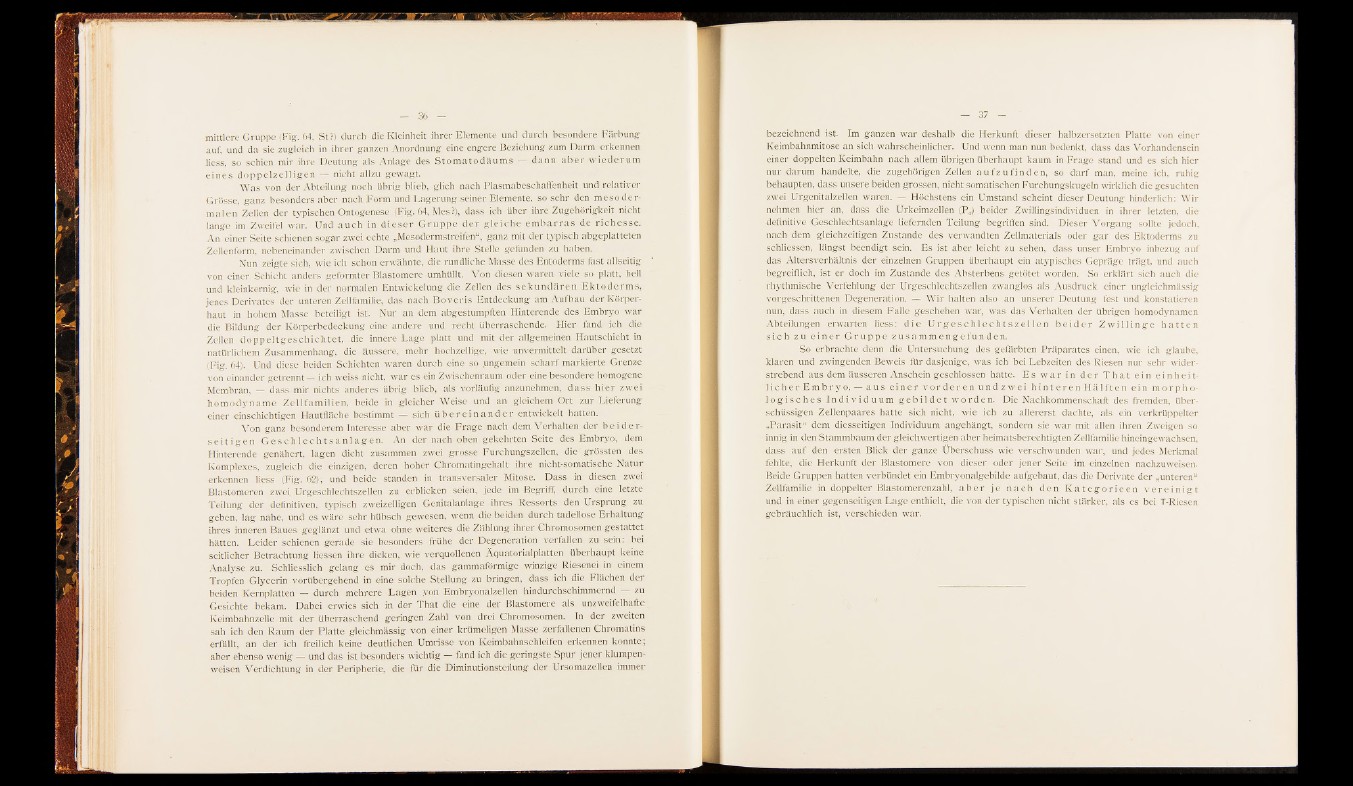
mittlere Gruppe (Fig. 64, St?) durch die Kleinheit ihrer Elemente und durch besondere Färbung
auf, und da sie zugleich in ihrer ganzen Anordnung eine engere Beziehung zum Darm erkennen
liess, so schien mir ihre Deutung als A nlage des S t om a to d ä um s — d an n a b e r w i e d e r um
e in e s d o p p e l z e i l ig e n — nicht allzu gewagt.
W a s von der Abteilung noch übrig blieb, glich nach Plasmabeschaffenheit und relativer
Grösse, ganz besonders aber nach Form und La gerung seiner Elemente, so sehr den m e s o d e r m
a le n Zellen der typischen Ontogenese (Fig. 64, Mes?)} dass ich über ihre Zugehörigkeit nicht
lange im Zweifel war. Und a u c h in d i e s e r G r u p p e d e r g le i c h e em b a r r a s de r i c h e s s e .
A n einer Seite schienen sogar zwei echte „Mesodermstreifen“ , ganz mit der typisch abgeplatteten
Zellenform, nebeneinander zwischen Darm und Haut ihre Stelle gefunden zu haben.
Nun zeigte sich, wie ich schon erwähnte, die rundliche Masse des Entoderms fast allseitig
von einer Schicht anders geformter Blastomere umhüllt. V o n diesen waren viele so platt, hell
und kleinkernig, wie in der normalen Entwickelung die Zellen des ¡ s e k u n d ä r e n .E k to d e rm s ,
jenes Derivates der unteren Zellfamilie, das nach B o v e r i s Entdeckung am A u fb au der Körperhaut
in hohem Masse beteiligt ist. Nur an dem abgestumpften Hinterende des Embryo wa r
die Bildung der Körperbedeckung eine andere und recht überraschende. Hier fand ich die
Zellen d o p p e l t g e s c h i c h t e t , die innere L a g e platt und mit der allgemeinen Hautschicht in
natürlichem Zusammenhang, die äussere, mehr hochzeilige, wie unvermittelt darüber gesetzt
(Fig. 64). Und diese beiden Schichten waren durch eine so ungemein sch a rf markierte Grenze
von einander g e t ren n t'- ich weiss nicht, w a r es ein Zwischenraum oder eine besondere homogene
Membran, -H d a s s mir nichts anderes übrig blieb, als"vorläufig anzunehmen, d a s s h ie r zw e i
h om o d y n am e Z e l l fam i l ie n , beide in gleicher Weise und an gleichem Ort zur Lieferung
einer einschichtigen Hautfläche bestimmt — sich ü b e r e i n a n d e r entwickelt hatten.
V on ganz besonderem Interesse aber w a r die F ra g e nach dem Verhalten der b e i d e r-
s e i t i g e n G e s c h l e c h t s a n l a g e n . An der nach oben gekehrten Seite des Embryo, dem
Hinterende genähert, lagen dicht zusammen zwei grosse Furchungszellen, die grössten des
Komplexes, zugleich die einzigen, deren hoher Chromatingehalt ihre nicht-somatische Natur
erkennen liess (Fig. 62); und beide standen in transversaler Mitose. Dass in diesen zwei
Blastomeren zwei, Urgeschlechtszellen zu erblicken seien, jede im Begriff, durch eine letzte
Teilung der definitiven, typisch zweizeiligen Genitalanlage ihres Ressorts den Ursprung zu
geben, la g nahe, und es wäre sehr hübsch gewesen, wenn die beiden durch tadellose Erhaltung
ihres inneren Baues geglänzt und etwa ohne weiteres die Zählung ihrer Chromosomen gestattet
hätten. Leider schienen gerade sie besonders frühe der Degeneration verfallen zu sein: bei
seitlicher Betrachtung Hessen ihre dicken, wie verquollenen Äquatorialplatten überhaupt keine
Ana ly se zu. Schliesslich gelang es mir doch, das gammaförmige winzige Riesenei in einem
Tropfen Glycerin vorübergehend in eine solche Stellung zu bringen, dass ich die Flächen der
beiden Kernplatten — durch mehrere La gen yon Embryonalzellen hindurchsehimmernd zu
Gesichte bekam. Dabei erwies sich in der T h a t die eine der Blastomere als unzweifelhafte
Keimbahnzelle mit der überraschend geringen Zahl von drei Chromosomen. In der zweiten
sah ich den Raum der Platte gleichmässig von einer krümeligen Masse zerfallenen Chromatins
erfüllt, an der ich freilich keine deutlichen Umrisse von Keimbähnschleifen erkennen konnte;
aber ebenso wenig — und das ist besonders w ich t igH fand ich die geringste Spur jener klumpenweisen
Verdichtung in der Peripherie, die für die Diminutionsteilung der Ursomazellen immer
bezeichnend ist. Im ganzen war deshalb die Herkunft dieser halbzersetzten Platte von einer
Keimbahnmitose an sich wahrscheinlicher. Und wenn man nun bedenkt, dass das Vorhandensein
einer doppelten Keimbahn nach allem übrigen überhaupt kaum in F ra g e stand und es sich hier
nur darum handelte, die zugehörigen Zellen a u f z u f i n d e n , so dar f man, meine ich, ruhig
behaupten, dass unsere beiden grossen, nicht somatischen Furchungskugeln wirklich die gesuchten
zwei Urgenitalzellen waren. — Höchstens ein Umstand scheint dieser Deutung hinderlich: W ir
nehmen hier an, dass die Urkeimzellen (P4) beider Zwillingsindividuen in ihrer letzten, die
definitive Geschlechtsanlage liefernden Teilung begriffen sind. Dieser V o rg an g sollte jedoch,
nach dem gleichzeitigen Zustande des verwandten Zellmaterials oder g a r des Ektoderms zu
schliessen, längst beendigt sein. Es ist aber leicht zu sehen, dass unser Embryo inbezug auf
das Altersverhältnis der einzelnen Gruppen überhaupt ein atypisches Gepräge trägt, und auch
begreiflich, ist er doch im Zustande des Absterbens getötet worden. So erklärt sich auch die
rhythmische Verfehlung der Urgeschlechtszellen zwanglos als Ausdruck einer ungleichmässig
vorgeschrittenen Degeneration. — W ir halten also an unserer Deutung fest und konstatieren
nun, dass auch in diesem Falle geschehen war, was das Verhalten der übrigen homodynamen
Abteilungen erwarten liess: d i e U r g e s c h l e c h t s z e l l e n b e i d e r Z w i l l i n g e h a t t e n
s i c h z u e i n e r G r u p p e z u s a m m e n g e f u n d e n .
So erbrachte denn die Untersuchung des gefärbten Präparates einen, wie ich glaube,
klaren und zwingenden Beweis für dasjenige, was ich bei Lebzeiten des Riesen nur sehr widerstrebend
aus dem äusseren Anschein geschlossen hatte. E s w a r in d e r T h a t e in e i n h e i t l
i c h e r E m b r y o - ,— a u s e in e r v o r d e r e n u n d z w e i h i n t e r e n H ä l f t e n e in m o r p h o l
o g i s c h e s I n d i v i d u u m g e b i l d e t w o r d e n . Die Nachkommenschaft des fremden, überschüssigen
Zellenpaares hatte sich nicht, wie ich zu allererst dachte, als ein verkrüppelter
„Parasit“ dem diesseitigen Individuum angehängt, sondern sie war mit allen ihren Zweigen so
innig in den Stammbaum der gleichwertigen aber heimatsberechtigten Zellfamilie hineingewachsen,
dass au f den ersten Blick der ganze Überschuss wie verschwunden war, und jedes Merkmal
fehlte, die Herkunft der Blastomere von dieser oder jener Seite im einzelnen nachzuweisen.
Beide Gruppen hatten verbündet ein Embryonalgebilde aufgebaut, das die Derivate der „unteren“
Zellfamilie in doppelter Blastomerenzahl, a b e r j e h a c h d e n K a t e g o r i e e n v e r e i n i g t
und in einer gegenseitigen L a g e enthielt, die von der typischen nicht stärker, als es bei T-Riesen
gebräuchlich ist, verschieden war.