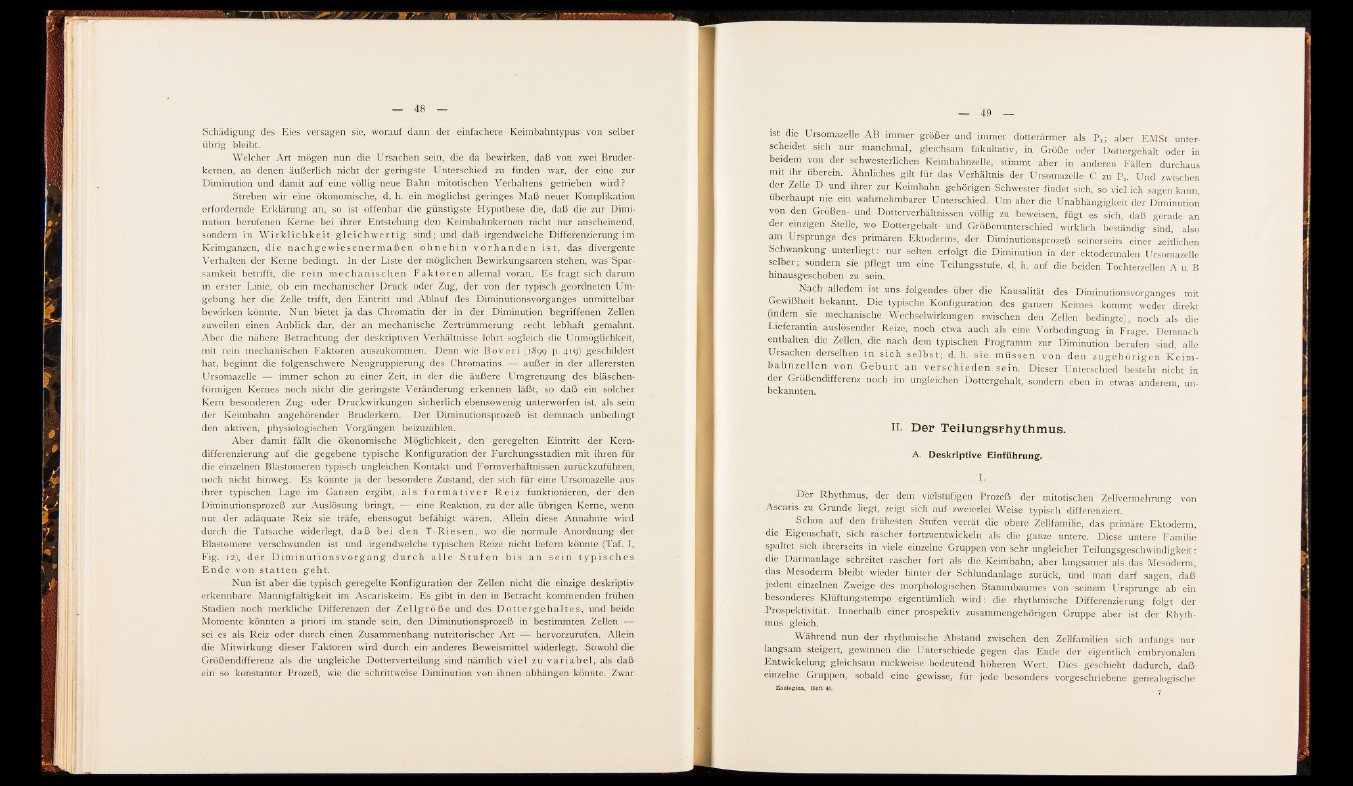
Schädigung des Eies versagen sie, worauf dann der einfachere Keimbahntypus von selber
übrig bleibt.
Welcher A r t mögen nun die Ursachen sein, die da bewirken, daß von zwei Bruderkernen,
an denen äußerlich nicht der geringste Unterschied zu finden war, der eine zur
Diminution und damit auf eine völlig neue Bahn mitotischen Verhaltens getrieben wird?
Streben wir eine ökonomische, d. h. ein möglichst geringes Maß neuer Komplikation
erfordernde Erklärung an, so ist offenbar die günstigste Hypothese die, daß die zur Diminution
berufenen Kerne bei ihrer Entstehung den Keimbahnkernen nicht nur anscheinend,
sondern in W i r k l i c h k e i t g l e i c h w e r t i g sind; und daß irgendwelche Differenzierung im
Keimganzen, d ie n a c h g e w i e s e n e rm a ß e n o h n e h i n v o r h a n d e n i s t , das divergente
Verhalten der Kerne bedingt. In der Liste der möglichen Bewirkungsarten stehen, was Sparsamkeit
betrifft, die r e in m e c h a n i s c h e n F a k t o r e n allemal voran. E s fra gt sich darum,
in erster Linie, ob ein mechanischer Druck oder Zug, der von der typisch geordneten Umgebung
her die Zelle trifft, den Eintritt und A blauf des DiminutionsVorganges unmittelbar
bewirken könnte. Nun bietet ja das Chromatin der in der Diminution begriffenen Zellen
zuweilen einen Anblick dar, der an mechanische Zertrümmerung recht lebhaft gemahnt.
Aber die nähere Betrachtung der deskriptiven Verhältnisse lehrt sogleich die Unmöglichkeit,
mit rein mechanischen Faktoren auszukommen. Denn wie B o v e r i (1899 p. 419) geschildert
hat, beginnt die folgenschwere Neugruppierung des Chromatins iM- au ß e r in der allerersten
Ursomazelle — immer schon zu einer Zeit, in der die äußere Umgrenzung des bläschenförmigen
Kernes noch nicht die geringste Veränderung erkennen läßt, so daß ein solcher
Kern besonderen Zug- oder Druckwirkungen sicherlich ebensowenig unterworfen ist, als sein
der Keimbahn angehörender Bruderkern. Der Diminutionsprozeß ist demnach unbedingt
den aktiven, physiologischen Vorgängen beizuzählen.
A b e r damit fällt die ökonomische Möglichkeit, den geregelten Eintritt der Kerndifferenzierung
auf die gegebene typische Konfiguration der Furchungsstadien mit ihren für
die einzelnen Blastomeren typisch ungleichen Kontakt- und Formverhältnissen zurückzuführen,
noch nicht hinweg. Es könnte ja der besondere Zustand, der sich für eine Ursomazelle aus
ihrer typischen La g e im Ganzen ergibt, a l s f o r m a t i v e r R e i z funktionieren, der den
Diminutionsprozeß zur Auslösung bringt, — eine Reaktion, zu der alle übrigen Kerne, wenn
nur der adäquate Reiz sie träfe, ebensogut befähigt wären. Allein diese Annahme wird
durch die Tatsache widerlegt, d a ß b e i d e n T - R i e s e n , wo die normale Anordnung der
Blastomere verschwunden ist und irgendwelche typischen Reize nicht liefern könnte (Taf. I,
Fig. 12), d e r D im in u t i o n s v o r g a n g d u r c h a l l e S t u f e n b i s a n s e i n t y p i s c h e s
E n d e v o n s t a t t e n g e h t .
Nun ist aber die typisch geregelte Konfiguration der Zellen nicht die einzige deskriptiv
erkennbare Mannigfaltigkeit im Ascariskeim. E s gibt in den in Betracht kommenden frühen
Stadien noch merkliche Differenzen der Z e l l g r ö ß e und des D o t t e r g e h a l t e s , und beide
Momente könnten a priori im Stande sein, den Diminutionsprozeß in bestimmten Zellen —
sei es als Reiz oder durch einen Zusammenhang nutritorischer Art — hervorzurufen. Allein
die Mitwirkung dieser Faktoren wird durch ein anderes Beweismittel widerlegt. Sowohl die
Größendifferenz als die ungleiche Dotterverteilung- sind nämlich v i e l zu v a r ia b e l , .¡ a l s daß
ein so konstanter Prozeß, wie die schrittweise Diminution von ihnen abhängen könnte. Zwar
ist die Ursomazelle A B immer größer und immer dotterärmer als P x; aber EM S t unter- HflSfifr nUr manchmal> fakultativ> in Größe oder Dottergehalt oder in
betdem von d e f t f c h w Ä r l i c i | » Keii#bähnZBjle,||timmt aber in anderen Fällen durchaus
mit ihr überein.. Ähnliches gilt für Ä Verhältnis? d e r Ursomazelle C zu P s. Und zwischen
Zelle ° und 4ur Keimbahmv gehörigen Schwester findet sich, so vieLich sagen kann,
ü b e r h a u Ä ä * ein wahrnehmbar||Bnterschi:ed. Um aber die: Unabhängigkeit der Diminution
„vbji den G rö | |J fc und DotterverhiiUnissen völlig zu few e isen, fügt -eSi sich, d a ß gerade an
der einzigen S te llS |w < Ä 3.ottefgehalt- und Größenunterschied wirklich beständig sind, also
am Ursprünge ^ p r im ä r e n Ektodeofesj der Dimmutionsprozgß seinerseits einer zeitlichen
■phwankung unteii’8 : nur seltsjS;-.erfolgt dipDiminution in der ektodermalen Ursomazelle
S^ be® * P (tem S1E pflegt B eine Teilung sstufe> d. h. auf die beiden Töchterzellen A u. B
hinausgeschoben zu sein.
\ Mach alledem ist uns^olgendist über die Kausalität des Diminutionsvorganges mit
Gewißheit bekannt. Die typische Konfigüration»1ääs^anzfen Keimes kommt weder direkt
mechanische We<|||elwirkungen zwischen den Zellen bedingte*!? noch als die
Lieferantin jggislösender Reize, no<J|| etwa auch H ! einö Vorbedingung in Frage. Demnach
enthalten df^jZellen, die nach denfc%pischen Programm zur Diminution berufen sind, alle
Ursachen derselben in s i c h g l 1 b-st',fd h r p j pm ü J jle n v o n d e n z u g e h ö r i g e n K e im -
b ahnz ie-Uen r t® ^ n ..« b u r t a n y e rC c h ie d t .e n . f e in . B i e s e r Unterschied besteht nicht in
der Großendifferenz noch im ungleichen Ijljöttergehalt, H indern eben in etwas anderem, un-
bekannten.
II. Der Teilungsrhythmus.
A . Deskriptive Einführung.
1.
■ k g h y t t o n u s , der dem vielstüfigen P r c Ä der m itö t jg lfp fi fellftf-mehmng von
. « Ä f i s zu Grunde -liegt, tp ig't sich auf zweierlei Weise typisch differenziert) -
; d®éhon SpByden frühesten tfgtufeH verrät die o lS ^ Z e llfam iliM d a s primäre Ektoderm,
l i é Eigenschaft, sich rascher fortzuentwickeln als die ganze untere. Diese u n tê fS F am ilie
spahfet. sich ihrerseits in viele einzelne Gruppen voti sehr ungleicher Teilungsgesehwindigkeit :
die Därmanlage schreitetxrasoher fort p||s die Keimbahn, aber langsamer als das Mesoderm,
das Mesoderm bleibt wiedër hinter der’’ Schlundanlage zurück; und man darf sageh, daß
jedem einzelnen Zweige des morphdlê^ischen .Stanunbaumes von seinem Ursprünge all ein
besonderes Klüftungstempo e ig e n tüm li^ wird : dit? rhythmische Differenzierung folgt der
Prospektivitäth-innerhalb einer pr«pëktiv; zusammengehörigen Gruppe aber ist der Rhyth-
mus gleich.
Während nun der rhythmische Abstand zwischen den Zellfamilien sich anfangs nur
langsam steigert, gewinnen die Unterschiede gegen das Ende der eigentlich embryonalen
Entwickelung gleichsam ruckweise bedeutend höheren Wert. Dies geschieht dadurch, daß
einzelne Gruppen, sobald eine gewisse,- für jede besonders vorgeschriebene genealogische
Zoologlca. lieft 40.