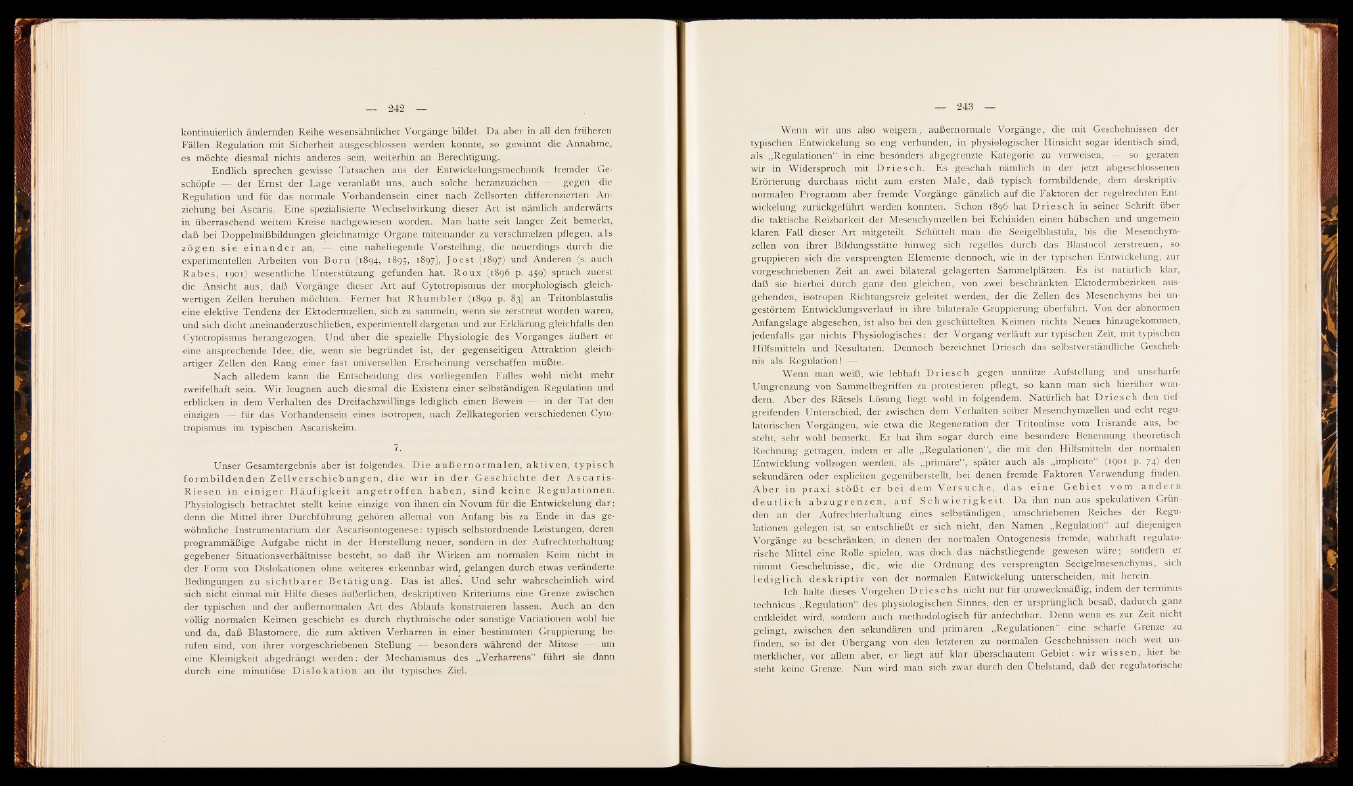
kontinuierlich ändernden Reihe wesensähnlicher Vorgänge bildet. D a aber in all den früheren
F ä llen . Regulation mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, so gewinnt die Annahme,
es möchte diesmal, nichts anderes sein, weiterhin an Berechtigung.
Endlich sprechen gewisse Tatsachen aus der Entwickelungsmechanik fremder Geschöpfe
— der Ernst der La ge veranlaßt uns, auch solche heranzuziehen — gegen die
Regulation und für das normale Vorhandensein einer nach Zellsorten differenzierten A n ziehung
bei Ascaris. Eine spezialisierte Wechselwirkung dieser Art ist nämlich anderwärts
in überraschend weitem Kreise nachgewiesen worden. Man hatte seit langer Zeit bemerkt,
daß bei Doppelmißbildungen gleichnamige Organe miteinander zu verschmelzen pflegen, a l s
z ö g e n s i e e i n a n d e r an, — eine naheliegende Vorstellung, die neuerdings durch die
experimentellen Arbeiten von B o r n (1894, 1895, 1897), J o e s t (1897) und Anderen (s. auch
R a b e s , 1901) wesentliche Unterstützung gefunden hat. R o u x (1896 p. 459) sprach zuerst
die Ansicht aus, daß Vorgänge dieser A r t auf Cytotropismus der morphologisch gleichwertigen
Zellen beruhen möchten. Ferner hat R h u m b l e r (1899 p. 83) an Tritonblastulis
eine elektive Tendenz der Ektodermzellen, sich zu sammeln, wenn sie zerstreut worden waren,
und sich dicht aneinanderzuschließen, experimentell dargetan und zur Erklärung gleichfalls den
Cytotropismus herangezogen. Und über die spezielle Physiologie des Vorganges äußert er
eine ansprechende Idee, die, wenn sie begründet ist, der gegenseitigen Attraktion gleichartiger
Zellen den Rang einer fast universellen Erscheinung verschaffen müßte.
Nach alledem kann die Entscheidung des vorliegenden Falles wohl nicht mehr
zweifelhaft sein. W ir leugnen auch diesmal die Existenz einer selbständigen Regulation und
erblicken in dem Verhalten des Dreifachzwillings lediglich einen Beweis | | l in der T a t den
einzigen — für das Vorhandensein eines isotropen, nach Zellkategorien verschiedenen Cytotropismus
im typischen Ascariskeim.
7.
Unser Gesamtergebnis aber ist folgendes. D i e a u ß e r n o rm a l e n , a k t i v e n , t y p i s c h
f o rm b i ld e n d e n Z e l l v e r s c h i e b u n g e n , d i e w i r in d e r G e s c h i c h t e d e r A s c a r i s -
R i e s e n in e in i g e r H ä u f i g k e i t a n g e t r o f f e n h a b e n , s in d k e in e R e g u l a t io n e n .
Physiologisch betrachtet stellt keine einzige von ihnen ein N ovum für die Entwickelung d a r ;
denn die Mittel ihrer Durchführung gehören allemal von Anfang bis zu Ende in das g e wöhnliche
Instrumentarium der Ascarisontogenese: typisch selbstordnende Leistungen, deren
programmäßige Aufgabe nicht in der Herstellung neuer, sondern in der Aufrechterhaltung
gegebener Situationsverhältnisse besteht, so daß ihr Wirken am normalen Keim nicht in
der Form von Dislokationen ohne weiteres erkennbar wird, gelangen durch etwas veränderte
Bedingungen zu s i c h t b a r e r B e t ä t i g u n g . Das ist alles. Und sehr wahrscheinlich wird
sich nicht einmal mit Hilfe dieses äußerlichen, deskriptiven Kriteriums eine Grenze zwischen
der typischen und der außernormalen A r t des Ablaufs konstruieren lassen. Auch an den
völlig normalen Keimen geschieht es durch rhythmische oder sonstige Variationen wohl hie
und da, daß Blastomere, die zum aktiven Verharren in einer bestimmten Gruppierung berufen
sind, von ihrer vorgeschriebenen Stellung — besonders während der Mitose — um
eine Kleinigkeit abgedrängt werden: der Mechanismus des „Verharrens“ führt sie dann
durch eine minutiöse D i s l o k a t i o n an ihr typisches Ziel.
Wenn wir uns also weigern, außernormale V o rgän ge , die mit Geschehnissen der
typischen Entwickelung so eng verbunden, in physiologischer Hinsicht sogar identisch sind,
als „Regulationen“ in eine besonders abgegrenzte Kategorie zu verweisen, — so geraten
wir in Widerspruch mit D r i e s c h . E s geschah nämlich in der jetzt abgeschlossenen
Erörterung durchaus nicht zum ersten Ma le , daß typisch formbildende, dem deskriptivnormalen
Programm aber fremde Vorgänge gänzlich auf die Faktoren der regelrechten En twickelung
zurückgeführt werden konnten. Schon 1896 hat D r i e s c h in seiner Schrift über
die taktische Reizbarkeit der Mesenchymzellen bei Echiniden einen hübschen und ungemein
klaren F a ll dieser A r t mitgeteilt. Schüttelt man die Seeigelblastula, bis die Mesenchymzellen
von ihrer Bildungsstätte hinweg sich regellos durch das Blastocöl zerstreuen, so
gruppieren sich die versprengten Elemente dennoch, wie in der typischen Entwickelung, zur
vorgeschriebenen Zeit an zwei bilateral gelagerten Sammelplätzen. E s ist natürlich klar,
daß sie hierbei durch ganz den gleichen, von zwei beschränkten Ektodermbezirken ausgehenden,
isotropen Richtungsreiz geleitet werden, der die Zellen des Mesenchyms bei ungestörtem
Entwicklungsverlauf in ihre bilaterale Gruppierung überführt. Von der abnormen
Anfangslage abgesehen, ist also bei den geschüttelten Keimen nichts Neues hinzugekommen,
jedenfalls gar nichts Physiologisches: der V o rg an g verläuft zur typischen Zeit, mit typischen
Hilfsmitteln und Resultaten. Dennoch bezeichnet Driesch das selbstverständliche Geschehnis
als Regulation!
Wenn man weiß, wie lebhaft D r i e s c h gegen unnütze Aufstellung und unscharfe
Umgrenzung von Sammelbegriffen zu protestieren pflegt, so kann man sich hierüber wundern.
A ber des Rätsels Lösung-liegt wohl in folgendem. Natürlich hat D r i e s c h den tiefgreifenden
Unterschied, der zwischen dem Verhalten seiner Mesenchymzellen und echt regulatorischen
Vorgängen, wie etwa die Regeneration der Tritonlinse vom Irisrande aus, besteht,
sehr wohl bemerkt. E r hat ihm sogar durch eine besondere Benennung theoretisch
Rechnung getragen, indem er alle „Regulationen“ , die mit den Hilfsmitteln der normalen
Entwicklung vollzogen werden, als „primäre“ * später auch als „implicite“ (1901 p. 74) den
sekundären oder expliciten gegenüberstellt, bei denen fremde Faktoren Verwendung finden.
A b e r in p r a x i s t ö ß t e r b e i d em V e r s u c h e , d a s e in e G e b i e t v om ä n d e r n
d e u t l i c h a b z u g r e n z e n , a u f S c h w i e r i g k e i t . Da ihm nun aus spekulativen Gründen
an der Aufrechterhaltung eines selbständigen, umschriebenen Reiches der Regulationen
gelegen ist, so entschließt er sich nicht, den Namen „Regulation“ auf diejenigen
Vo rgänge zu beschränken, in denen der nortnalen Ontogenesis fremde, wahrhaft regulatorische
Mittel eine Rolle spielen, was doch das nächstliegende gewesen wäre; sondern er
nimmt Geschehnisse, die, wie die Ordnung des versprengten Seeigelmesenchyms, sich
l e d i g l i c h d e s k r ip t i v von der normalen Entwickelung unterscheiden, mit herein.
Ich halte dieses Vorgehen D r i e s c h s nicht nur für unzweckmäßig, indem der terminus
technicus „Regulation“ des physiologischen Sinnes, den er ursprünglich besaß, dadurch ganz
entkleidet wird, sondern auch methodologisch für anfechtbar. Denn wenn es zur Zeit nicht
gelingt, zwischen den sekundären und primären „Regulationen“ eine scharfe Grenze zu
finden, so ist der Übergang von den letzteren zu normalen Geschehnissen noch weit unmerklicher,
vor allem aber, er liegt auf klar überschautem Gebiet: w i r w i s s e n , hier besteht
keine Grenze. Nun wird man sich zwar durch den Übelstand, daß der regulatorische