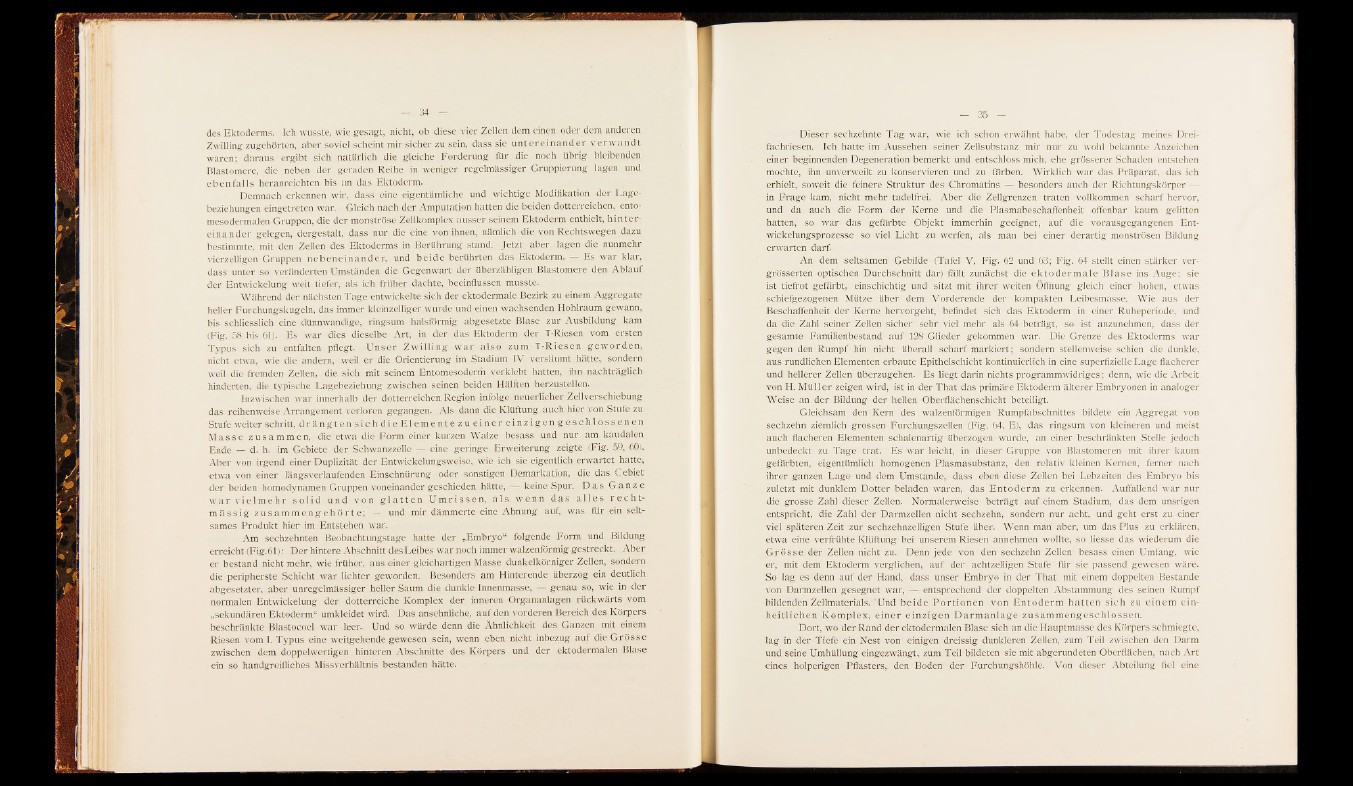
des Ektoderms. Ich wusste, wie gesagt, nicht, ob diese v ier Zellen dem einen oder dem anderen
Zwilling zugehörten, aber soviel scheint mir sicher zu sein, dass sie u n t e r e in a n d e r v e rw a n d t
waren; daraus ergibt sich natürlich die gleiche Forderung für die noch übrig bleibenden
Elastomere, die neben der geraden Reihe in weniger regelmässiger Gruppierung lagen und
e b e n f a l l s heranreichten bis an das Ektoderm.
Demnach erkennen wir, dass eine eigentümliche und wichtige Modifikation der L a g e beziehungen
eingetreten war. Gleich nach der Amputation hatten die beiden dotterreichen, ento-
mesodermalen Gruppen, die der monströse Zellkomplex ausser seinem Ektoderm enthielt, h in t e r e
in a n d e r gelegen, dergestalt, dass nur die eine von ihnen, nämlich die von Rechtswegen dazu
bestimmte, mit den Zellen des Ektoderms in Berührung stand. Jetzt aber lagen die nunmehr
vierzeiligen Gruppen n e b e n e in a n d e r , und b e id e berührten das Ektoderm. — Es w a r klar,
dass unter so veränderten Umständen die Gegenwart der überzähligen Blastomere den A b la u f
der Entwickelung wreit tiefer, als ich früher dachte, beeinflussen musste.
Während der nächsten T a g e entwickelte sich der ektodermale Bezirk zu einem A g g re g a te
heller Furchungskugeln, das immer kleinzeiliger wurde und einen wachsenden Hohlraum gewann,
bis schliesslich eine dünnwandige, ringsum halsförmig abgesetzte Blase zur Ausbildung kam
(Fig. 58 bis 61). Es w a r dies dieselbe A rt, in der das Ektoderm der T-Riesen vom ersten
Typ us sich zu entfalten pflegt. Uns*er Z w i l l in g w a r a l s o zum T -R ie s e n g e w o r d e n ,
nicht etwa, wie die ändern, weil er die Orientierung im Stadium IV versäumt hätte, sondern
weil die fremden Zellen, die sich mit seinem Entomesoderm verklebt hatten, ihn nachträglich
hinderten, die typische Lagebeziehung zwischen seinen beiden Hälften herzustellen.
Inzwischen wa r innerhalb der dotterreichen Region infolge neuerlicher Zellverschiebung
das reihenweise Arrangement verloren gegangen. A ls dann die Klüftung auch hier von Stufe zu
Stufe weiter schritt, d r ä n g t e n s i c h d i e E l e m e n t e z u e i n e r e i n z i g e n g e s c h l o s s e n e n
M a s s e z u s a m m e n , die etwa die Form einer kurzen W a lze besass und nur am kaudalen
Ende — d. h. im Gebiete der Schwanzzelle — eine geringe Erweiterung zeigte (Fig. 59, 60).
A b e r von irgend einer Duplizität der Entwickelungsweise, wie ich sie eigentlich erwartet hatte,
e tw a von einer längsverlaufenden Einschnürung oder sonstigen Demarkation, die das Gebiet
der beiden homodynamen Gruppen voneinander geschieden hätte,||§ keine Spur. D a s G a n z e
w a r v i e lm e h r s o l i d u n d v o n g l a t t e n U m r i s s e n , a l s w e n n d a s a l l e s r e c h t m
ä s s i g z u s a m m e n g e h ö r t e ; -fj^^und mir dämmerte eine Ahnung auf, was für ein seltsames
Produkt hier im Entstehen war.
Am sechzehnten Beobachtungstage hatte der „Embryo“ folgende Form und Bildung
erreicht (Fig.61): Der hintere Abschnitt des Leibes w a r noch immer walzenförmig gestreckt. A b e r
er bestand nicht mehr, wie früher, aus einer gleichartigen Masse dunkelkörniger Zellen,, sondern
die peripherste Schicht w a r lichter geworden. Besonders am Hinterende überzog ein deutlich
abgesetzter, aber unregelmässiger heller Saum die dunkle Innenmasse, — genau so, wie in der
normalen Entwickelung der dotterreiche Komplex der inneren Organanlagen rückwärts vom
„sekundären Ektoderm“ umkleidet wird. Das ansehnliche, au f den vorderen Bereich des Körpers
beschränkte Blastocoel wa r leer. Und so würde denn die Ähnlichkeit des Ganzen mit einem
Riesen vom I. Typ us eine weitgehende gewesen sein, wenn eben nicht inbezug au f die G r ö s s e
zwischen dem doppelwertigen hinteren Abschnitte des Körpers und der ektodermalen Blase
ein so handgreifliches Missverhältnis bestanden hätte.
Dieser sechzehnte T a g war, wie ich schon erwähnt habe, der T odestag meines Dreifachriesen.
Ich hatte im Aussehen seiner Zellsubstanz mir nur zu wohl bekannte Anzeichen
einer beginnenden Degeneration bemerkt und entschloss mich, ehe grösserer Schaden entstehen
mochte, ihn unverweilt zu konservieren und zu färben. Wirklich war das Präparat, das ich
erhielt, soweit die feinere Struktur des Chromatins -— besonders auch der Richtungskörper —
in F ra g e kam, nicht mehr tadelfrei. A b e r die Zellgrenzen traten vollkommen scha rf hervor,
und da auch die Form der Kerne und die Plasmabeschaffenheit offenbar kaum gelitten
hatten, so w a r das gefärbte Objekt immerhin geeignet, au f die vorausgegangenen Entwickelungsprozesse
so viel Licht zu werfen, als man bei einer derartig monströsen Bildung
erwarten darf.
An dem seltsamen Gebilde (Tafel V , F ig. 62 und 63; Fig. 64 stellt einen stärker ver-
grösserten optischen Durchschnitt dar) fällt zunächst die e k t o d e rm a l e B l a s e ins A uge ; sie
ist tiefrot gefärbt, einschichtig und sitzt mit ihrer weiten Öffnung gleich einer hohen, etwas
schiefgezogenen Mütze über dem Vorderende der kompakten Leibesmasse. Wie aus der
Beschaffenheit der Kerne hervorgeht, befindet sich das Ektoderm in einer Ruheperiode, und
da die Zahl seiner Zellen sicher sehr viel mehr als 64 beträgt, so ist anzunehmen, dass der
gesamte Familienbestand au f 128 Glieder gekommen war. Die Grenze des Ektoderms w a r
gegen den Rumpf hin nicht überall scha rf markiert; sondern stellenweise schien die dunkle,
aus rundlichen Elementen erbaute Epithelschicht kontinuierlich in eine superfizielle L a g e flacherer
und hellerer Zellen überzugehen. Es liegt darin nichts programmwidriges; denn, wie die Arbeit
von H. M ü l le r zeigen wird, ist in der T ha t das primäre Ektoderm älterer Embryonen in analoger
W e ise an der Bildung der hellen Oberflächenschicht beteiligt.
Gleichsam den Kern des walzenförmigen Rumpfabschnittes bildete ein A g g re g a t von
sechzehn ziemlich grossen Furchungszellen (Fig. 64, E), das ringsum von kleineren und meist
auch flacheren Elementen schalenartig überzogen wurde, an einer beschränkten Stelle jedoch
unbedeckt zu T a g e trat. Es war leicht, in dieser Gruppe von Blastomeren mit ihrer kaum
gefärbten, eigentümlich homogenen Plasmasubstanz, den relativ kleinen Kernen, ferner nach
ihrer ganzen L a g e und dem Umstande, dass eben diese Zellen bei Lebzeiten des Embryo bis
zuletzt mit dunklem Dotter beladen waren, das E n to d e rm zu erkennen. Auffallend wa r nur
die grosse Zahl dieser Zellen. Normalerweise beträgt au f einem Stadium, das dem unsrigen
entspricht, die Zahl der Darmzellen nicht sechzehn, sondern nur acht, und geht erst zu einer
v iel späteren Zeit zur sechzehnzeiligen Stufe über. Wenn man aber, um das Plus zu erklären,
e twa eine verfrühte Klüftung bei unserem Riesen annehmen wollte, so liesse das wiederum die
G r ö s s e der Zellen nicht zu. Denn jede von den sechzehn Zellen besass einen Umfang, wie
er, mit dem Ektoderm verglichen, au f der achtzelligen Stufe für sie passend gewesen wäre.
S o la g es denn au f der Hand, dass unser Embryo in der T ha t mit einem doppelten Bestände
von Darmzellen gesegnet war, — entsprechend der doppelten Abstammung des seinen Rumpf
bildenden Z e llm a te ria ls .Und b e id e P o r t io n e n v o n E n to d e rm h a t te n s ic h zu e in em e in h
e i t l i c h e n K om p le x , e in e r e in z ig e n D a rm a n la g e z u s am m e n g e s c h lo s s e n .
Dort, wo der Rand der ektodermalen B lase sich an die H auptmasse des Körpers schmiegte,
la g in der Tiefe ein Nest von einigen dreissig dunkleren Zellen, zum Teil zwischen den Darm
und seine Umhüllung eingezwängt, zum Teil bildeten sie mit abgerundeten Oberflächen, nach A r t
eines holperigen Pflasters, den Boden der Furchungshöhle. Von dieser Abteilung fiel eine