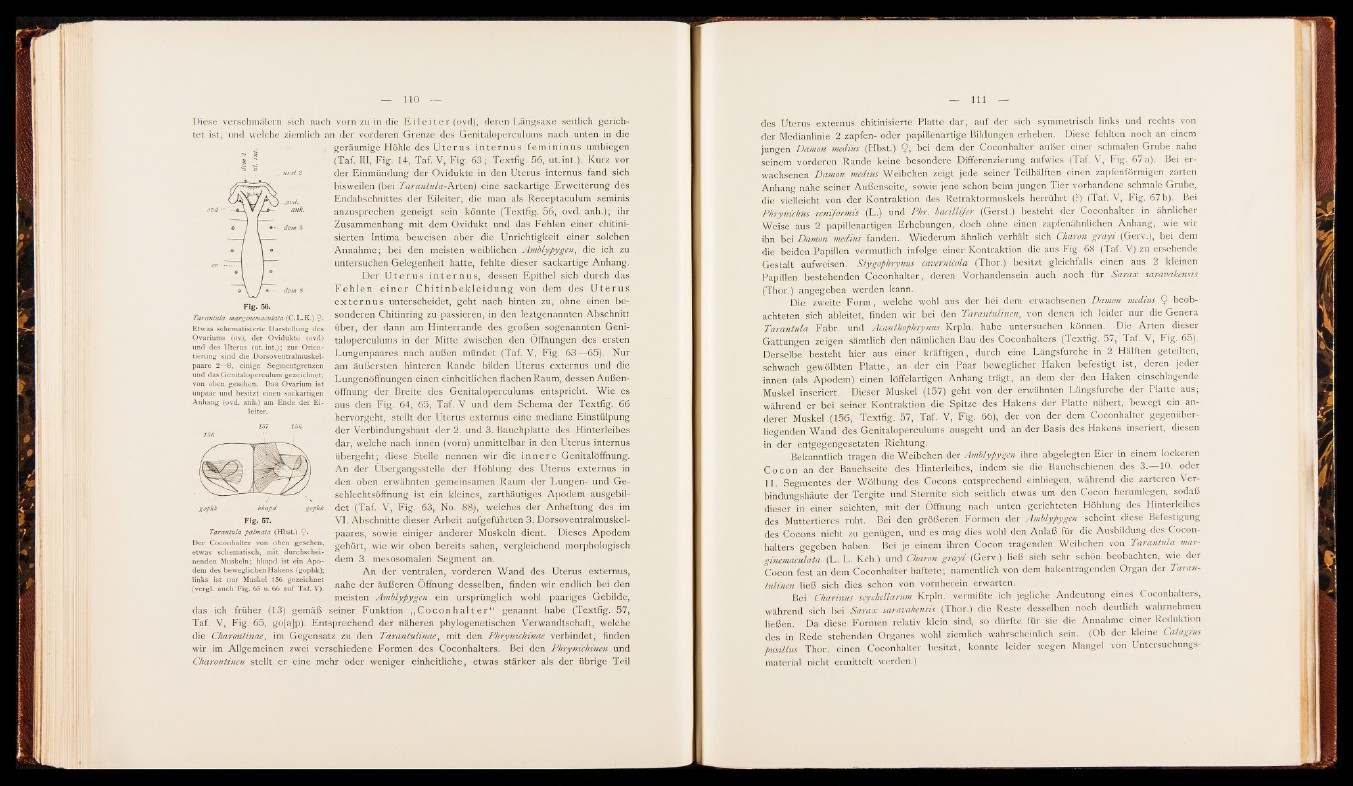
Diese verschmälern sich nach vorn zu in die E i l e i t e r (ovd), deren Längsaxe seitlich gerichtet
ist, und welche ziemlich an der vorderen Grenze des Genitaloperculums nach unten in die
. ^ ) geräumige Höhle des U t e r u s in t e r n u s f em in in u s umbiegen
| ^ (Taf. III, Fig. 14, Taf. V , Fig. 6 3 ; Textfig. 56, ut. int.). Kurz vor
^ * , urst 2 der Einmündung der Ovidukte in den Uterus internus fand sich
bisweilen (bei Tarantula-Arten) eine sackartige Erweiterung des
Endabschnittes der Eileiter, die man als Receptaculum seminis
anzusprechen geneigt sein könnte (Textfig. 56, ovd. anh.); ihr
Zusammenhang mit dem Ovidukt und das Fehlen einer chitini-
sierten Intima beweisen aber die Unrichtigkeit einer solchen
Annahme; bei den meisten weiblichen Amblypygen, die ich zu
untersuchen Gelegenheit hatte, fehlte dieser sackartige Anhang.
Der U t e r u s in t e r n u s , dessen Epithel sich durch das
F e h l e n e in e r C h i t i n b e k l e i d u n g von dem des U t e r u s
e x t e r n u s unterscheidet, geht nach hinten zu, ohne einen b e sonderen
Chitinring zu passieren, in den leztgenannten Abschnitt
über, der dann am Hinterrande des, großen sogenannten Genitaloperculums
in der Mitte zwischen den Öffnungen des ersten
Lungenpaares nach außen mündet (Taf. V , F ig. 63— 65). Nur
am äußersten hinteren Rande bilden Uterus externus und die
Lungenöffnungen einen einheitlichen flachen Raum, dessen A ußenöffnung
der Breite des Genitaloperculums entspricht. W ie es
aus den Fig. 64, 65, Taf. V und dem Schema der Textfig. 66
hervorgeht, stellt der Uterus externus eine mediane Einstülpung
der Verbindungshaut der 2. und 3. Bauchplatte des Hinterleibes
dar, welche nach innen (vorn) unmittelbar in den Uterus internus
übergeht; diese Stelle nennen wir die in n e r e Genitalöffnung.
A n der Übergangsstelle der Höhlung des Uterus externus in
den oben erwähnten gemeinsamen Raum der Lungen- und G e schlechtsöffnung
ist ein kleines, zarthäutiges Apodem ausgebildet
(Taf. V, Fig. 63, No. 88), welches der Anheftung des im
VI. Abschnitte dieser A rbeit aufgeführten 3. Dorsoventralmuskel-
paares, sowie einiger anderer Muskeln dient. Dieses Apodem
gehört, wie wir oben bereits sahen, vergleichend morphologisch
dem 3. mesosomalen Segment an.
A n der ventralen, vorderen Wand des Uterus externus,
nahe der äußeren Öffnung desselben, finden wir endlich bei den
meisten Amblypygen ein ursprünglich wohl paariges Gebilde,
dvrn 8
Fig. 56.
Tarantula marginemaculata (C. L. K.) $.
Etwas schematisierte Darstellung des
Ovariums (ov), der Ovidukte (ovd)
und des Uterus (ut. int.); zur Orientierung
sind die Dorsoventralmuskel-
paare 2— 8, einige Segmentgrenzen
und das Genitaloperculum gezeichnet;
von oben gesehen. Das Ovarium ist
unpaar und besitzt einen sackartigen
Anhang (ovd. anh.) am Ende der Eileiter.
157 156
gophk hkapd gophk
Fig. 57.
Tarantula palmata (Hbst.) $.
Der Coconhalter von oben gesehen,
etwas schematisch, mit durchscheinenden
Muskeln; hkapd ist ein Apodem
des beweglichen Hakens (gophk);
links ist nur Muskel 156 gezeichnet
(vergl. auch Fig. 65 u. 66 auf Taf. V).
das ich früher (13) gemäß seiner Funktion „ C o c o n h a l t e r “ genannt habe (Textfig. 57,
Ta f. V, F ig. 65, go[a]p). Entsprechend der näheren phylogenetischen Verwandtschaft, welche
die Charontinae, im Gegensatz zu den Tarantulinae, mit den Phrynichinae verbindet, finden
wir im Allgemeinen zwei verschiedene Formen des Coconhalters. Bei den Phrynichinen und
Charontinen stellt er eine mehr oder weniger einheitliche, etwas stärker als der übrige Teil
des Uterus externus éhitìnisiferté Platte dar, auf der sich symmetrisch links und rechts von
der Medianlinie 2 zapfen- oder papillenartige Bildungen erheben. Diese fehlten noch an einem
jungen Dämon dem der Ö e o iih a lte r außer einer schmalen Grube nahe
seinem vorderen Rande keine besondere Differenzierung aufwies (Taf. V, Fig. 67 a). Bei erwachsenen
Dämon miclÈi, Weibchen %èigt Jede seiner T e ilh ä lftenK n en zapfenförmigen zarten
Anhang nahe seiner A u ß e S s j^ iÄ i if wie jene Schon beim jungen Tiéìdvorhandene schmale Grube,
die vielleicht von der Kontraktion d | | Retraktormusfcels herrührt ||f (Taf; V, Fig. 67 b). Bei
Phrynicfi&s: renifomiäi.'(L.) und Phr baciUfper (Gerat ) ' besteht der Coconhalter in ähnlicher
W é iB aus 2 papillenartägeh Erhebungen, doch ohne e inenÄp fenähnlichen Anhang, wie wir
ihn beiWamon meäüW fasrf&k Wiederum ähnlich verhält sich Charon grayi (Gerv.), bei dem
die beiden Papillen vermutlich infolge einer Kontraktion die aus Fig. 68 (Taf. V) zu ersehende
Gestalt aufweisen. Stygophrynus cavernìcola. (Thor.) besitzt gleichfalls einen aus 2 kleinen
Papillen bestehenden Coconhalter, deren Vorhandensein auch noch für $arax saravakensis
(Thor.) angegeben werden kann.
Die zweite F o rm , welche wohl aus d6r bäi dem erwaéhjpien Dämon medius Sg beobachteten
rsich abloitet-, finden wir bei den Taranlulinen. von denen ic lt leider nur die Genera
tiiranlula Fabr. um! AcanthopkrynUS Krpln. haifegi-untersuchen können. D ie /A r ten dieser
Gattungen zeigen sämtlich den nämlichen Bau des (liocor.haltb^fjffcxtfigSóV, Taf. V, Fig. 65).
D e r s e ljS 'b e s te h t hier aus einer kräftigen, durch eine Dängsfürche in 2. Hälften geteilten,
s c h w a c h feeWölbten S t a t t e , an "der ein Pààr|fp|veglichdt7;Hakdffl befestigt, is t , deren jeder
i n n e h ( (S Ì Apodem) einen loffeìartigetì Anhang trägt, an dem der den Haken jeinschlagende
Muskel inseriert. Dieser Muskel (157) geht von der erwähnten Längsfurche der Platte aus;
während er bei seiner Kontraktion die Spitze des Hakens der Platte nähert, bewegt ein anderer
Muskel (156( T ex tfig .1 &?,( Taf. V , Fig.;;t§6.)i d e r von der dem Coconhalter gegenüberliegenden
Wand des Genitato|éf»jilums ausgeht und an der Basis des Hakens inseriert, diesen
in der entgegengesetzten Richtung.
Bekanntlich tragen die Weibchen der Amblypygen ihre abgelegten Eier in einem lockeren
an der Bauchseite des Hinterleibes, in d em g le die Bauchsehienen d f g g B lO . oder
1 1 . Segmentes der Wölbung d e f Apobons entsprechend einbiegen, während die zarteren Verbindungshäute
der Terg ite und Sternite 'sich seitlich etwas um den (||fäin herumlegbn, sodäß
dieljS in einer seichten, mit d e r g f ffnung nach untOn gerichteten Kohlung des Hinterleibes
des Muttertieresl-ruht. Bei den größeren Formen d®r Amblypygen scheint diese Befestigung
des Cocons nicht zu genügen, und es mag dies wohl den A nlaß für die Ausbildung des Coconhalters
gegeben haben. Bei je einem ihren Cocon tragenden Weibchen von Tarantula marginemaculata
(L. L . Kch.) und Charon grayi (Gerv.) ließ sich sehr schön beobachten, wie der
Cocon fest an dem Coconhalter haftete; namentlich von dem hakenträgenden Organ der Taran-
tulinen lie ß sich dies schon von vornherein erwarten.
Bei Charinus seychellarum Krpln. vermißte ich jegliche Andeutung eines Coconhalters,
während sich bei Sarax saravakensis (Thor.) die Reste desselben noch deutlich wahrnehmen
ließen. Da diese Formen relativ klein sind, so dürfte für sie die Annahme einer Reduktion
des in Rede stehenden Organes wohl ziemlich wahrscheinlich sein. (Ob der kleine Catagvus
pusillus Thor, einen Coconhalter besitzt, konnte leider wegen Mangel von Untersuchungs-
material nicht ermittelt werden.)