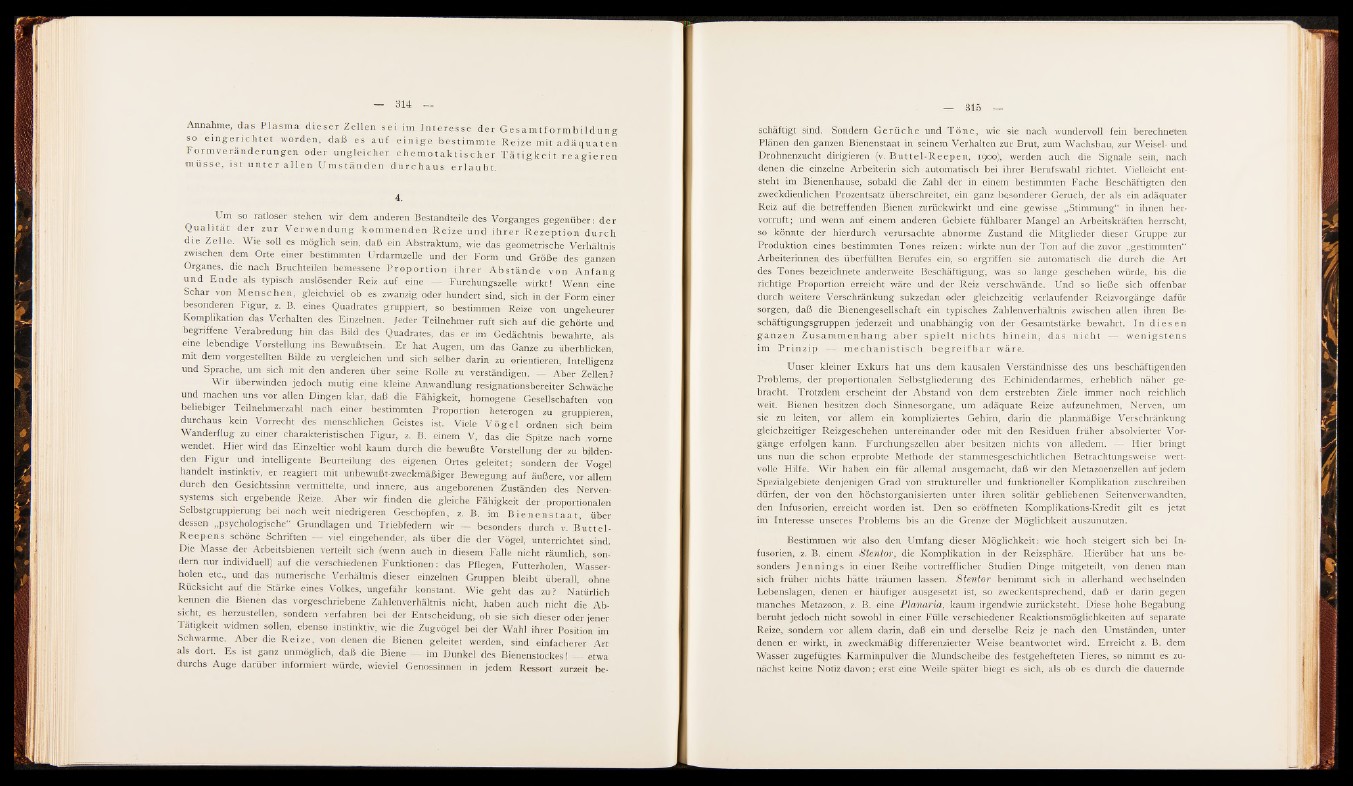
G e s a m t f o r m b i l d u n g
R e i z e m it a d ä q u a t e n
T ä t i g k e i t r e a g i e r e n
d a s P la s jm a d i e s e r Z e l le n s e i im I n t e r e s s e d e r
s o e i n g e r i c h t e t w o rd e n , d a ß e s a u f e i n i g e b e s t im m t e
F o rm v e r ä n d e r u n g e n o d e r u n g le i c h e r c h e m o t a . k t i s c h e r
m ü s s e , i s t u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n d u r c h a u s e r l a u b t .
4.
Um s o ; ratloser stehen wir dem anderen Bestandteile des Vorganges gegenüber: d e r
Q u a l i t ä t d e r z u r V e r w e n d u n g k om m e n d e n R e i z e u n d ih r e r R e z e p t i o n d u r c h
d ie Z e l le . W ie soll i S möglich sein, daß ein Abstraktum, wie das geometrische V e rh a itjis
zwischen dem Orte . einer bestimmten Urdarmzelle und der Form und -Größe des ganzen
Organes, die nach Bruchteilen bemesséne P r o p o r t i o n ih r e r A b s t ä n d % v o n A n f a n g
u n d E n d e als typisch auslösender Reiz auf eine — Furchungszelle wirkt! Wenn eine
Schar von M e n sÄ h e n ,- gleichviel ob; es zwanzig oder hundert sind, sieh in der Form einer
besonderen Figur, z. B. eines Quadrates gruppiert, so bestimmen Reize von ungeheurer
Komplikation das Verhalten des Einzelnen. Jeder Teilnehmer ruft sieh auf die: gehörte unfr
begriffene Verabredung hin das Bild de* Quadrates; das er im Gedächtnis betvahrté, ate
eine lebendige Vorstellung ins Bewußtsein. E r hat Augen, um das. Ganze zu Überblicken,
mit dem vorgestellten Bilde, zu vergleichen und sich selber darin zu oribitieien;; Intelligenz
und Sprache, um sich mit den anderen überls^ine Rollé zu verständigen. § B fV b e r Zellen:!
W ir überwinden jedoch mutig eine kleine Anwandlung resignationsbereiter Schwäche
und machen uns vor allen Dingen klar, daß die Fähigkeit, homogene Gesellschaften von
beliebiger Teilnehmerzahl nach einer bestimmten Proportion heterogen zu gruppieren,
durchaus kein Vorrecht des menschlichen Geistes ist. Viele V ö g e l ordnen ^sh beim
Wander flug zu eine*.¡charakteristischen F ig a g g f e B . einem V,' das die Spitze nach ,vorne
wendet. Hier wird das Einzeltier wohl kaum durch die bewußte Vorstellung der zu bildenden
Figur und intelligente Beurteilung des eigenen O r t e s . ge le ite t;. sondern der. Vogel
handelt instinktiv, er reagiert mit unbewußt-zweckmäßiger Bewegung auf äußere, vor allem
durch den Gesichtssinn vermittelte, und innere, aus angeborenen Zuständen des Nervensystems
sich ergebende Reize. Aber* wir finden die gl'siehe Fähigkeit der .proportionalen
Selbstgruppierung bei noch weit niedrigeren Geschöpfen, z. B., ’jm B i e n e n s t a a t , über
dessen „psychologische“ "Grundlagen und. Triebfedern wir <— besonders durch v. B u t t e l -
Reepen®. schöne Schritten -H v ie l eingehender, als über die der Vögel, unterrichtet sind.
Die Masse der Arbeitsbiene® verteilt' sich (wenn auch in diesem Falle nicht räumlich, sondern
nur individuell) auf die verschiedenen Funktionen : das Pflegen, Futterholen, Wasserholen
e t | g u n d das numerische Verhältnis dieser einzelnen Gruppen bleibt überall, ohne
Rücksicht auf die Stärke eines Volkes, ungefähr konstant. W ie geht das¡ ;zu? Natürlich
kennen die Bienen das vorgeschriebene Zahlenverhältnis nicht, haben auch nicht die A b sicht,
es:; herzustellen, sondern verfahren bei der Entscheidung, ob sie sieh dieser oder jener
Tätigkeit widmen sollen, ebenso instinktiv, wie die Zugvögel bei der Wahl ihrer Position im
Schwarme. A b e r die R e i z e , von denen die Bienen, geleitet werden, sind einfacherer Art
als dort. E s ist ganz unmöglich, daß die Biene — im Dunkel des B ie n e n s to c k e s» * etwa
durchs A uge darüber informiert würde, wieviel Genossinnen in jedem Ressort zurzeit beAnnahme,
schäftigt sind. Sondern G e r ü c h e und T ö n e , wie sie nach wundervoll fein berechneten
Plänen den ganzen Bienenstaat in seinem Verhalten zur Brut, zum Wachsbau, zur Weisel- und
Drohnenzucht dirigieren (v. B u t t e l -R e e p e n , 1900), werden auch die Signale sein, nach
denen die einzelne Arbeiterin sich automatisch bei ihrer Berufswahl richtet. Vielleicht entsteht
im Bienenhause, sobald die Zahl der in einem bestimmten Fache Beschäftigten den
zweckdienlichen Prozentsatz überschreitet, ein ganz besonderer Geruch, der als ein adäquater
Reiz auf die betreffenden Bienen zurückwirkt und eine gewisse „Stimmung“ in ihnen hervorruft;
und wenn auf einem anderen Gebiete fühlbarer Mangel an Arbeitskräften herrscht,
so könnte der hierdurch verursachte abnorme Zustand die Mitglieder dieser Gruppe zur
Produktion eines bestimmten Tones reizen: wirkte nun der Ton auf die zuvor „gestimmten“
Arbeiterinnen des überfüllten Berufes ein, so ergriffen sie automatisch die durch die Art
des Tones bezeichnete anderweite Beschäftigung, was so lange geschehen würde, bis die
richtige Proportion erreicht wäre und der Reiz verschwände. Und so ließe sich offenbar
durch weitere Verschränkung sukzedan oder gleichzeitig verlaufender Reizvorgänge dafür
sorgen, daß die Bienengesellschaft ein typisches Zahlenverhältnis zwischen allen ihren Beschäftigungsgruppen
jederzeit und unabhängig von der Gesamtstärke bewahrt. In d i e s e n
g a n z e n Z u s am m e n h a n g a b e r s p i e l t n i c h t s h in e in , d a s n i c h t — w e n i g s t e n s
im P r i n z i p | ^ ^ m e c h a n i s t i s c h b e g r e i f b a r w ä r e .
Unser kleiner Exkurs hat uns dem kausalen Verständnisse des uns beschäftigenden
Problems, der proportionalen Selbstgliederung des Echinidendarmesy erheblich näher ge bracht.
Trotzdem erscheint der Abstand von dem erstrebten Ziele immer noch reichlich
weit. Bienen besitzen doch Sinnesorgane, um adäquate Reize aufzunehmen, Nerven, um
sie zu leiten, vor allem ein kompliziertes Gehirn, darin die planmäßige Verschränkung
gleichzeitiger Reizgeschehen untereinander oder mit den Residuen früher absolvierter V o r gänge
erfolgen kann. Furchungszellen aber besitzen nichts von alledem. — Hier bringt
uns nun die schon erprobte Methode der stammesgeschichtlichen Betrachtungsweise wertvolle
Hilfe. Wir haben ein für allemal ausgemacht, daß wir den Metazoenzellen auf jedem
Spezialgebiete denjenigen Grad von struktureller und funktioneller Komplikation zuschreiben
dürfen, der von den höchstorganisierten unter ihren solitär gebliebenen Seitenverwandten,
den Infusorien, erreicht worden ist. Den so eröffneten Komplikations-Kredit gilt es jetzt
im' Interesse unseres Problems bis an die Grenze der Möglichkeit auszunutzen.
Bestimmen wir also den Umfang dieser Möglichkeit: wie hoch steigert sich bei Infusorien,
z. B. einem Stentor, die Komplikation in der Reizsphäre. Hierüber hat uns besonders
J e n n in g s in einer Reihe vortrefflicher Studien Dinge mitgeteilt, von denen man
sich früher nichts hätte träumen lassen. Stentor benimmt sich in allerhand wechselnden
Lebenslagen, denen er häufiger ausgesetzt ist, so zweckentsprechend, daß er darin gegen,
manches Metazoon, z. B. eine Planaria, kaum irgendwie zurücksteht. Diese hohe Begabung
beruht jedoch nicht sowohl in einer Fülle verschiedener Reaktionsmöglichkeiten auf separate
Reize, sondern vor allem darin, daß ein und derselbe Reiz je nach den Umständen, unter
denen er wirkt, in zweckmäßig differenzierter Weise beantwortet wird. Erreicht z. B. dem
Wasser zugefügtes Karminpulver die Mundscheibe des festgehefteten Tieres, so nimmt es zunächst
keine Notiz davon; erst eine Weile später biegt es sich, als ob es durch die dauernde