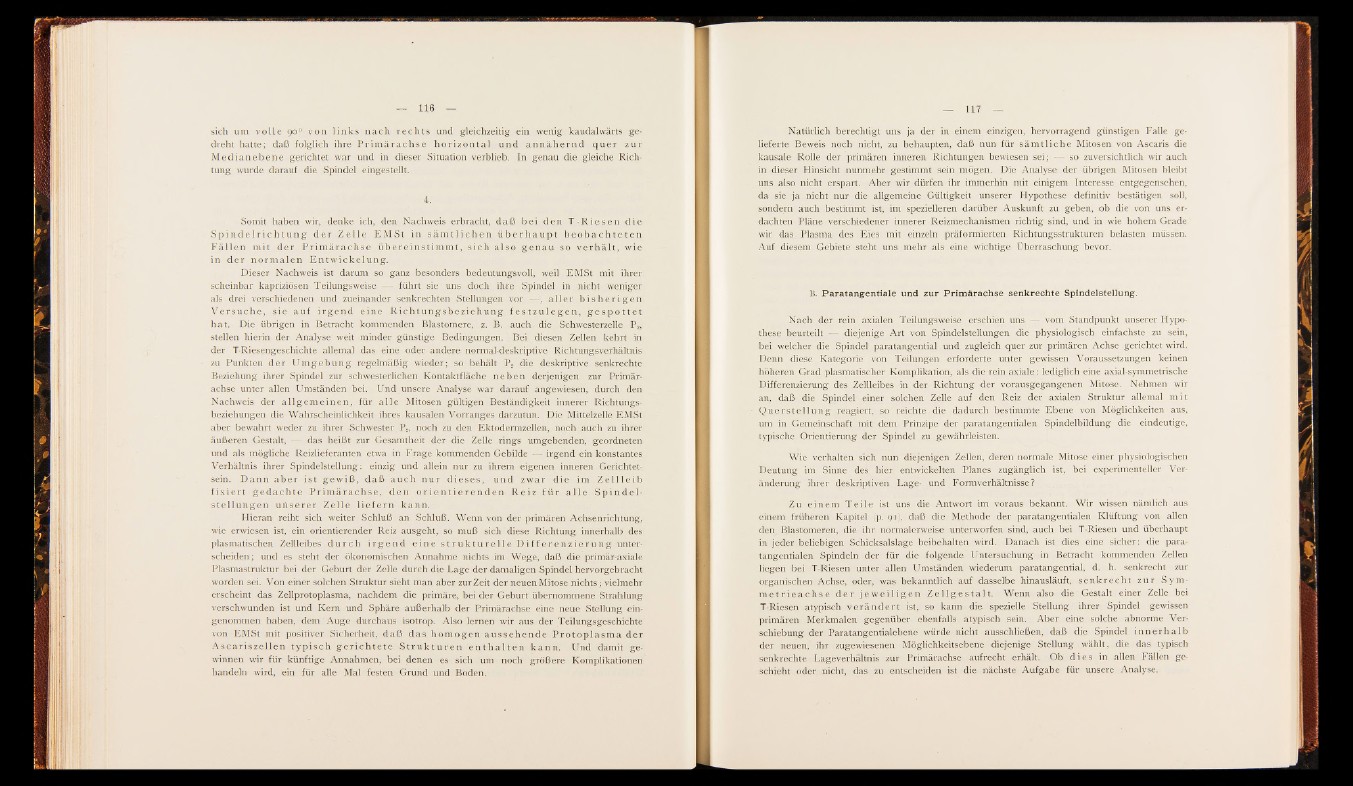
sich um v o l l e 900 v o n l in k s 'n a c h r e c h t s und gleichzeitig ein wenig kaudalwärts g e dreht
hatte; daß folglich ihre P r im ä r a c h s e h o r i z o n t a l u n d a n n ä h e r n d q u e r z u r
M e d ia n e b e n e gerichtet war und in dieser Situation verblieb. In genau die gleiche Richtung
wurde darauf die Spindel eingestellt.
4.
Somit haben wir, denke ich) den Nachweis erbracht, d a ß b e i d e n T - R i e s e n d i e
S p i n d e l r i c h t u n g d e r Z e l l e E M S t in s ä m t l i c h e n ü b e r h a u p t b e o b a c h t e t e n
F ä l l e n m it d e r P r im ä r a c h s e ü b e r e in s t im m t , s i c h a l s o g e n a u so v e r h ä l t , w ie
in d e r n o rm a le n E n tw i c k e lu n g .
Dieser Nachweis ist darum so ganz besonders bedeutungsvoll, weil EM St mit ihrer
scheinbar kapriziösen Teilungsweise — führt sie uns doch ihre Spindel in nicht weniger
als drei verschiedenen und zueinander senkrechten Stellungen vor — , a l l e r b i s h e r i g e n
V e r s u c h e , s i e a u f i r g e n d e in e R i c h t u n g s b e z i e h u n g f e s t z u l e g e n , g e s p o t t e t
h a t . Die übrigen in Betracht kommenden Blastomere, z. B. auch, die Schwesterzelle P2,
stellen hierin der Analyse weit minder günstige Bedingungen. Bei diesen Zellen kehrt in
der T-Riesengeschichte allemal das eine oder andere normal-deskriptive Richtungsverhältnis
zu Punkten d e r U m g e b u n g regelmäßig wieder; so behält P2 die deskriptive senkrechte
Beziehung ihrer Spindel zur schwesterlichen Kontaktfläche n e b e n derjenigen zur Primärachse
unter allen Umständen bei. Und unsere Analyse war darauf angewiesen, durch den
Nachweis der a l l g e m e in e n , für a l l e Mitosen gültigen Beständigkeit innerer Richtungsbeziehungen
die Wahrscheinlichkeit ihres kausalen Vorranges darzutun. Die Mittelzelle EM St
aber bewahrt weder zu ihrer Schwester P2, noch zu den Ektodermzellen, noch auch zu ihrer
äußeren Gestalt, — das heißt zur Gesamtheit der die Zelle rings umgebenden, geordneten
und als mögliche Reizlieferanten etwa in Fra ge kommenden Gebilde — irgend ein konstantes
Verhältnis ihrer Spindelstellung: einzig und allein nur zu ihrem eigenen inneren Gerichtetsein.
D a n n a b e r i s t g e w i ß , d a ß a u c h n u r d i e s e s , u n d zw a r d ie im Z e l lM e ib
f i x i e r t g e d a c h t e P r im ä r a c h s e , d e n o r i e n t i e r e n d e n R e i z f ü r a l l e S p i n d e f e
S t e l lu n g e n u n s e r e r . Z e l l e l i e f e r n k a n n .
Hieran reiht sich weiter Schluß an Schluß. Wenn von der primären Achsenrichtung,
wie erwiesen ist, ein orientierender Reiz ausgeht, so muß sich diese Richtung innerhalb des
plasmatischen Zellleibes d u r c h i r g e n d e in e s t r u k t u r e l l e D i f f e r e n z i e r u n g unterscheiden;
und es steht der ökonomischen Annahme nichts im Wege , daß die primär-axiale
Plasmastruktur bei der Geburt der Zelle durch die L a ge der damaligen Spindel hervorgebracht
worden sei. Von einer solchen Struktur sieht man aber zurZeit der neuen Mitose nichts; vielmehr
erscheint das Zellprotoplasma, nachdem die primäre, bei der Geburt übernommene Strahlung
verschwunden ist und Kern und Sphäre außerhalb der Primärachse eine neue Stellung eingenommen
haben, dem A u g e durchaus isotrop. Also lernen wir aus der Teilungsgeschichte
von EM St mit positiver Sicherheit, d a ß d a s h om o g e n a u s s e h e n d e P r o t o p l a sm a d e r
A s c a r i s z e l l e n t y p i s c h g e r i c h t e t e S t r u k t u r e n e n t h a l t e n k a n n . Und damit ge winnen
wir für künftige Annahmen, bei denen es sich um noch größere Komplikationen
handeln wird, ein für alle Mal festen Grund und Boden.
Natürlich berechtigt uns ja der in einem einzigen, hervorragend günstigen Falle gelieferte
Beweis noch nicht, zu behaupten, daß nun für s ä m t l i c h e Mitosen von Ascaris die
kausale Rolle der primären inneren Richtungen bewiesen sei; — so zuversichtlich wir auch
in dieser Hinsicht nunmehr gestimmt sein mögen. Die Analyse der übrigen Mitosen bleibt
uns also nicht erspart. A ber wir dürfen ihr immerhin mit einigem Interesse entgegensehen,
dä sie ja nicht nur die allgemeine Gültigkeit unserer Hypothese definitiv bestätigen soll,
sondern auch bestimmt ist, im spezielleren darüber Auskunft zu geben, ob die von uns erdachten
Pläne verschiedener innerer Reizmechanismen richtig sind, und in wie hohem Grade
wir das Plasma des Eies mit einzeln präformierten Richtungsstrukturen belasten müssen.
A u f diesem Gebiete steht uns mehr als eine wichtige Überraschung bevor.
B. Paratangentiale und zur Primärachse senkrechte Spindelstellung.
Nach der rein axialen Teilungsweise erschien uns — vom Standpunkt unserer Hypothese
beurteilt — diejenige A r t von Spindelstellungen die physiologisch einfachste zu sein,
bei welcher die Spindel paratangential und zugleich quer zur primären Achse gerichtet wird.
Denn diese Kategorie von Teilungen erforderte unter gewissen Voraussetzungen keinen
höheren Grad plasmatischer Komplikation) als die rein a x ia le : lediglich eine axial-symmetrische
Differenzierung des Zellleibes in der Richtung der vorausgegangenen Mitose. Nehmen wir
an, daß die Spindel einer solchen Zelle auf den Reiz der axialen Struktur allemal m i t
Q u e r S t e l lu n g reagiert, so reichte die . dadurch bestimmte Ebene von Möglichkeiten aus,
um in Gemeinschaft mit dem Prinzipe der paratangentialen Spindelbildung die eindeutige,
typische Orientierung der Spindel zu gewährleisten.
Wie verhalten, sich nun diejenigen Zellen, deren normale Mitose einer physiologischen
Deutung ini Sinne -des hier entwickelten Planes zugänglich ist, bei experimenteller Ve r änderung
ihrer deskriptiven Lage- und Formverhältnisse?
Z u e in em T e i l e ist uns die Antwort im voraus bekannt. Wir wissen nämlich aus
einem früheren Kapitel (p. 91), daß die Methode der paratangentialen Klüftung von allen
den BJastomeren, die ihr normalerweise unterworfen sind, auch bei T-Riesen und überhaupt
in jeder beliebigen Schicksalslage beibehalten wird. Danach ist dies eine, sicher: die para-
tangentialen Spindeln der für die folgende Untersuchung in Betracht kommenden Zellen
liegen bei T-Riesen unter allen Umständen wiederum paratangential, d. h. senkrecht zur
organischen Achse, oder, was bekanntlich auf dasselbe hinausläuft, s e n k r e c h t z u r S y m m
e t r i e a c h s e d e r j e w e i l i g e n Z e l l g e s t a l t . Wenn also die Gestalt einer Zelle bei
T-Riesen atypisch v e r ä n d e r t ist, so kann die spezielle Stellung ihrer Spindel gewissen
primären Merkmalen gegenüber ebenfalls atypisch sein. A ber eine solche abnorme V e r schiebung
der Paratangentialebene würde nicht ausschließen, daß die Spindel in n e r h a lb
der neuen, ihr zugewiesenen Möglichkeitsebene diejenige Stellung wählt, die das typisch
senkrechte Lageverhältnis zur Primärachse aufrecht erhält. Ob d i e s in allen Fällen ge schieht
oder nicht, das zu entscheiden ist die nächste Aufgabe für unsere Analyse, .