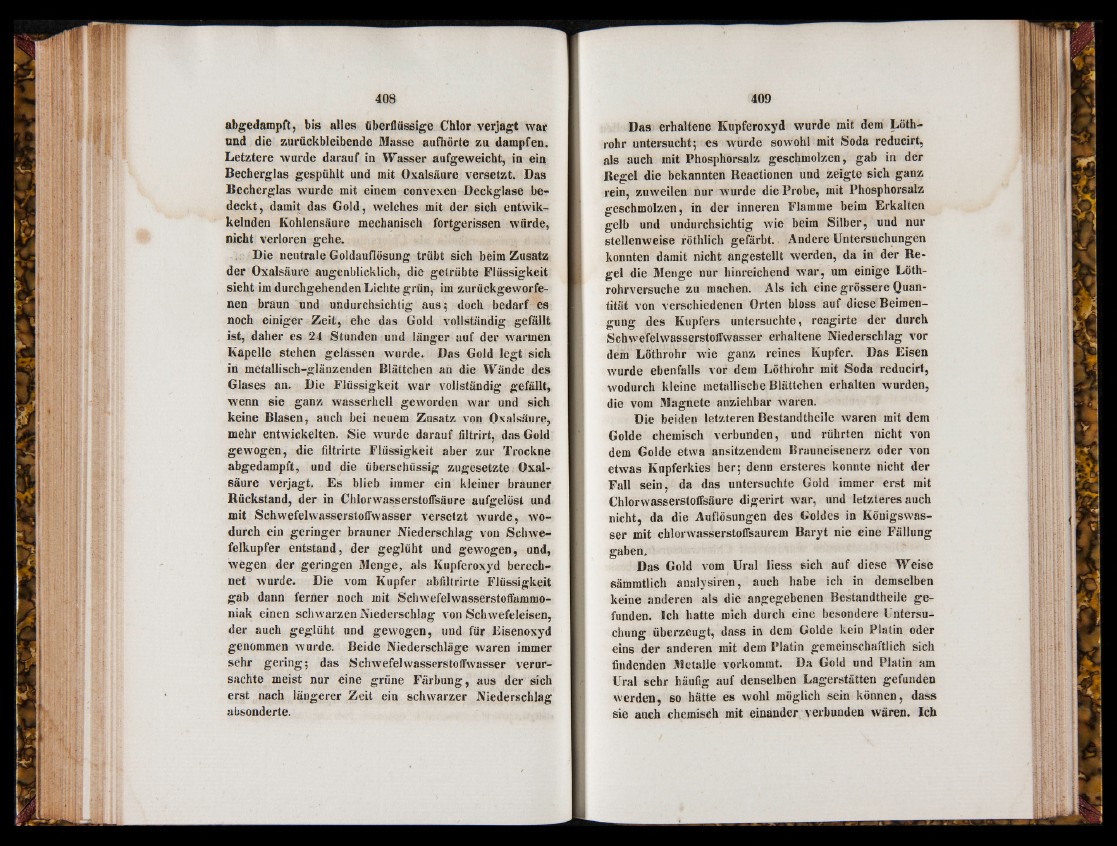
abgedampft, bis alles überflüssige Chlor verjagt war
und die zurückbleibende Masse aufhörte zu dampfen.
Letztere wurde darauf in Wasser aufgeweicht, in ein
Becherglas gespühlt und mit Oxalsäure versetzt. Das
Becherglas wurde mit einem convexen Deckglase bedeckt,
damit das Gold, welches mit der sich entwik-
kelnden Kohlensäure mechanisch fortgerissen würde,
nicht verloren gehe.
Die neutrale Goldauflösung trübt sich beim Zusatz
der Oxalsäure augenblicklich, die getrübte Flüssigkeit
sieht im durchgehenden Lichte grün, im zurückgeworfenen
braun und undurchsichtig aus; doch bedarf es
noch einiger Zeit, ehe das Gold vollständig gefällt
ist, daher es 24 Stunden und länger auf der warmen
Kapelle stehen gelassen wurde. Das Gold legt sich
in metallisch-glänzenden Blättchen an die Wände des
Glases an. Die Flüssigkeit war vollständig gefällt,
wenn sie ganz wasserhell geworden war und sich
keine Blasen, auch bei neuem Zusatz von Oxalsäure,
mehr entwickelten. Sie wurde darauf filtrirt, das Gold
gewogen, die filtrirte Flüssigkeit aber zur Trockne
abgedampft, und die überschüssig zugesetzte Oxalsäure
verjagt. Es blieb immer ein kleiner brauner
Rückstand, der in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst und
mit Schwefelwasserstoffwasser versetzt wurde, wodurch
ein geringer brauner Niederschlag von Schwefelkupfer
entstand, der geglüht und gewogen, und,
wegen der geringen Menge, als Kupferoxyd berechnet
wurde. Die vom Kupfer abfiltrirte Flüssigkeit
gab dann ferner noch mit Schwefelwasserstoffammoniak
einen schwarzen Niederschlag von Schwefeleisen,
der auch geglüht und gewogen, und für Eisenoxyd
genommen wurde. Beide Niederschläge waren immer
sehr gering; das Schwefelwasserstoffwasser verursachte
meist nur eine grüne Färbung, aus der sich
erst nach längerer Zeit ein schwarzer Niederschlag
absonderte.
Das erhaltene Kupferoxyd wurde mit dem Löth-
rohr untersucht; es wurde sowohl mit Soda reducirt,
als auch mit Phosphorsalz geschmolzen, gab in der
Regel die bekannten Reactionen und zeigte sich ganz
rein, zuweilen nur wurde die Probe, mit Phosphorsalz
geschmolzen, in der inneren Flamme beim Erkalten
gelb und undurchsichtig wie beim Silber, und nur
stellenweise röthlich gefärbt.. Andere Untersuchungen
konnten damit nicht angestellt werden, da in der Regel
die Menge nur hinreichend war, um einige Löth-
rohrversuche zu machen. Als ich eine grössere Quantität
von verschiedenen Orten bloss auf diese Beimengung
des Kupfers untersuchte, reagirte der durch
Schwefelwasserstoffwasser erhaltene Niederschlag vor
dem Löthrohr wie ganz reines Kupfer. Das Eisen
wurde ebenfalls vor dem Löthrohr mit Soda reducirt,
wodurch kleine metallische Blättchen erhalten wurden,
die vom Magnete anziehbar waren.
Die beiden letzteren Bestandtheile waren mit dem
Golde chemisch verbunden, und rührten nicht von
dem Golde etwa ansitzendem Brauneisenerz oder von
etwas Kupferkies her; denn ersteres konnte nicht der
Fall sein, da das untersuchte Gold immer erst mit
Chlorwasserstoffsäure digerirt war, und letzteres auch
nicht, da die Auflösungen des Goldes in Königswasser
mit chlorwasserstoffsaurem Baryt nie eine Fällung
gaben.
Das Gold vom Ural iiess sich auf diese Weise
sämmtlich analysiren, auch habe ich in demselben
keine anderen als die angegebenen Bestandtheile g e funden.
Ich hatte mich durch eine besondere Untersuchung
überzeugt, dass in dem Golde kein Platin oder
eins der anderen mit dem Platin gemeinschaftlich sich
findenden Metalle vorkommt. Da Gold und Platin am
Ural sehr häufig auf denselben Lagerstätten gefunden
werden, so hätte es wohl möglich sein können, dass
sie auch chemisch mit einander verbunden wären. Ich