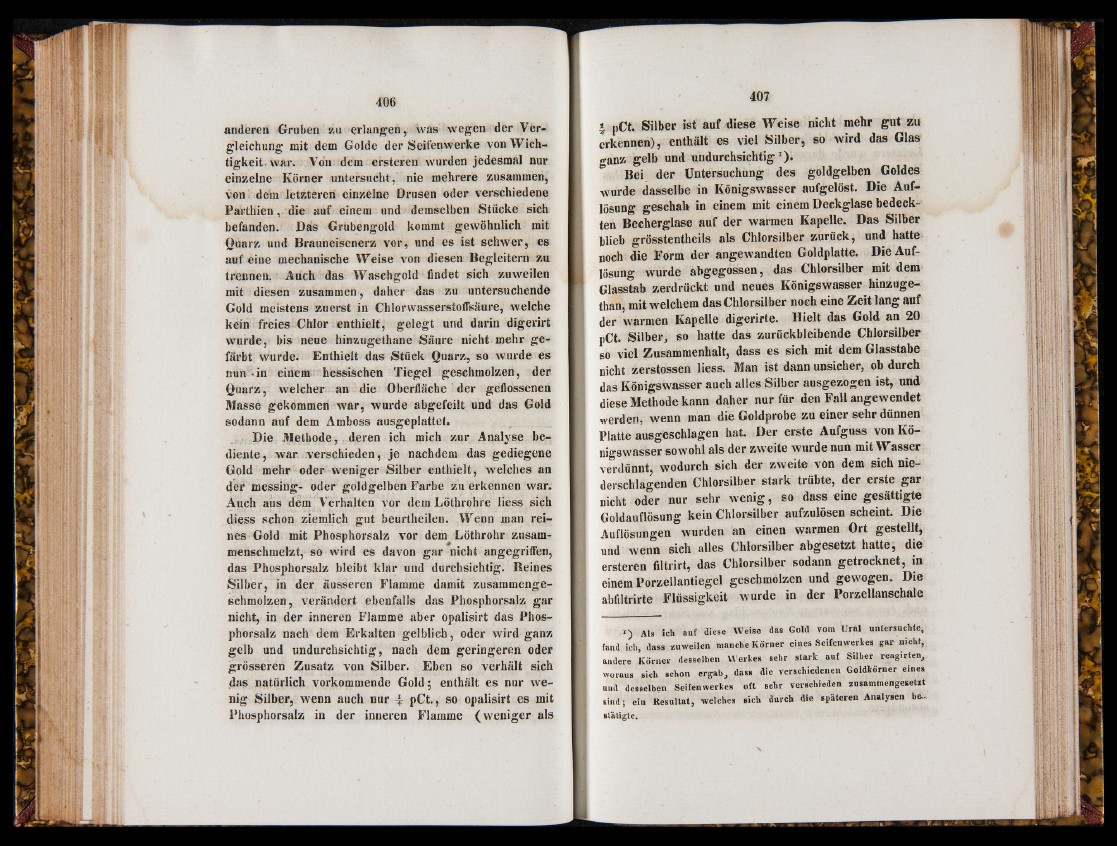
anderen Gruben au erlangen, was wegen der Vergleichung
mit dem Golde der Seilenwerke von Wich-
tigkeit.war. Von dem ersteren wurden jedesmal nur
einzelne Körner untersucht, nie mehrere zusammen,
von dein letzteren einzelne Drusen oder verschiedene
Partbiendie auf einem und demselben Stücke sich
befanden. Das Grubengold kommt gewöhnlich mit
Quarz und Brauneisenerz vor, und es ist schwer, es
auf eine mechanische Weise von diesen Begleitern zu
trennen. Auch das Waschgold findet sich zuweilen
mit diesen zusammen, daher das zu untersuchende
Gold meistens zuerst in Chlorwasserstoffsäure, welche
kein freies Chlor enthielt, gelegt und darin digerirt
wurde, bis neue hinzugethane Säure nicht mehr g e färbt
wurde. Enthielt das Stück Quarz, so wurde es
nun -in einem hessischen Tiegel geschmolzen, der
Quarz, welcher an die Oberfläche der geflossenen
Masse gekommen war, wurde abgefeilt und das Gold
sodann auf dem Amboss ausgeplattet.
Die Methode, deren ich mich zur Analyse bediente,
war. verschieden, je nachdem das gediegene
Gold mehr oder weniger Silber enthielt, welches an
der messing- oder goldgelben Farbe zu erkennen war.
Auch aus dem Verhalten vor dem Löthrohre liess sich
diess schon ziemlich gut beurtheilen. Wenn man reines
Gold mit Phosphorsalz vor dem Löthrohr zusammenschmelzt,
so wird es davon gar nicht angegriffen,
das Phosphorsalz bleibt klar und durchsichtig. Reines
Silber, in der äusseren Flamme damit zusammengeschmolzen,
verändert ebenfalls das Phosphorsalz gar
nicht, in der inneren Flamme aber opalisirt das Phosphorsalz
nach dem Erkalten gelblich, oder wird ganz
gelb und undurchsichtig, nach dem geringeren oder
grösseren Zusatz von Silber. Eben so verhält sich
das natürlich vorkommende Gold; enthält es nur wenig
Silber, wenn auch nur pCt., so opalisirt es mit
Phosphorsalz in der inneren Flamme (weniger als
f* pCt. Silber ist auf diese Weise nicht mehr gut zu
erkennen), enthält es viel Silber, so wird das Glas
ganz gelb und undurchsichtig1).
Bei der Untersuchung des goldgelben Goldes
wurde dasselbe in Königswasser aufgelöst. Die Auflösung
geschah in einem mit einem Deckglase bedeckten
Becherglase auf der warmen Kapelle. Das Silber
blieb grösstentheils als Chlorsilber zurück, und hatte
noch die Form der angewandten Goldplatte. Die Auflösung
wurde abgegossen, das' Chlorsilber mit dem
Glasstab zerdrückt und neues Königswasser hinzuge-
than, mit welchem das Chlorsilber noch eine Zeit lang auf
der warmen Kapelle digerirte. Hielt das Gold an 20
pCt. Silber, so hatte das zurückbleibende Chlorsilber
so viel Zusammenhalt, dass es sich mit dem Glasstabe
nicht zerstossen liess. Man ist dann unsicher, ob durch
das Königswasser auch alles Silber ausgezogen ist, und
diese Methode kann daher nur für den Fall angewendet
werden, wenn man die Goldprobe zu einer sehr dünnen
Platte ausgeschlagen hat. Der erste Aufguss von Königswasser
sowohl als der zweite wurde nun mit Wasser
verdünnt, wodurch sich der zweite von dem sich niederschlagenden
Chlorsilber stark trübte, der erste gar
nicht oder nur sehr w en ig , so dass eine gesättigte
Goldauflösung kein Chlorsilber aufzulösen scheint. Die
Auflösungen wurden an einen warmen Ort gestellt,
und wenn sich alles Chlorsilber abgesetzt hatte, die
ersteren filtrirt, das Chlorsilber sodann getrocknet, in
einem Porzellantiegel geschmolzen und gewogen. Die
abfiltrirte Flüssigkeit wurde in der Porzellanschale
*) Als ich auf diese Weise das Gold vom Ural untersuchte,
fand ich, dass zuweilen manche Körner eines Seifenwerkes g a r nicht,
andere Körner desselben Werkes sehr stark auf Silber reagirten,
woraus sich schon e rg a b , dass die verschiedenen Goldkörner eines
und desselben Seifenwerkes oft sehr verschieden zusammengesetzt
sind; ein R e su lta t, welches sich durch die späteren Analysen bestätigte.