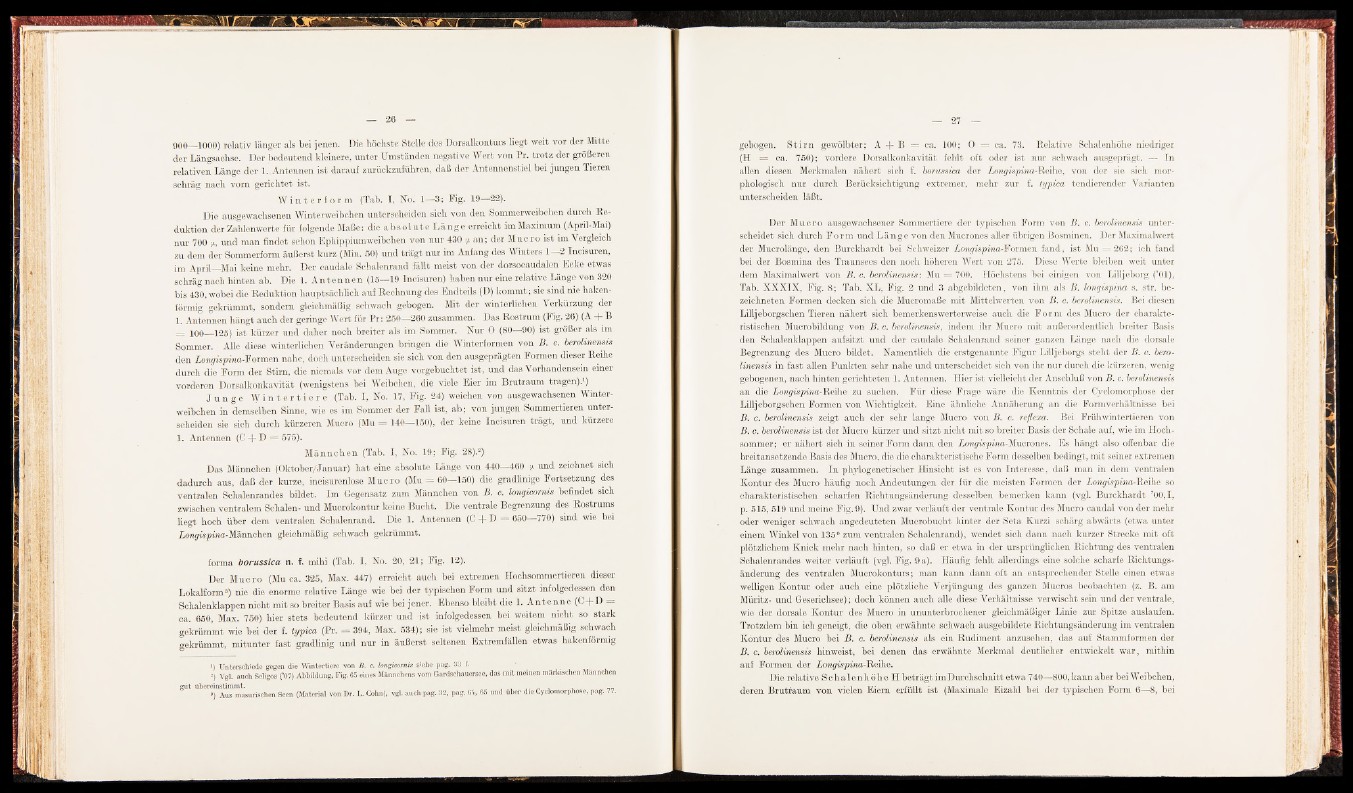
900—1000) relativ länger als bei jenen. Die höchste Stelle des Dorsalkonturs liegt weit vor der Mitte
der Längsachse. Der bedeutend kleinere, unter Umständen negative Wert von Pr. trotz der größeren
relativen Länge der 1.. Antennen ist darauf zurückzuführen, daß der Antennenstiel bei jungen Tieren
schräg nach vorn gerichtet ist.
W i n t e r f o r m (Tab. I, No. 1—3; Fig. 19—22).
Die ausgewachsenen Winterweibchen unterscheiden sich von den Sommerweibchen durch Reduktion
der Zahlenwerte für folgende Maße: die a b s o lu te Länge erreicht im Maximum (April-Mai)
nur 700 p, und man findet schon Ephippiumweibchen von nur 430 p an; der Mucro ist im Vergleich
zu dem der Sommerform äußerst kurz (Min. 50) und trägt nur im Anfang des Winters 1—2 Incisuren,
im April—Mai keine mehr. Der caudale Schalenrand fällt meist von der dorsocaudalen Ecke etwas
schräg nach hinten ab. Die 1. Ant ennen (15—19 Incisuren) haben nur eine relative Länge von 320
bis 430, wobei die Reduktion hauptsächlich auf Rechnung des Endteils (D) kommt; sie sind nie hakenförmig
gekrümmt, sondern gleichmäßig schwach gebogen. Mit der winterlichen Verkürzung der
1. Antennen hängt auch der geringe Wert für Pr: 250—260 zusammen. Das Rostrum (Fig. 26) (A -{- B
— ioo—125) ist kürzer und daher noch breiter als im Sommer. Nur 0 (80—90) ist größer als im
Sommer. Alle diese winterlichen Veränderungen bringen die Winterformen von B. c. berolinensis
den Longispina-Formen nabe, doch unterscheiden sie sich von den ausgeprägten Formen dieser Reihe
durch die Form der Stirn, die niemals vor dem Auge vorgebuchtet ist, und das Vorhandensein einer
vorderen Dorsalkohkavität (wenigstens bei Weibchen, die viele Eier im Brutraum tragen).1)
J u n g e W i n t e r t i e r e (Tab. I, No. 17, Fig. 24) weichen von ausgewachsenen Winterweibchen
in demselben Sinne, wie es im Sommer der Fall ist, ab; von jungen Sommertieren unterscheiden
sie sich durch kürzeren Mucro (Mu = 140—150), der keine Incisuren trägt, und kürzere
1. Antennen (C + D = 575).
Männchen (Tab. I, No. 19; Fig. 28).2)
Das Männchen (Oktober/Januar) bat eine absolute Länge von 440—460 p und zeichnet sich
dadurch aus, daß der kurze, incisurenlose Mucro (Mu = 60—150) die gradlinige Fortsetzung des
ventralen Schalenrandes bildet. Im Gegensatz zum Männchen von B. c. longicornis befindet sieb
zwischen ventralem Schalen- und Muorokontur keine Bucht. Die ventrale Begrenzung des Rostrums
liegt hoch über dem ventralen Schalenrand. Die 1. Antennen (C + Dn= 650 770) sind wie bei
Longispina-Männchen gleichmäßig schwach gekrümmt.
forma borussica n. f. mihi (Tab. I, No. 20, 21; Fig. 12).
Der Mucro (Mu ca. 325, Max. 447) erreicht auch bei extremen Hocbsommertieren dieser
Lokalform3) nie die enorme relative Länge wie bei der typischen Form und sitzt infolgedessen den
Schalenklappen nicht mit so breiter Basis auf wie bei jener. Ebenso bleibt die 1. Ant enne (C+D =
ca. 650, Max. 750) hier stets bedeutend kürzer und ist infolgedessen bei weitem nicht so stark
gekrümmt wie bei der f. typica (Pr. = 394, Max. 534); sie ist vielmehr meist gleichmäßig schwach
gekrümmt, mitunter fast gradlinig und nur in äußerst seltenen Extremfällen etwas hakenförmig
1) Unterschiede gegen die Wintertiere von B. c. longicornis siehe pag. 33 f.
2) Vgl. auch Seligos (’07) Abbildung, Fig. 65 eines Männchens vom Gardschauersee, das m it meinen märkischen Männchen
g u t übereinstimmt. , _ , , __
3) Aus masurischen Seen (Material von Dr. L. Cohn), vgl. auch pag. 32, pag. 64, 65 und über die Cyclomorphose, pag. 77.
gebogen. St i rn gewölbter; A -+- B = ca. 100; 0 = ca. 73. Relative Schalenhöhe niedriger
(H — ca. 750); vordere Dorsalkonkavität fehlt oft oder ist nur schwach ausgeprägt. — In
allen diesen Merkmalen nähert sich f. borussica der Longispina-Beihe, von der sie sich morphologisch
nur durch Berücksichtigung extremer, mehr zur f. typica tendierender Varianten
unterscheiden läßt.
Der Mucro ausgewachsener Sommertiere der typischen Form von B. c. berolinensis unterscheidet
sich durch Form und Länge von den Mucrones aller übrigen Bosminen. Der Maximalwert
der Mucrolänge, den Burckhardt bei Schweizer Longispina-Formen fand, ist Mu = 262; ich fand
bei der Bosmina des Traunsees den noch höheren Wert von 275. Diese Werte bleiben weit unter
dem Maximalwert von B. c. berolinensis: Mu = 700. Höchstens bei einigen von Lilljeborg (’01),
Tab. XXXIX, Fig. 8; Tab. XL, Fig. 2 und 3 abgebildeten, von ihm als B. longispina s. str. bezeichnten
Formen decken sich die Mucromaße mit Mittelwerten von B. c. berolinensis. Bei diesen
Lilljeborgschen Tieren nähert sich bemerkenswerterweise auch die Form des Mucro der charakteristischen
Mucrobildung von B. c. berolinensis, indem ihr Mucro mit außerordentlich breiter Basis
den Schalenklappen aufsitzt und der caudale Schalenrand seiner ganzen Länge nach die dorsale
Begrenzung des Mucro bildet. Namentlich die erstgenannte Figur Lilljeborgs steht der B. c. berolinensis
in fast allen Punkten sehr nahe und unterscheidet sich von ihr nur durch die kürzeren, wenig
gebogenen, nach hinten gerichteten 1. Antennen. Hier ist vielleicht der Anschluß von B. c. berolinensis
an die Longispina-'Reihe zu suchen. Für diese Frage wäre die Kenntnis der Cyclomorphose der
Lilljeborgschen Formen von Wichtigkeit. Eine ähnliche Annäherung an die Formverhältnisse bei
B. c. berolinensis zeigt auch der sehr lange Mucro von B. c. reflexa. Bei Frühwintertieren von
B. c. berolinensis ist der Mucro kürzer und sitzt nicht mit so breiter Basis der Schale auf, wie im Hochsommer;
er nähert sich in seiner Form dann den Longispina-Mucrones. Es hängt also offenbar die
breitansetzende Basis des Mucro, die die charakteristische Form desselben bedingt, mit seiner extremen
Länge zusammen. In phylogenetischer Hinsicht ist es von Interesse, daß man in dem ventralen
Kontur des Mucro häufig noch Andeutungen der für die meisten Formen der Longispina-Reihe so
charakteristischen scharfen Richtungsänderung desselben bemerken kann (vgl. Burckhardt ’00,1,
p. 515, 519 und meine Fig. 9). Und zwar verläuft der ventrale Kontur des Mucro caudal von der mehr
oder weniger schwach angedeuteten Mucrobucht hinter der Seta Kurzi schärg abwärts (etwa unter
einem Winkel von 135° zum ventralen Schalenrand), wendet sich dann nach kurzer Strecke mit oft
plötzlichem Knick mehr nach hinten, so daß er etwa in der ursprünglichen Richtung des ventralen
Schalenrandes weiter verläuft (vgl. Fig. 9 a). Häufig fehlt allerdings eine solche scharfe Richtungsänderung
des ventralen Mucrokonturs; man kann dann oft an entsprechender Stelle einen etwas
welligen Kontur oder auch eine plötzliche Verjüngung des ganzen Mucros beobachten (z. B. am
Müritz- und Geserichsee); doch können auch alle diese Verhältnisse verwischt sein und der ventrale,
wie der dorsale Kontur des Mucro in ununterbrochener gleichmäßiger Linie zur Spitze auslaufen.
Trotzdem bin ich geneigt, die oben erwähnte schwach ausgebildete Richtungsänderung im ventralen
Kontur des Mucro bei B. c. berolinensis als ein Rudiment anzusehen, das auf Stammformen der
B. c. berolinensis hinweist, bei denen das erwähnte Merkmal deutlicher entwickelt war, mithin
auf Formen der Longispina-Beihe.
Die relative Scha l enhöheH beträgt im Durchschnitt etwa 740—800, kann aber bei Weibchen,
deren Brutraum von vielen Eiern erfüllt ist (Maximale Eizahl bei der typischen Form 6—8, bei