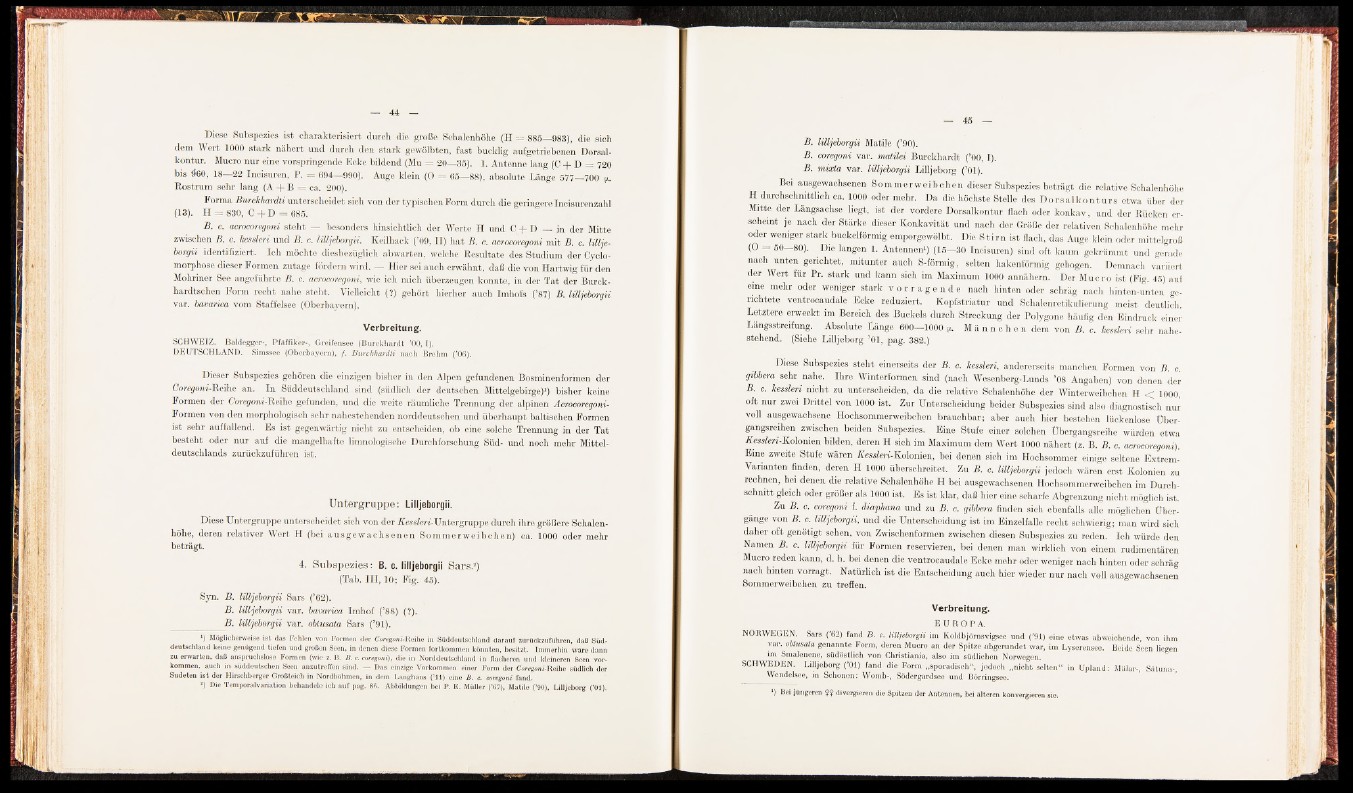
Diese Subspezies ist charakterisiert durch die große Sehalenhöhe (H = 885—983), die sich
dem Wert 1000 stark nähert und durch den stark gewölbten, fast bucklig aufgetriebenen Dorsalkontur.
Mucro nur eine vorspringende Ecke bildend (Mu = 20—35). 1. Antenne lang (C + D = 720
bis 360, 18—22 Ineisuren, P. = 694—990). Auge klein (O = 65—88), absolute Länge 577—700 n.
Rostrum sehr lang (Ä -f- B = ca. 200).
Forma Burckhardti unterscheidet sich von der typischen Form durch die geringere Incisurenzahl
(13). H = 830, C -f D = 685.
B. c. acrocoregoni steht besonders hinsichtlich der Werte H und C -j-D in der Mitte
zwischen B. c. kessleri und B. c. lilljeborgii. Keilhack (’09, II) hat B. c. acrocoregoni mit B. c. lilljeborgii
identifiziert. Ich möchte diesbezüglich abwarten, welche Resultate des Studium der Cyclo-
morphose dieser Formen zutage fördern wird. — Hier sei auch erwähnt, daß die von Hartwig für den
Mohriner See angeführte B. c. acrocoregoni, wie ich mich überzeugen konnte, in der Tat der Burck-
hardtschen Form recht nahe steht. Vielleicht (?) gehört hierher auch Imhofs (’87) B. lilljeborgii
var. bavarica vom Staffelsee (Oberbayern).
Verbreitung.
SCHWEIZ. Baldegger-, Pfäffiker-, Greifensee (Burckhardt ’00,1).
DEUTSCHLAND. Simssee (Oberbayern), /. Burckhardti nach Brehm (’06).
Dieser Subspezies gehören die einzigen bisher in den Alpen gefundenen Bosminenformen der
Coregrom’-Reihe an. In Süddeutschland sind (südlich der deutschen Mittelgebirge)1) bisher keine
Formen der Coregoni-Reihe gefunden, und die weite räumliche Trennung der alpinen Acrocoregoni-
Formen von den morphologisch sehr nahestehenden norddeutschen und überhaupt baltischen Formen
ist sehr auffallend. Es ist gegenwärtig nicht zu entscheiden, ob eine solche Trennung in der Tat
besteht oder nur auf die mangelhafte limnologische Durchforschung Süd- und noch mehr Mitteldeutschlands
zurückzuführen ist.
U n te rg ru p p e : Lilljeborgii.
Diese Untergruppe unterscheidet sich von der ÄmZen-Untergruppe durch ihre größere Schalenhöhe,
deren relativer Wert H (bei ausgewachs enen Sommerweibchen) ca. 1000 oder mehr
beträgt.
4. Subspezies: B. c. lilljeborgii Sars.2)
(Tab. III, 10; Fig. 45).
Syn. B. lilljeborgii Sars (’62).
B. lilljeborgii var. bavarica Imhof (’88) (?).
B. lilljeborgii var. öblusata Sars (’91).
0 Möglicherweise is t das Fehlen von Formen der Coregoni-Reihe in Süddeutschland darauf zurückzuführen, daß Süddeutschland
keine genügend tiefen und großen Seen, in denen diese Formen fortkommen könnten, besitzt. Immerhin wäre dann
zu erwarten, daß anspruchslose Formen (wie z. B. B. c. coregoni), die in Norddeutschland in flacheren und kleineren Seen Vorkommen,
auch in süddeutschen Seen anzutreffen sind. — Das einzige Vorkommen einer Form der Coregont-Reihe südlich der
Sudeten is t der Hirschberger Großteich in Nordböhmen, in dem Langhans (’11) eine B. c. coregoni fand.
*) Die Temporalvariation behandele ich auf pag. 86. Abbildungen bei P. E. Müller (’67), Matile (’90), Lilljeborg (’01).
B. lilljeborgii Matile (’90).
B. coregoni var. matüei Burckhardt (’00,1).
B. mixta var. lilljeborgii Lilljeborg (’01).
Bei ausgewachsenen Sommerweibchen dieser Subspezies beträgt die relative Schalenhöhe
H durchschnittlich ca. 1000 oder mehr. Da die höchste Stelle des Dor s al kontur s etwa über der
Mitte der Längsachse liegt, ist der vordere Dorsalkontur flach oder konkav, und der Rücken erscheint
je nach der Stärke dieser Konkavität, und nach der Größe der relativen Schalenhöhe mehr
oder weniger stark buckelförmig emporgewölbt. Die St i rn ist flach, das Auge klein oder mittelgroß
(O H 50—80). Die langen 1. Antennen') (15—30 Incisuren) sind oft kaum gekrümmt und gerade
nach unten gerichtet, mitunter auch S-förmig, selten hakenförmig gebogen. Demnach variiert
der Wert für Pr. stark und kann sich im Maximum 1000 annähern. Der Mucro ist (Big. 45) auf
eine mehr oder weniger stark v o r r a g e n d e nach hinten oder schräg nach hinten-unten gerichtete
ventrocaudale Ecke reduziert. Kopfstriatur und Schalenretikulierung meist deutlich.
Letztere erweckt im Bereich des Buckels durch Streckung der Polygone häufig den Eindruck einer
Längsstreifung. Absolute fiänge 600—1000 M ä n n c h e n dem von II. c. kessleri sehr nahe-
stehend. (Siehe Lilljeborg ’01, pag. 382.)
Diese Subspezies steht einerseits der B. c. kessleri, andererseits manchen Formen von B. c.
gibbera sehr nahe. Ihre Winterformen sind (nach Wesenberg-Lunds ’08 Angaben) von denen der
B. c. leessleri nicht zu unterscheiden, da die relative Schalenhöhe der Winterweibchen H < 1000,
oft nur zwei Drittel von 1000 ist. Zur Unterscheidung beider Subspezies sind also diagnostisch nur
voll ausgewachsene Hochsommerweibchen brauchbar; aber auch hier, bestehen lückenlose Uber-
gangsreüien zwischen beiden Subspezies. Eine Stufe einer solchen Übergangsreihe würden etwa
Kessferi-Kolonien bilden, deren H sich im Maximum dem Wert 1000 nähert (z. B. B. c. acrocoregoni).
Eine zweite Stufe wären Kessfen'-Kolonien, bei denen sich im Hochsommer einige seltene Extrem-
Varianten finden, deren H 1000 überschreitet.. Zu B. c. lilljeborgii jedoch wären erst Kolonien zu
rechnen, bei denen die relative Schalenhöhe H bei ausgewachsenen Hochsommerweibchen im Durchschnitt
gleich oder größer als 1000 ist. Es ist klar, daß hier eine scharfe Abgrenzung nicht möglich ist.
Zu B. c. coregoni f. diaphma und zu B. c. gibbera finden sich ebenfalls alle möglichen Übergänge
von B. e. lilljeborgii, und die Unterscheidung ist im Einzelfalle recht schwierig; man wird sich
daher oft genötigt sehen, von Zwischenformen zwischen diesen Subspezies zu reden. Ich würde den
Namen B. e. IMjeborgn für Formen reservieren, bei denen man wirklich von einem rudimentären
Mucro reden kann, d. h. bei denen die ventrocaudale Ecke mehr oder weniger nach hinten oder schräg
nach hinten vorragt. Natürlich ist die Entscheidung auch hier wieder nur nach voll ausgewachsenen
Sommerweibchen zu treffen.
Verbreitung.
EUROPA.
NORWEGEN. Sars (’62) fand B . c. lilljeborgii im Koldbjörnsvigsee und (’91) eine etwas abweichende, von ihm
var. obtusata genannte Form, deren Mucro an der Spitze abgerundet war, im Lyserensee. Beide Seen liegen
im Smalenene, südöstlich von Christiania, also im südlichen Norwegen.
SCHWEDEN. Lilljeborg (’01) fand die Form „sporadisch“, jedoch „nicht selten“ in Upland: Mälar-, Sätuna-,
Wendelsee, in Schonen.* Womb-, Södergardsee und Börringsee.
’) Bei jüngeren 9 ? divergieren die Spitzen der Antennen, bei älteren konvergieren sie.