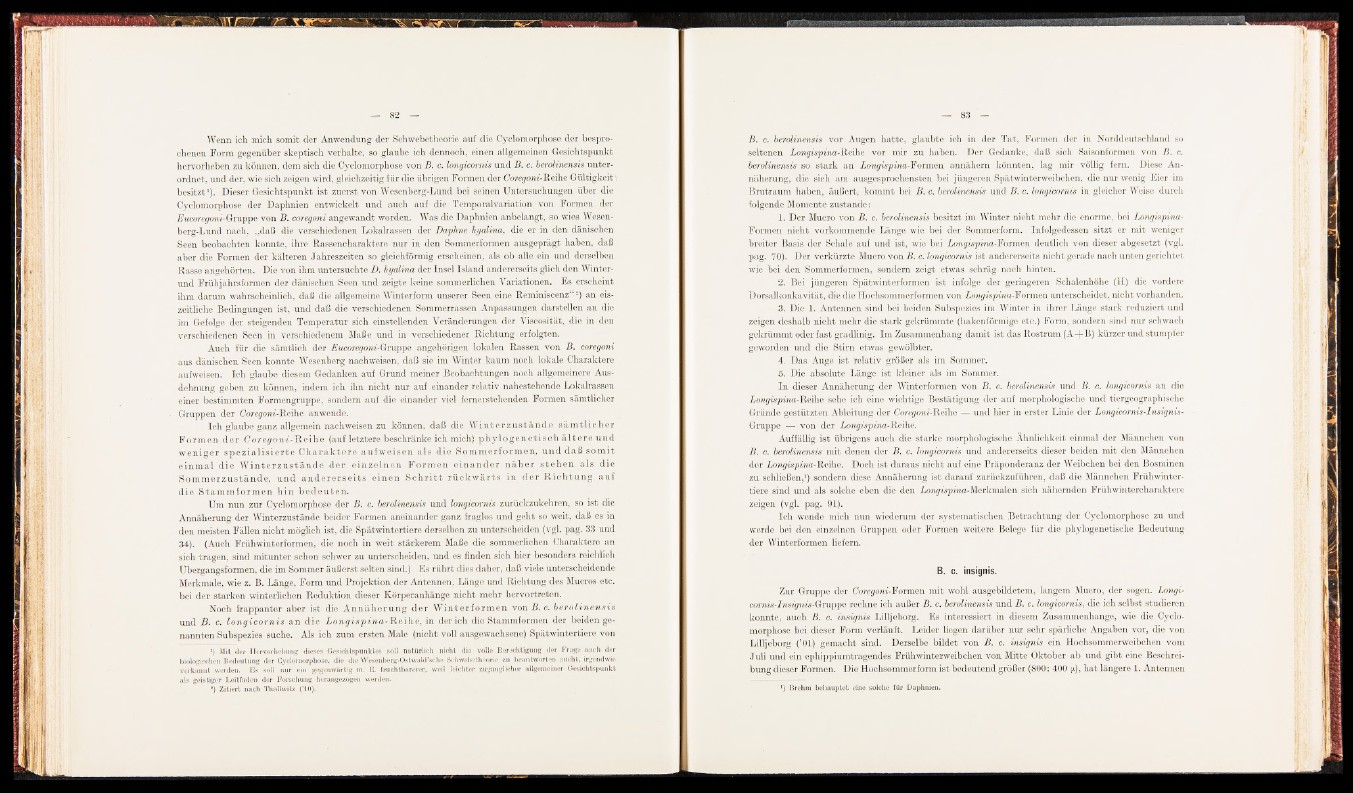
Wenn ich mich somit der Anwendung der Schwebetheorie auf die Cyclomorphose der besprochenen
Form gegenüber skeptisch verhalte, so glaube ich dennoch, einen allgemeinen Gesichtspunkt
hervorheben zu können, dem sich die Cyclomorphose von B. c. longicornis und B. c. berolinensis unterordnet,
und der, wie sich zeigen wird, gleichzeitig für die übrigen Formen der Coregoni-Beihe Gültigkeit1)
besitzt1). Dieser Gesichtspunkt ist zuerst von Wesenberg-Lund bei seinen Untersuchungen über die
Cyclomorphose der Daphnien entwickelt und auch auf die Temporalvariation von Formen der
Eucoregoni-Gruppe von B. coregoni angewandt worden. Was die Daphnien anbelangt, so wies Wesenberg
Lund nach, „daß die verschiedenen Lokalrassen der Daphne hyalina, die er in den dänischen
Seen beobachten konnte, ihre Rassencharaktere nur in den Sommerformen ausgeprägt haben, daß
aber die Formen der kälteren Jahreszeiten so gleichförmig erscheinen, als ob alle ein und derselben
Rasse angehörten. Die von ihm untersuchte D. hyalina der Insel Island andererseits glich den Winter-
und Frühjahrsformen der dänischen Seen und zeigte keine sommerlichen Variationen. Es erscheint
ihm darum wahrscheinlich, daß die allgemeine Winterform unserer Seen eine Reminiscenz“ 2) an eiszeitliche
Bedingungen ist, und daß die verschiedenen Sommerrassen Anpassungen darstellen an die
im Gefolge der steigenden Temperatur sich einstellenden Veränderungen der Viscosität, die in den
verschiedenen Seen in verschiedenem Maße und in verschiedener Richtung erfolgten.
Auch für die sämtlich der Eucoregoni-Qruppe angehörigen lokalen Rassen von B. coregoni
aus dänischen Seen konnte Wesenberg nachweisen, daß sie im Winter kaum noch lokale Charaktere
aufweisen. Ich glaube diesem Gedanken auf Grund meiner Beobachtungen noch allgemeinere Ausdehnung
geben zu können, indem ich ihn nicht nur auf einander relativ nahestehende Lokalrassen
einer bestimmten Formengruppe, sondern auf die einander viel fernerstehenden Formen sämtlicher
Gruppen der Coregoni-Reihe anwende.
Ich glaube ganz allgemein nachweisen zu können, daß die Wi n t e r zu s t än de s ämt l i c h e r
Forme n der Coregoni-Reihe (auf letztere beschränke ich mich) phy l o gen e t i s c h ä l t e r e und
weni ge r spezi a l i si e r t e C ha r a k t e r e au fwe isen als die Sommer fo rmen , un d daß somit
einma l die Wi n t e r z u s t ä n d e der ei nzel n en Fo rme n einan d e r n äh e r s t e h e n als die
Sommerzustände, un d a n d e r e r s e i t s ei nen Sch r i t t rü ckwä r t s in der Ri c h tu n g auf
die Stammf o rmen h i n becleuten.
Um nun zur Cyclomorphose der B. c. berolinensis und longicornis zurückzukehren, so ist die
Annäherung der Winterzustände beider Formen aneinander ganz fraglos und geht so weit, daß es in
den meisten Fällen nicht möglich ist, die Spätwintertiere derselben zu unterscheiden (vgl. pag. 33 und
34). . (Auch Frühwinterformen, die noch in weit stärkerem Maße die sommerlichen Charaktere an
sich tragen, sind mitunter schon schwer zu unterscheiden, und es finden sich hier besonders reichlich
Übergangsformen, die im Sommer äußerst selten sind.) Es rührt dies daher, daß viele unterscheidende
Merkmale, wie z. B. Länge, Form und Projektion der Antennen, Länge und Richtung des Mucros etc.
bei der starken winterlichen Reduktion dieser Körperanhänge nicht mehr hervortreten.
Noch frappanter aber ist die Annä he r un g der Wi n t e r f ormen von R. c. b e ro lin e n sis
und B. c. lo n g ico rn is an die L o n g is p in a -Reihe, in der ich die Stammformen der beiden genannten
Subspezies suche. Als ich zum ersten Male (nicht voll ausgewachsene) Spätwintertiere von
j) Mit der Hervorhebung dieses Gesichtspunktes soll natürlich nich t die volle Berechtigung der Frage nach der
biologischen Bedeutung der Cyclomorphose, die die Wesenberg-Ostwald’sche Schwebetheorie zu beantworten sucht, irgendwie
v erkannt werden. Es soll n u r ein gegenwärtig m. E. fruchtbarerer, weil leichter zugänglicher allgemeiner Gesichtspunkt
als geistiger Leitfaden der Forschung herangezogen werden.
*) Zitiert nach Thallwitz (’10).
B. c. berolinensis vor Augen hatte, glaubte ich in der Tat, Formen der in Norddeutschland so
seltenen Longispina-Reihe vor mir zu haben. Der Gedanke, daß sich Saisonformen von B. c.
berolinensis so stark an Longispina-Formen annähern könnten, lag mir völlig fern. Diese Annäherung,
die sich am ausgesprochensten bei jüngeren Spätwinterweibchen, die nur wenig Eier im
Brutraum haben, äußert, kommt bei B. c. berolinensis und B. c. longicornis in gleicher Weise durch
folgende Momente zustande:
1. Der Mucro von B. c. berolinensis besitzt im Winter nicht mehr die enorme, bei Longispina-
Formen nicht vorkommende Länge wie bei der Sommerform. Infolgedessen sitzt er mit weniger
breiter Basis der Schale auf und ist, wie bei Longispina-Formen deutlich von dieser abgesetzt (vgl.
pag. 70). Der verkürzte Mucro von B. c. longicornis ist andererseits nicht gerade nach unten gerichtet
wie bei den Sommerformen, sondern zeigt etwas schräg nach hinten.
2. Bei jüngeren Spätwinterformen ist infolge der geringeren Schalenhöhe (H) die vordere
Dorsalkonkavität, die die Hochsommerformen von Longispina-Eormen unterscheidet, nicht vorhanden.
3. Die 1. Antennen sind bei beiden Subspezies im Winter in ihrer Länge stark reduziert und
zeigen deshalb nicht mehr die stark gekrümmte (hakenförmige etc.) Form, sondern sind nur schwach
gekrümmt oder fast gradlinig. Im Zusammenhang damit ist das Rostrum (A+B) kürzer und stumpfer
geworden und die Stirn etwas gewölbter.
4. Das Auge ist relativ größer als im Sommer.
5. Die absolute Länge ist kleiner als im Sommer.
In dieser Annäherung der Winterformen von B. c. berolinensis und B. c. longicornis an die
Longispina-Beihe sehe ich eine wichtige Bestätigung der auf morphologische und tiergeographische
Gründe gestützten Ableitung der Coregoni-Reihe — und hier in erster Linie der Longicornis-Insignis-
Gruppe — von der Longispina-Reihe.
Auffällig ist übrigens auch die starke morphologische Ähnlichkeit einmal der Männchen von
B. c. berolinensis mit denen der B. c. longicornis und andererseits dieser beiden mit den Männchen
der Longispina-Reihe. Doch ist daraus nicht auf eine Präponderanz der Weibchen bei den Bosminen
zu schließen,1) sondern diese Annäherung ist darauf zurückzuführen, daß die Männchen Frühwintertiere
sind und als solche eben die den Longispina-Meikmalen sich nähernden Frühwintercharaktere
zeigen (vgl. pag. 91).
Ich wende mich nun wiederum der systematischen Betrachtung der Cyclomorphose zu und
werde bei den einzelnen Gruppen oder Formen weitere Belege für die phylogenetische Bedeutung
der Winterformen liefern.
B. c. insignis.
Zur Gruppe der Coregoni-Formen mit wohl ausgebildetem, langem Mucro, der sogen. Longi-
cornis-Insignis-Qxiwppe rechne ich außer B. c. berolinensis und B. c. longicornis, die ich selbst studieren
konnte, auch B. c. insignis Lilljeborg. Es interessiert in diesem Zusammenhänge, wie die Cyclomorphose
bei dieser Form verläuft. Leider liegen darüber nur sehr spärliche Angaben vor, die von
Lilljeborg (’01) gemacht sind. Derselbe bildet von B. c. insignis ein Hochsommerweibchen vom
Juli und ein ephippiumtragendes Frühwinterweibchen von Mitte Oktober ab und gibt eine Beschreibung
dieser Formen. Die Hochsommerform ist bedeutend größer (800: 400 p.), hat längere 1. Antennen
x) Brehm behauptet eine solche für Daphnien.