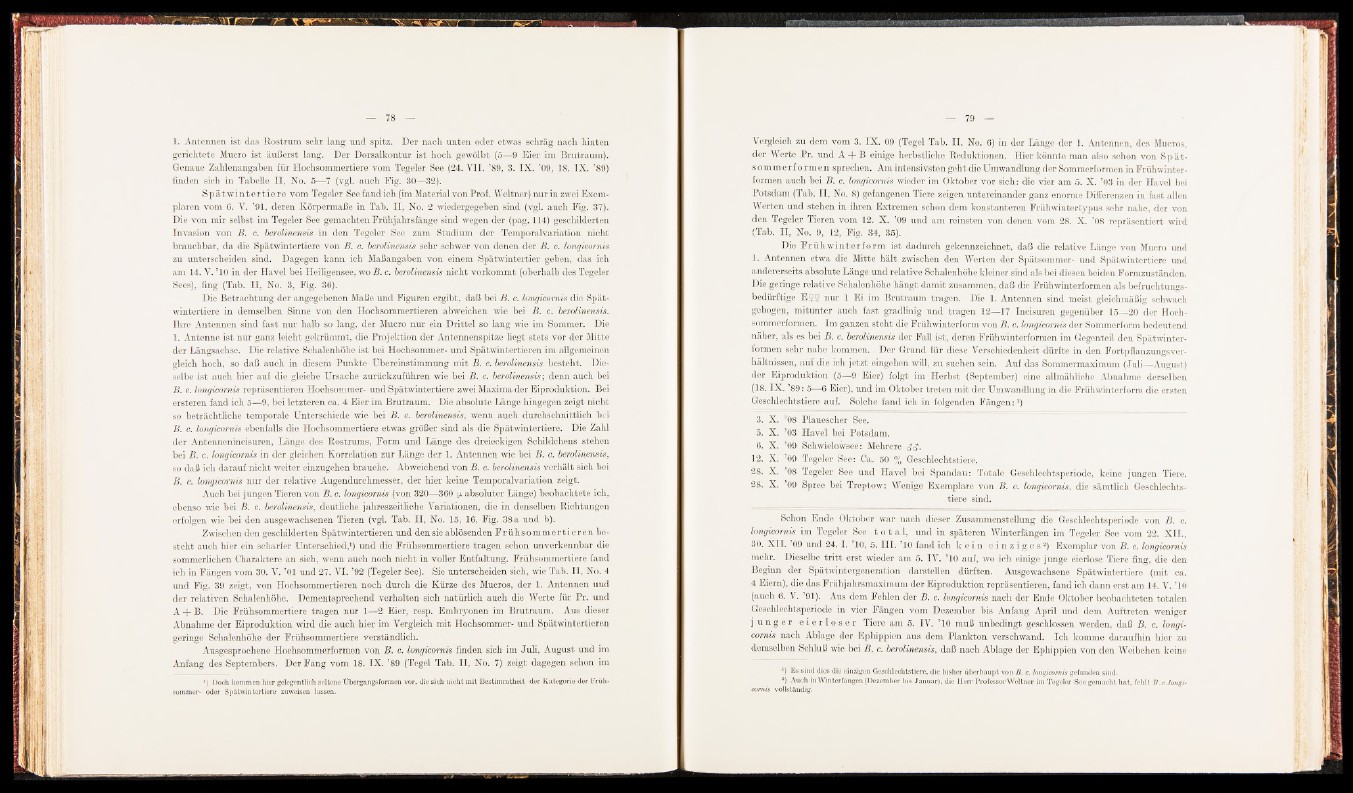
1. Antennen ist das Rostrum sehr lang und spitz. Der nach unten oder etwas schräg nach hinten
gerichtete Mucro ist äußerst lang. Der Dorsalkontur ist hoch gewölbt (5—9 Eier im Brutraum).
Genaue Zahlenangaben für Hochsommertiere vom Tegeler See (24. VII. ’89, 3. IX. ’09, 18. IX. ’89)
finden sich in Tabelle II, No. 5—7 (vgl. auch Fig. 30—32).
Spä twin t e r t i e r e vom Tegeler See fand ich (im Material von Prof. Weltner) nur in zwei Exemplaren
vom 6. V. ’91, deren Körpermaße in Tab. II, No. 2 wiedergegeben sind (vgl. auch Fig. 37).
Die von mir selbst im Tegeler See gemachten Frühjahrsfänge sind wegen der (pag. 114) geschilderten
Invasion von B. c. berolinensis in den Tegeler See zum Studium der Temporalvariation nicht
brauchbar, da die Spätwintertiere von B. c. berolinensis sehr schwer von denen der B. c. longicornis
zu unterscheiden sind. Dagegen kann ich Maßangaben von einem Spätwintertier geben, das ich
am 14. V. ’10 in der Havel bei Heiligensee, wo B. c. berolinensis nicht vorkommt (oberhalb des Tegeler
Sees), fing (Tab. II, No. 3, Fig. 36).
Die Betrachtung der angegebenen Maße und Figuren ergibt, daß bei B. c. longicornis die Spätwintertiere
in demselben Sinne von den Hochsommertieren abweiehen wie bei B. c. berolinensis.
Ihre Antennen sind fast nur halb so lang, der Mucro nur ein Drittel so lang wie im Sommer. Die
1. Antenne ist nur ganz leicht gekrümmt, die Projektion der Antennenspitze liegt stets vor der Mitte
der Längsachse. Die relative Schalenhöhe ist bei Hochsommer- und Spätwintertieren im allgemeinen
gleich hoch, so daß auch in diesem Punkte Übereinstimmung mit B. c. berolinensis besteht. Dieselbe
ist auch hier auf die gleiche Ursache zurückzuführen wie bei B. c. berolinensis; denn auch bei
B. c. longicornis repräsentieren Hochsommer- und Spätwintertiere zwei Maxima der Eiproduktion. Bei
ersteren fand ich 5—9, bei letzteren ca. 4 Eier im Brutraum. Die absolute Länge hingegen zeigt nicht
so beträchtliche temporale Unterschiede wie bei B. c. berolinensis, wenn auch durchschnittlich bei
B. c. longicornis ebenfalls die Hochsommertiere etwas größer sind als die Spätwintertiere. Die Zahl
der Antennenincisuren, Länge des Rostrums, Form und Länge des dreieckigen Schildchens stehen
bei B. c. longicornis in der gleichen Korrelation zur Länge der 1. Antennen wie bei B. c. berolinensis,
so daß ich darauf nicht weiter einzugehen brauche. Abweichend von B. c. berolinensis verhält sich bei
B. c. longicornis nur der relative Augendurchmesser, der hier keine Temporalvariation zeigt.
Auch bei jungen Tieren von B. c. longicornis (von 320—360 ¡j. absoluter Länge) beobachtete ich,
ebenso wie bei B. c. berolinensis, deutliche jahreszeitliche Variationen, die in denselben Richtungen
erfolgen wie bei den ausgewachsenen Tieren (vgl. Tab. II, No. 15, 16, Fig. 38 a und b).
Zwischen den geschilderten Spätwintertieren und den sie ablösenden F r ü h s omme r t i e r e n besteht
auch hier ein scharfer Unterschied,1) und die Frühsommertiere tragen schon unverkennbar die
sommerlichen Charaktere an sich, wenn auch noch nicht in voller Entfaltung. Frühsommertiere fand
ich in Fängen vom 30. V. ’01 und 27. VI. ’92 (Tegeler See). Sie unterscheiden sich, wie Tab. II, No. 4
und Fig. 39 zeigt, von Hochsommertieren noch durch die Kürze des Mucros, der 1. Antennen und
der relativen Schalenhöhe. Dementsprechend verhalten sich natürlich auch die Werte für Pr. und
A -f- B. Die Frühsommertiere tragen nur 1—2 Eier, resp. Embryonen im Brutraum. Aus dieser
Abnahme der Eiproduktion wird die auch hier im Vergleich mit Hochsommer- und Spätwintertieren
geringe Schalenhöhe der Frühsommertiere verständlich.
Ausgesprochene Hochsommerformen von B. c. longicornis finden sich im Juli, August und im
Anfang des Septembers. Der Fang vom 18. IX. ’89 (Tegel Tab. II, No. 7) zeigt dagegen schon im
!) Doch kommen hier gelegentlich seltene Übergangsformen vor, die sich nicht m it Bestimmtheit der Kategorie der F rühsommer
oder Spätwintertiere zuweisen lassen.
Vergleich zu dem vom 3. IX. 09 (Tegel Tab. II, No. 6) in der Länge der 1. Antennen, des Mucros,
der Werte Pr. und A-f-B einige herbstliche Reduktionen. Hier könnte man also schon von Sp ä t sommerformen
sprechen. Am intensivsten geht die Umwandlung der Sommerformen in Frühwinterformen
auch bei B. c. longicornis wieder im Oktober vor sich: die vier am 5. X. ’03 in der Havel bei
Potsdam (Tab. II, No. 8) gef angenen Tiere zeigen untereinander ganz enorme Differenzen in fast allen
Werten und stehen in ihren Extremen schon dem konstanteren Frühwintertypus sehr nahe, der von
den Tegeler Tieren vom 12. X. ’09 und am reinsten von denen vom 28. X. ’08 repräsentiert wird
(Tab. II, No. 9, 12, Fig. 34, 35).
Die Fr ü hwi n t e r f orm ist dadurch gekennzeichnet, daß die relative Länge von Mucro und
1. Antennen etwa die Mitte hält zwischen den Werten der Spätsommer- und Spätwintertiere und
andererseits absolute Länge und relative Schalenhöhe kleiner sind als bei diesen beiden Formzuständen.
Die geringe relative Schalenhöhe hängt damit zusammen, daß die Frühwinterformen als befruchtungsbedürftige
E$$ nur 1 Ei im Brutraum tragen. Die 1. Antennen sind meist gleichmäßig schwach
gebogen, mitunter auch fast gradlinig und tragen 12—17 Incisuren gegenüber 15—20 der Hochsommerformen.
Im ganzen steht die Frühwinterform von B. c. longicornis der Sommerform bedeutend
näher, als es bei B. c. berolinensis der Fall ist, deren Frühwinterformen im Gegenteil den Spätwinterformen
sehr nahe kommen. Der Grund für diese Verschiedenheit dürfte in den Fortpflanzungsver-
hältnissen, auf die ich jetzt eingehen will, zu suchen sein. Auf das Sommermaximum (Juli—August)
der Eiproduktion (5—9 Eier) folgt im Herbst (September) eine allmähliche Abnahme derselben
(18. IX. ’89: 5—6 Eier), und im Oktober treten mit der Umwandlung in die Früh winterform, die ersten
Geschlechtstiere auf. Solche fand ich in folgenden Fängen:1)
3. X. ’08 Plauescher See.
5. X. ’03 Havel bei Potsdam.
6. X. ’09 Schwielowsee: Mehrere <?(?•
12. X. ’09 Tegeler See: Ca. 50 % Geschlechtstiere.
28. X. ’08 Tegeler See und Havel bei Spandau: Totale Geschlechtsperiode, keine jungen Tiere.
28. X. ’09 Spree bei Treptow: Wenige Exemplare von B. c. longicornis, die sämtlich Geschlechtstiere
sind.
Schon Ende Oktober war nach dieser Zusammenstellung die Geschlechtsperiode von B. c.
longicornis im Tegeler See t o t a l , und in späteren Winterfängen im Tegeler See vom 22. XII.,
30. XII. ’09 und 24. I. ’10, 5. III. ’10 fand ich k e i n e i n z i g e s 2) Exemplar von B. c. longicornis
mehr. Dieselbe tritt erst wieder am 5. IV. ’10 auf, wo ich einige junge eierlose Tiere fing, die den
Beginn der Spätwintergeneration darstellen dürften. Ausgewachsene Spätwintertiere (mit ca.
4 Eiern), die das Frühjahrsmaximum der Eiproduktion repräsentieren, fand ich dann erst am 14. V. ’10
(auch 6. V. ’91). Aus dem Fehlen der B. c. longicornis nach der Ende Oktober beobachteten totalen
Geschlechtsperiode in vier Fängen vom Dezember bis Anfang April und dem Auftreten weniger
j u n g e r e i e r l o s e r Tiere am 5. IV. ’10 muß unbedingt geschlossen werden, daß B. c. longicornis
nach Ablage der Ephippien aus dem Plankton verschwand. Ich komme daraufhin hier zu
demselben Schluß wie bei B. c. berolinensis, daß nach Ablage der Ephippien von den Weibchen keine
J) Es sind dies die einzigen Geschlechtstiere, die bisher überhaupt von B. c. longicornis gefunden sind.
*) Auch in Winterfängen (Dezember Dis Janua r), die He rr Professor Weltner im Tegeler See gemacht h a t, fehlt B . c. longicornis
vollständig.