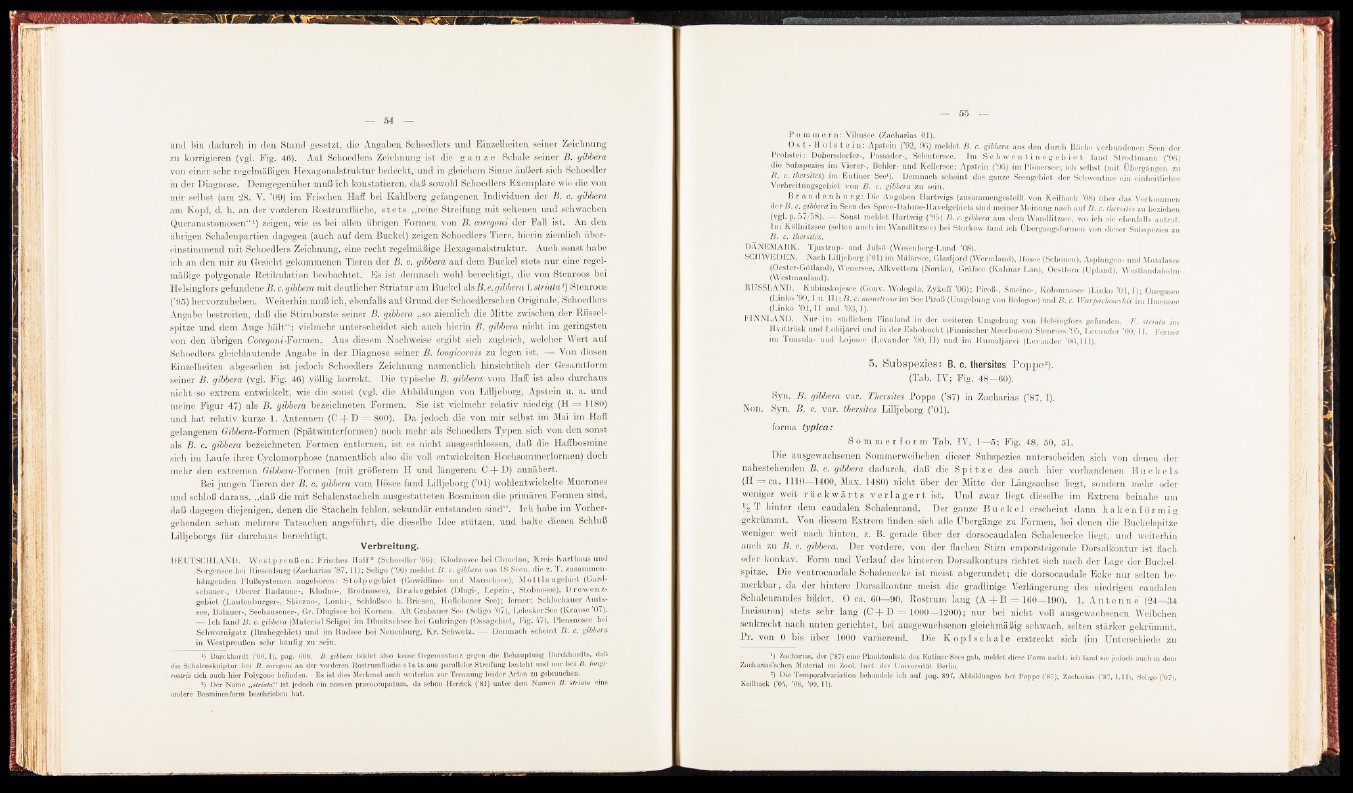
und bin dadurch in den Stand gesetzt, die Angaben Schoedlers und Einzelheiten seiner Zeichnung
zu korrigieren (vgl. Fig. 46). Auf Schoedlers Zeichnung ist die g a n z e Schale seiner B. gibbera
von einer sehr regelmäßigen Hexagonalstruktur bedeckt, und in gleichem Sinne äußert sich Schoedler
in der Diagnose. Demgegenüber muß ich konstatieren, daß sowohl Schoedlers Exemplare wie die von
mir selbst (am 28. V. ’09) im Frischen Haff bei Kahlberg gefangenen Individuen der B. c. gibbera
am Kopf, d. h. an der vorderen Rostrumfläche, s tet s „reine Streifung mit seltenen und schwachen
Queranastomosen“ 1) zeigen, wie es bei allen übrigen Formen von B. coregoni der Fall ist. An den
übrigen Schalenpartien dagegen (auch auf dem Buckel) zeigen Schoedlers Tiere, hierin ziemlich übereinstimmend
mit Schoedlers Zeichnung, eine recht regelmäßige Hexagonalstruktur. Auch sonst habe
ich an den mir zu Gesicht gekommenen Tieren der B. c. gibbera auf dem Buckel stets nur eine regelmäßige
polygonale Retikulation beobachtet. Es ist demnach wohl berechtigt, die von Stenroos bei
Helsingfors gefundene B. c. gibbera mit deutlicher Striatur am Buckel als B. c. gibbera f. striata2) Stenroos
(’95) hervorzuheben. Weiterhin muß ich, ebenfalls auf Grund der Schoedlerschen Originale, Schoedlers
Angabe bestreiten, daß die Stirnborste seiner B. gibbera „so ziemlich die Mitte zwischen der Rüsselspitze
und dem Auge hält“ ; vielmehr unterscheidet sich auch hierin B. gibbera nicht im geringsten
von den übrigen Coregoni-Formen. Aus diesem Nachweise ergibt sich zugleich, welcher Wert auf
Schoedlers gleichlautende Angabe in der Diagnose seiner B. longicornis zu legen ist. — Von diesen
Einzelheiten abgesehen ist jedoch Schoedlers Zeichnung namentlich hinsichtlich der Gesamtform
seiner B. gibbera (vgl. Fig. 46) völlig korrekt. Die typische B. gibbera vom Haff ist also durchaus
nicht so extrem entwickelt, wie die sonst (vgl. die Abbildungen von Lilljeborg, Apstein u. a. und
meine Figur 47) als B. gibbera bezeichneten Formen. Sie ist vielmehr relativ niedrig (H = 1180)
und hat relativ kurze 1. Antennen (C + D = 800). Da jedoch die von mir selbst im Mai im Haff
gefangenen Gibbera-Formen (Spätwinterformen) noch mehr als Schoedlers Typen sich von den sonst
als B. c. gibbera bezeichneten Formen entfernen, ist es nicht ausgeschlossen, daß die Haffbosraine
sich im Laufe ihrer Cyclomorphose (namentlich also die voll entwickelten Hochsommerformen) doch
mehr den extremen Gibbera-F oimen (mit größerem H und längerem C + D) annähert.
Bei jungen Tieren der B. c. gibbera vom Ifösee fand Lilljeborg (’01) wohlentwickelte Mucrones
und schloß daraus, „daß die mit Schalenstacheln ausgestatteten Bosminen die primären Formen sind,
daß dagegen diejenigen, denen die Stacheln fehlen, sekundär entstanden sind“. Ich habe im Vorhergehenden
schon mehrere Tatsachen angeführt, die dieselbe Idee stützen, und halte diesen Schluß
Lilljeborgs für durchaus berechtigt.
Verbreitung.
DEUTSCHLAND. Westpreußen: Frisches Haff* (Schoedler’66); Klodnosee bei Chmelno, Kreis Karthaus und
Sorgensee bei Riesenburg (Zacharias ’87, II); Seligo (’90) meldet B . c. gibbera aus 18 Seen, die z. T. zusammenhängenden
Flußsystemen angehören: Stolpe gebiet (Gowidlino- und Mauschsee), Mottlaugebiet (Gard-
schauer-, Oberer Radaune-, Klodno-, Brodnosee), Br ah e gebiet (Dlugi-, Lepzin-, Stobnosee), Drewenz-
gebiet (Lautenburger-, Sbiczno-, Lonki-, Schloßsee b. Briesen, Hoflebener See); ferner: Schlochauer Amtssee,
Balauer-, Seehausener-, Gr. Dlugisee bei Körnen. AltGrabauer See (Seligo ’07), LeleskerSee (Krause 07).
Ich fand B . c. gibbera (Material Seligo) im Dlusitschsee bei Guhringen (Ossagebiet, Fig. 47), Plensnosee bei
Schwornigatz (Brahegebiet) und im Radsee bei Neuenburg, Kr. Schwetz. — Demnach scheint B . c. gibbera
in Westpreußen sehr häufig zu sein,
i) Burckhardt (’0 0 ,1), pag. 608. B. gibbera bildet also keine Gegeninstanz gegen die Behauptung Burckhardts, daß
die Schalenskulptur bei B. coregoni an der vorderen Rostrum fläche s t e t s aus paralleler Streifung besteht und nur bei B. longi-
rostris sich auch hier Polygone befinden. Es ist dies Merkmal auch weiterhin zur Trennung beider Arten zu gebrauchen.
a) Der Name „ striata" is t jedoch ein nomen praeoccupatum, da schon Herrick (’81) unter dem Namen B. striata eine
andere Bosminenform beschrieben hat.
P omme r n : Vilmsee (Zacharias 01).
O s t -Ho l s t e i n : Apstein (’92, 96) meldet B . c. gibbera aus den durch Bäche verbundenen Seen der
Probstei: Dobersdorfer-, Passader-, Selentersee. Im S c h w e n t i n e g e b i e t fand Strodtmann (’96)
die Subspezies im Vierer-, Behler- und Kellersee; Apstein (’96) im Plönersee; ich selbst (mit Übergängen zu
B . c. thersites) im Eutiner See1). Demnach scheint das ganze Seengebiet der Schwentine ein einheitliches
Verbreitungsgebiet von B . c. gibbera zu sein.
B r a n d e n b u r g : Die Angaben Hartwigs (zusammengestellt von Keilhack ’08) über das Vorkommen
der B . c. gibbera in Seen des Spree-Dahme-IIavelgebiets sind meiner Meinung nach auf B . c. thersites zu beziehen
(vgl. p. 57/58). — Sonst meldet Hartwig (’95) B . c. gibbera aus dem Wandlitzsee, wo ich sie ebenfalls antraf.
Im Köllnitzsee (selten auch im Wandlitzsee) bei Storkow fand ich Übergangsformen von dieser Subspezies zu
B . c. thersites.
DÄNEMARK. Tjustrup- und Julsö (Wesenberg-Lund ’08).
SCHWEDEN. Nach Lilljeborg (’01) im Mälarsee, Glasfjord (Wermland), Ifösee (Schonen), Asplangen- und Motalasee
(Oester-Götland), Wenersee, Alkvettern (Nerike), Gräfsee (Kalmar Län), Oestfora (Upland), Westlandaholm
(Westmanland).
RUSSLAND. Kubinskojesee (Gouv. Wologda, Zykoff ’06); Piroß-, Smeino-, Kolomnosee (Linko ’01, I); Onegasee
(Linko ’99,1 u. II); B. c. monstrosaim See Piroß (Umgebung von Bologoe) und B. c. Warpachowskii im Ilmensee
(Linko ’01, II und ’03,1).
FINNLAND. Nur im südlichen Finnland in der weiteren Umgebung von Helsingfors gefunden. F. striata im
Hvitträsk und Lohijärvi und in der Esbobucht (Finnischer Meerbusen) Stenross ’95, Levander ’00, II. Ferner
§|jgm Tuusula- und Lojosee (Levander ’00, II) und im Humaljärvi (Levander ’06,111).
5. Subspezies: B. c. thersites Poppe2).
(Tab. IV; Fig. 48—60).
Syn. B. gibbera var. Thersites Poppe (’87) in Zacbarias (’87,1).
Non. Syn. B. c. var. thersites Lilljeborg (’01).
forma typica:
S o m m e r f o r m Tab. IV, 1—5; Fig. 48, 50, 51.
Die ausgewachsenen Sommerweibchen dieser Subspezies unterscheiden sich von denen der
nahestehenden B. c. gibbera dadurch, daß die S p i t z e des auch hier vorhandenen Bu c k e l s
(P == ca* 1110 1400, Max. 1480) nicht über der Mitte der Längsachse liegt, sondern mehr oder
weniger weit r ü c k w ä r t s v e r l a g e r t ist. Und zwar liegt dieselbe im Extrem beinahe um
y2 T hinter dem caudalen Schalenrand. Der ganze B u c k e l erscheint dann h a k e n f ö rmi g
gekrümmt. Von diesem Extrem finden sich alle Übergänge zu Formen, bei denen die Buckelspitze
weniger weit nach hinten, z. B. gerade über der dorsocaudalen Schalenecke liegt, und weiterhin
auch zu B. c. gibbera. Der vordere, von der flachen Stirn emporsteigende Dorsalkontur ist flach
oder konkav. Form und Verlauf des hinteren Dorsalkonturs richtet sich nach der Lage der Buckelspitze.
Die ventrocaudale Schalenecke ist meist abgerundet ; die dorsocaudale Ecke nur selten bemerkbar
, da der hintere Dorsalkontur meist die gradlinige Verlängerung des niedrigen caudalen
Schalenrandes bildet. O ca. 60—90, Rostrum lang (Alj§B = 160—190). 1. A n t e n n e (24—34
Incisuren) stets sehr lang (C + D = 1000—1200); nur bei nicht voll ausgewachsenen Weibchen
senkrecht nach unten gerichtet, bei ausgewachsenen gleichmäßig schwach, selten stärker gekrümmt.
Pr. von 0 bis über 1000 variierend. Die K o p f s c h a l e erstreckt sich (im Unterschiede zu
1) Zacharias, der (’87) eine Planktonliste des Eutiner Sees gab, meldet diese Form nicht; ich fand sie jedoch auch in dem
Zacharias’schen Material im Zool. Inst, der Universität Berlin.
*) Die Temporalvariation behandele ich auf pag. 89 f, Abbildungen bei Poppe (’87), Zacharias (’87 , 1, II), Seligo (’07),
Keilhack (’04, ’08, ’09, II).