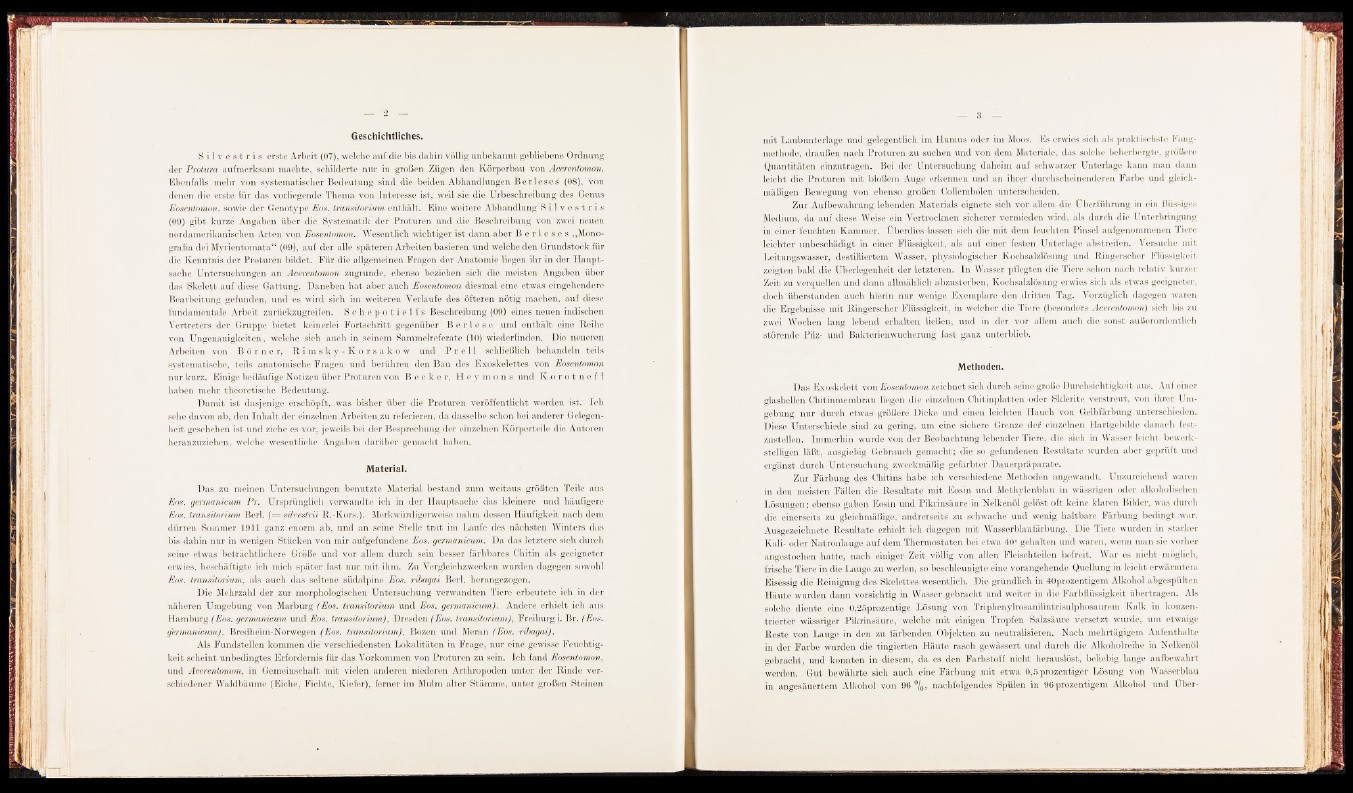
Geschichtliches.
S i l v e s t r i s erste Arbeit (07), welche auf die bis dahin völlig unbekannt gebliebene Ordnung
der Protura aufmerksam machte, schilderte nur in großen Zügen den Körperbau von Acerentomon.
Ebenfalls mehr von systematischer Bedeutung sind die beiden Abhandlungen B e r le s es (08), von
denen die erste für das vorliegende Thema von Interesse ist, weil sie die Urbeschreibung des Genus
Eosentomon, sowie der Genotype Eos. transitorium enthält. Eine weitere Abhandlung S i l v e s t r i s
(09) gibt kurze Angaben über die Systematik der Proturen und die Beschreibung von zwei neuen
nordamerikanischen Arten von Eosentomon. Wesentlich wichtiger ist dann aber B e r l e s e s „Monografía
dei Myrientomata“ (09), auf der alle späteren Arbeiten basieren und welche den Grundstock für
die Kenntnis der Proturen bildet. Für die allgemeinen Fragen der Anatomie liegen ihr in der Hauptsache
Untersuchungen an Acerentomon zugrunde, ebenso beziehen sich die meisten Angaben über
das Skelett auf diese Gattung. Daneben hat aber auch Eosentomon diesmal eine etwas eingehendere
Bearbeitung gefunden, und es wird sich im weiteren Verlaufe des öfteren nötig machen, auf diese
fundamentale Arbeit zurückzugreifen. S c h e p o t i e f f s Beschreibung (09) eines neuen indischen
Vertreters der Gruppe bietet keinerlei Fortschritt gegenüber B e r l e s e und enthält eine Reihe
von Ungenauigkeiten, welche sich auch in seinem Sammelreferate (10) wiederfinden. Die neueren
Arbeiten von B ö r n e r , R i m s k y - K o r s a k o w und P r e l l schließlich behandeln teils
systematische, teils anatomische Fragen und berühren den Bau des Exoskelettes von Eosentomon
nur kurz. Einige beiläufige Notizen über Proturen von B e c k e r , H e y m o n s und K o r o t n e f f
haben mehr theoretische Bedeutung.
Damit ist dasjenige erschöpft, was bisher über die Proturen veröffentlicht worden ist. Ich
sehe davon ab, den Inhalt der einzelnen Arbeiten zu referieren, da dasselbe schon bei anderer Gelegenheit
geschehen ist und ziehe es vor, jeweils bei der Besprechung der einzelnen Körperteile die Autoren
heranzuziehen, welche wesentliche Angaben darüber gemacht haben.
Material.
Das zu meinen Untersuchungen benutzte Material bestand zum weitaus größten Teile aus
Eos. germanicum Pr. Ursprünglich verwandte ich in der Hauptsache das kleinere und häufigere
Eos. transitorium Berl. (= süvestrii R.-Kors.). Merkwürdigerweise nahm dessen Häufigkeit nach dem
dürren Sommer 1911 ganz enorm ab, und an seine Stelle tra t im Laufe des nächsten Winters das
bis dahin nur in wenigen Stücken von mir aufgefundene Eos. germanicum. Da das letztere sich durch
seine etwas beträchtlichere Größe und vor allem durch sein besser färbbares Chitin als geeigneter
erwies, beschäftigte ich mich später fast nur mit ihm. Zu Vergleichzwecken wurden dagegen sowohl
Eos. transitorium, als auch das seltene südalpine Eos. ribagai Berl. herangezogen.
Die Mehrzahl der zur morphologischen Untersuchung verwandten Tiere erbeutete ich in der
näheren Umgebung von Marburg (Eos. transitorium und Eos. germanicum). Andere erhielt ich aus
Hamburg (Eos. germanicum und Eos. transitorium), Dresden (Eos. transitorium), Freiburg i. Br. (Eos.
germanicum), Bredheim-Norwegen (Eos. transitorium), Bozen und Meran (Eos. ribagai).
Als Fundstellen kommen die verschiedensten Lokalitäten in Frage, nur eine gewisse Feuchtigkeit
scheint unbedingtes Erfordernis für das Vorkommen von Proturen zu sein. Ich fand Eosentomon,
und Acerentomon, in Gemeinschaft mit vielen anderen niederen Arthropoden unter der Rinde verschiedener
Waldbäume (Eiche, Fichte, Kiefer), ferner im Mulm alter Stämme, unter großen Steinen
mit Laubunterlage und gelegentlich im Humus oder im Moos. Es erwies sich als praktischste Fang-
methode, draußen nach Proturen zu suchen und von dem Materiale, das solche beherbergte, größere
Quantitäten einzutragen. Bei der Untersuchung daheim auf schwarzer Unterlage kann man dann
leicht die Proturen mit bloßem Auge erkennen und an ihrer durchscheinenderen Farbe und gleichmäßigen
Bewegung von ebenso großen Collembolen unterscheiden.
Zur Aufbewahrung lebenden Materials eignete sich vor allem die Überführung in ein flüssiges
Medium, da auf diese Weise ein Vertrocknen sicherer vermieden wird, als durch die Unterbringung
in einer feuchten Kammer. Überdies lassen sich die mit dem feuchten Pinsel aufgenommenen Tiere
leichter unbeschädigt in einer Flüssigkeit, als auf einer festen Unterlage abstreifen. Versuche mit
Leitungswasser, destilliertem Wasser, physiologischer Kochsalzlösung und Ringerscher Flüssigkeit
zeigten bald die Überlegenheit der letzteren. In Wasser pflegten die Tiere schon nach relativ kurzer
Zeit zu verquellen und dann allmählich abzusterben, Kochsalzlösung erwies sich als etwas geeigneter,
doch überstanden auch hierin nur wenige Exemplare den dritten Tag. Vorzüglich dagegen waren
die Ergebnisse mit Ringerscher Flüssigkeit, in welcher die Tiere (besonders Acerentomon) sich bis zu
zwei Wochen lang lebend erhalten ließen, und in der vor allem auch die sonst außerordentlich
störende Pilz- und Bakterienwucherung fast ganz unterblieb.
Methoden.
Das Exoskelett von Eosentomon zeichnet sich durch seine große Durchsichtigkeit aus. Auf einer
glashe llen Chitinmembran liegen die einzelnen Chitinplatten oder Sklerite verstreut, von ihrer Umgebung
nur durch etwas größere Dicke und einen leichten Hauch von Gelbfärbung unterschieden.
Diese Unterschiede sind zu gering, um eine sichere Grenze der einzelnen Hartgebilde danach festzustellen.
Immerhin wurde von der Beobachtung lebender Tiere, die sich in Wasser leicht bewerkstelligen
läßt, ausgiebig Gebrauch gemacht; die so gefundenen Resultate wurden aber geprüft und
ergänzt durch Untersuchung zweckmäßig gefärbter Dauerpräparate.
Zur Färbung des Chitins habe ich verschiedene Methoden angewandt. Unzureichend waren
in den meisten Fällen die Resultate mit Eosin und Methylenblau in wässrigen oder alkoholischen
Lösungen; ebenso gaben Eosin und Pikrinsäure in Nelkenöl gelöst oft keine klaren Bilder, was durch
die einerseits zu gleichmäßige, andrerseits zu schwache und wenig haltbare Färbung bedingt war.
Ausgezeichnete Resultate erhielt ich dagegen mit Wasserblaufärbung. Die Tiere wurden in starker
Kali- oder Natronlauge auf dem Thermostaten bei etwa 40° gehalten und waren, wenn man sie vorher
angestochen hatte, nach einiger Zeit völlig von allen Fleischteilen befreit. War es nicht möglich,
frische Tiere in die Lauge zu werfen, so beschleunigte eine vorangehende Quellung in leicht erwärmtem
Eisessig die Reinigung des Skelettes wesentlich. Die gründlich in 40prozentigem Alkohol abgespülten
Häute wurden dann vorsichtig in Wasser gebracht und weiter in die Farbflüssigkeit übertragen. Als
solche diente eine 0,25prozentige Lösung von Triphenylrosanilintrisulphosaurem Kalle in konzentrierter
wässriger Pikrinsäure, welche mit einigen Tropfen Salzsäure versetzt wurde, um etwaige
Reste von Lauge in den zu färbenden Objekten zu neutralisieren. Nach mehrtägigem Aufenthalte
in der Farbe wurden die tingierten Häute rasch gewässert und durch die Alkoholreihe in Nelkenöl
gebracht, und konnten in diesem, da es den Farbstoff nicht herauslöst, beliebig lange aufbewahrt
werden. Gut bewährte sich auch eine Färbung mit etwa 0,5 prozentiger Lösung von Wasserblau
in angesäuertem Alkohol von 96 °/0, nachfolgendes Spülen in 96prozentigem Alkohol und Über