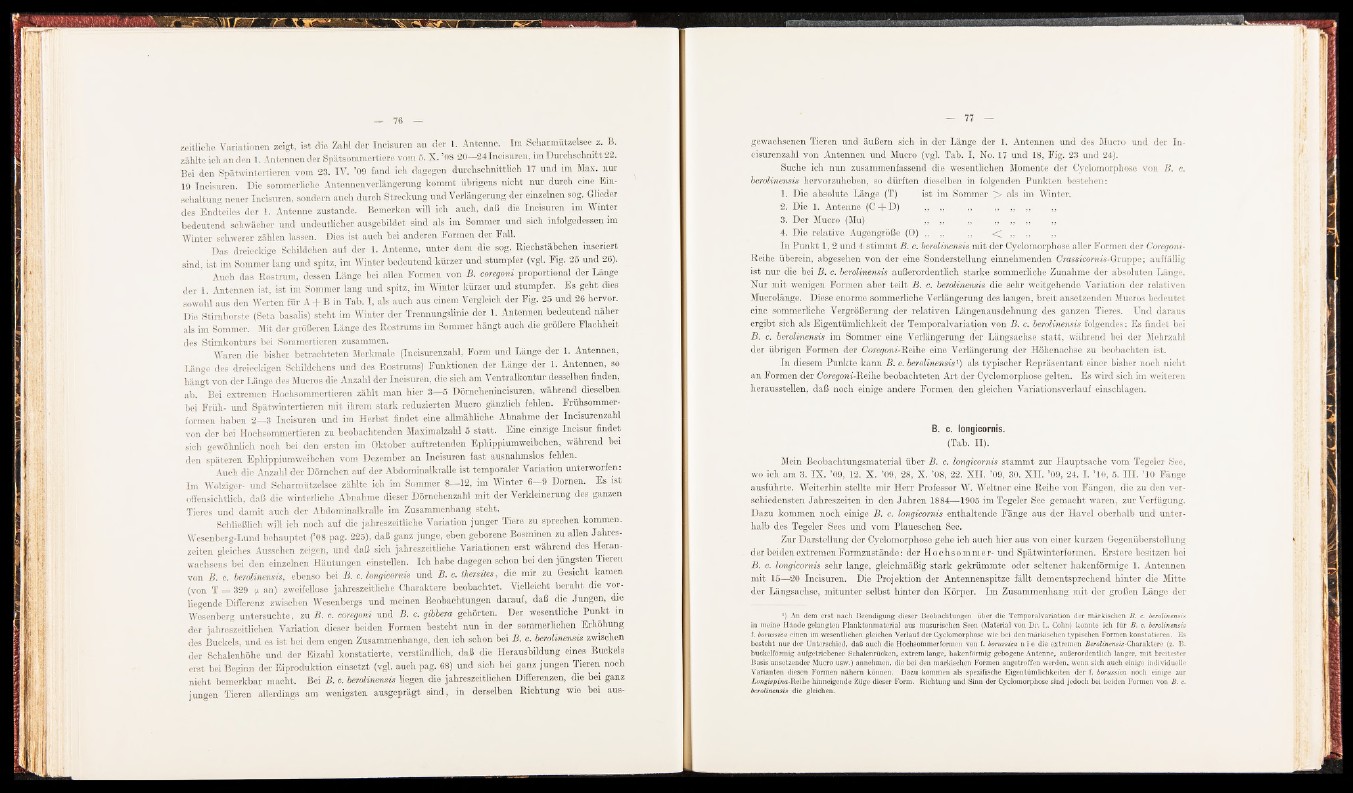
zeitliche Variationen zeigt, ist die Zahl der Incisuren an der 1. Antenne. Im Scharmntzelsee z. B.
zählte ich an den 1. Antennen der Spätsommertieie vom 6. X. ’08 20—24 Incisuren, im Durchschnitt 22.
Bei den Spätwintertieren vom 23. IV. ’09 fand ich dagegen durchschnittlich 17 und im Max. nur
19 Incisuren. Die sommerliche Antennenverlängerung kommt übrigens nicht nur durch eine Einschaltung
neuer Incisuren, sondern auch durch Streckung und Verlängerung der einzelnen sog. Glieder
des Endteiles der 1. Antenne zustande. Bemerken will ich auch, daß die Incisuren im Winter
bedeutend schwächer und undeutlicher ausgebildet sind als im Sommer und sich infolgedessen im
Winter schwerer zählen lassen. Dies ist auch bei anderen Formen der Fall.
Das dreieckige Schildchen auf der 1. Antenne, unter dem die sog. Riechstäbchen inseriert
sind, ist im Sommer lang und spitz, im Winter bedeutend kürzer und stumpfer (vgl. Fig. 25 und 28).
Auch das Rostrum, dessen Länge bei allen Formen von B. eor^cmiU proportional der Länge
der 1. Antennen ist, ist im Sommer lang und spitz, im Winter kürzer und stumpfer. Es geht dies
sowohl aus den Werten für A + B in Tab. I, als auch aus einem Vergleich der Fig. 25 und 26 hervor.
Die Stimborste (Seta basalis) steht im Winter der Trennungsiinie der 1. Antennen bedeutend näher
als im Sommer Mit der größeren Länge des Rostrums im Sommer hängt auch die größere Flachheit
des Stirnkonturs bei Sommertieren zusammen.
Waren die bisher betrachteten Merlanale (Incisurenzahl, Form und Länge der 1. Antennen,
Länge des dreieckigen Schildchens und des Rostrums) Funktionen der Länge der 1. Antennen, so
hängt von der Länge des Mucros die Anzahl der Incisuren, die sich am Ventralkontur desselben finden,
ab. Bei extremen Hochsommertieren zählt man hier 3—5 Dömchenincisuren, während dieselben
bei Früh- und Spätwintertieren mit ihrem stark reduzierten Mucro gänzlich fehlen. Fruhsommer-
formen haben 2—3 Incisuren und im Herbst findet eine allmähliche Abnahme der Incisurenzahl
von der bei Hochsommertieren zu beobachtenden Maximalzahl 5 statt. Eine einzige Incisur findet
sich gewöhnlich noch bei den ersten im Oktober auftretenden Ephippiumweibchen, während bei
den späteren Ephippiumweibchen vom Dezember an Incisuren fast ausnahmslos fehlen.
Auch die Anzahl der Dörnchen auf der Abdominalkralle ist temporaler Variation unterworfen:
Im Wolziger- und Scharmützelsee zählte ich im Sommer 8—12, im Winter 6—9 Dornen. Es ist
offensichtlich, daß die winterliche Abnahme dieser Dömehenzahl mit der Verkleinerung des ganzen
Tieres und damit auch der Abdominalkralle im Zusammenhang steht.
Schließlich will ich noch auf die jahreszeitliche Variation junger Tiere zu sprechen kommen.
Wesenberg-Lund behauptet (’08 pag. 225), daß ganz junge, eben geborene Bosminen zu allen Jahreszeiten
gleiches Aussehen zeigen, und daß sich jahreszeitliche Variationen erst während des Heranwachsens
bei den einzelnen Häutungen einstellen. Ich habe dagegen schon bei den jüngsten Tieren
von B. e. berolinensis, ebenso bei B. c. longicornis und B. c. thersites, die mir zu Gesicht kamen
(von T 8 3 2 9 n an) zweifellose jahreszeitliche Charaktere beobachtet. Vielleicht beruht die vorliegende
Differenz zwischen Wesenbergs und meinen Beobachtungen darauf, daß die Jungen, die
Wesenberg untersuchte, zu B. c. coregoni und B. c. gibbera gehörten. Der wesentliche Punkt in
der jahreszeitlichen Variation dieser beiden Formen besteht nun in der sommerlichen Erhöhung
des Buckels, und es ist bei dem engen Zusammenhänge, den ich schon bei B. c. berolmmsis zwischen
der Schalenhöhe und der Eizahl konstatierte, verständlich, daß die Herausbildung eines Buckels
erst bei Beginn der Eiproduktion einsetzt (vgl. auch pag. 68) und sich bei ganz jungen Tieren noch
nicht bemerkbar macht. Bei B. c. berolmensis liegen die jahreszeitlichen Differenzen, die bei ganz
jungen Tieren allerdings am wenigsten ausgeprägt sind, in derselben Richtung wie bei ausgewachsenen
Tieren und äußern sich in der Länge der 1. Antennen und des Mucro und der Incisurenzahl
von Antennen und Mucro (vgl. Tab. I, No. 17 und 18, Fig. 23 und 24).
Suche ich nun zusammenfassend die wesentlichen Momente der Cyclomorphose von B. c.
berolinensis hervorzuheben, so dürften dieselben in folgenden Punkten bestehen:
1. Die absolute Länge (T) ist im Sommer jp als im Winter.
2. Die 1. Antenne (C + D) „ „ „ „ „ ,, „
3. Der Mucro (Mu) „ „ „ „ „ „ „
4. Die relative Augengröße (0) ,, ,, „ <C „ ,, „
In Punkt 1, 2 und 4 stimmt B. c. berolinensis mit der Cyclomorphose aller Formen der Coregoni-
Reihe überein, abgesehen von der eine Sonderstellung einnehmenden Crassicornis-Gnn^e; auffällig
ist nur die bei B. c. berolinensis außerordentlich starke sommerliche Zunahme der absoluten Länge.
Nur mit wenigen Formen aber teilt B. c. berolinensis die sehr weitgehende Variation der relativen
Mucrolänge. Diese enorme sommerliche Verlängerung des langen, breit ansetzenden Mucros bedeutet
eine sommerliche Vergrößerung der relativen Längenausdehnung des ganzen Tieres. Und daraus
ergibt sich als Eigentümlichkeit der Temporalvariation von B. c. berolinensis folgendes: Es findet bei
B. c. berolinensis im Sommer eine Verlängerung der Längsachse statt, während bei der Mehrzahl
der übrigen Formen der Coregoni-Beihe eine Verlängerung der Höhenachse zu beobachten ist.
In diesem Punkte kann B. c. berolinensis1) als typischer Repräsentant einer bisher noch nicht
an Formen der Coregoni-Beihe beobachteten Art der Cyclomorphose gelten. Es wird sich im weiteren
herausstellen, daß noch einige andere Formen den gleichen Variationsverlauf einschlagen.
B. c. longicornis.
(Tab. II).
Mein Beobachtungsmaterial über B. c. longicornis stammt zur Hauptsache vom Tegeler See,
wo ich am 3. IX. ’09, 12. X. ’09, 28, X. ’08, 22. XII. ’09, 30. XII. ’09, 24. I. ’10, 5. III. ’10 Fänge
ausführte. Weiterhin stellte mir Herr Professor W. Weltner eine Reihe von Fängen, die zu den verschiedensten
Jahreszeiten in den Jahren 1884—1905 im Tegeler See gemacht waren, zur Verfügung.
Dazu kommen noch einige B. c. longicornis enthaltende Fänge aus der Havel oberhalb und unterhalb
des Tegeler Sees und vom Plaueschen See.
Zur Darstellung der Cyclomorphose gehe ich auch hier aus von einer kurzen Gegenüberstellung
der beiden extremen Formzustände: der Hochsommer - und Spätwinterformen. Erstere besitzen bei
B. c. longicornis sehr lange, gleichmäßig stark gekrümmte oder seltener hakenförmige 1. Antennen
mit 15—20 Incisuren. Die Projektion der Antennenspitze fällt dementsprechend hinter die Mitte
der Längsachse, mitunter selbst hinter den Körper. Im Zusammenhang mit der großen Länge der
*) An dem erst nach Beendigung dieser Beobachtungen über die Temporalvariation der märkischen B. c. berolinensis
in meine Hände gelangten Planktonmaterial aus masurischen Seen (Material von Dr. L. Cohn) konnte ich für B. c. berolinensis
f. borussica einen im wesentlichen gleichen Verlauf der Cyclomorphose wie bei den märkischen typischen Formen konstatieren. Es
besteht nur der Unterschied, daß auch die Hochsommerformen von f. borussica n i e die extremen Berolinensis-Chaiaktere (z. B.
buckelförmig aufgetriebener Schalenrücken, extrem lange, hakenförmig gebogene Antenne, außerordentlich langer, m it breitester
Basis ansetzender Mucro usw.) annehmen, die bei den märkischen Formen angetroffen werden, wenn sich auch einige individuelle
Varianten diesen Formen nähern können. Dazu kommen als spezifische Eigentümlichkeiten der f. borussica noch einige zur
Longispina-Reihe hinneigende Züge dieser Form. Richtung und Sinn der Cyclomorphose sind jedoch bei beiden Formen von B. c.
berolinensis die gleichen.