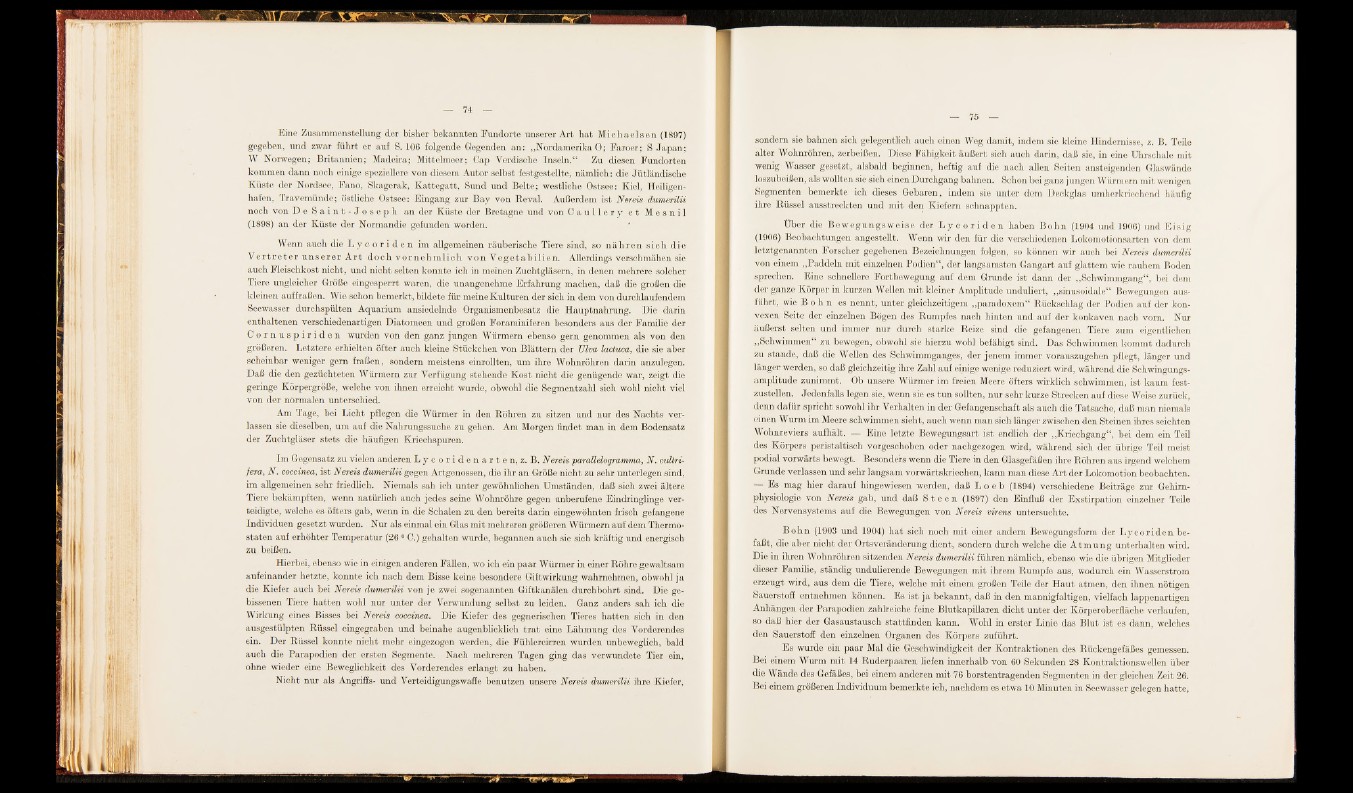
Eine Zusammenstellung der bisher bekannten Fundorte unserer Art hat Mi c h a e l s e n (1897)
gegeben, und zwar führt er auf S. 106 folgende Gegenden an: „Nordamerika 0 ; Faroer; S Japan;
W Norwegen; Britannien; Madeira; Mittelmeer; Cap Verdische Inseln.“ Zu diesen Fundorten
kommen dann noch einige speziellere von diesem Autor selbst festgestellte, nämlich: die Jütländische
Küste der Nordsee, Fano, Skagerak, Kattegatt, Sund und Belte; westliche Ostsee: Kiel, Heiligenhafen,
Travemünde; östliche Ostsee: Eingang zur Bay von Reval. Außerdem ist Nereis dumerüii
noch von D e S a i n t - J o s e p h an der Küste der Bretagne und von C a u l l e r y e t M e s n i l
(1898) an der Küste der Normandie gefunden worden.
Wenn auch die L y c o r i d e n im allgemeinen räuberische Tiere sind, so nä h r e n sich die
Ve r t r e t e r uns e r e r Ar t doch v o rnehml i c h von Vege tabi l ien. Allerdings verschmähen sie
auch Fleischkost nicht, und nicht selten konnte ich in meinen Zuchtgläsern, in denen mehrere solcher
Tiere ungleicher Größe eingesperrt waren, die unangenehme Erfahrung machen, daß die großen die
kleinen auffraßen. Wie schon bemerkt, bildete für meine Kulturen der sich in dem von durchlaufendem
Seewasser durchspülten Aquarium ansiedelnde Organismenbesatz die Hauptnahrung. Die darin
enthaltenen verschiedenartigen Diatomeen und großen Foraminiferen besonders aus der Familie der
C o r n u s p i r i d e n wurden von den ganz jungen Würmern ebenso gern genommen als von den
größeren. Letztere erhielten öfter auch kleine Stückchen von Blättern der XJlva lactuca, die sie aber
scheinbar weniger gern fraßen, sondern meistens einrollten, um ihre Wohnröhren darin anzulegen.
Daß die den gezüchteten Würmern zur Verfügung stehende Kost nicht die genügende war, zeigt die
geringe Körpergröße, welche von ihnen erreicht wurde, obwohl die Segmentzahl sich wohl nicht viel
von der normalen unterschied.
Am Tage, bei Licht pflegen die Würmer in den Röhren zu sitzen und nur des Nachts verlassen
sie dieselben, um auf die Nahrungssuche zu gehen. Am Morgen findet man in dem Bodensatz
der Zuchtgläser stets die häufigen Kriechspuren.
Im Gegensatz zu vielen anderen L y c o r i d e n a r t e n , z. B. Nereis parallelogramma, N. cultri-
fera, N. coccinea, ist Nereis dumerüii gegen Artgenossen, die ihr an Größe nicht zu sehr unterlegen sind,
im allgemeinen sehr friedlich. Niemals sah ich unter gewöhnlichen Umständen, daß sich zwei ältere
Tiere bekämpften, wenn natürlich auch jedes seine Wohnröhre gegen unberufene Eindringlinge verteidigte,
welche es öfters gab, wenn in die Schalen zu den bereits darin eingewöhnten frisch gefangene
Individuen gesetzt wurden. Nur als einmal ein Glas mit mehreren größeren Würmern auf dem Thermostaten
auf erhöhter Temperatur (26 0 C.) gehalten wurde, begannen auch sie sich kräftig und energisch
zu beißen.
Hierbei, ebenso wie in einigen anderen Fällen, wo ich ein paar Würmer in einer Röhre gewaltsam
aufeinander hetzte, konnte ich nach dem Bisse keine besondere Giftwirkung wahrnehmen, obwohl ja
die Kiefer auch bei Nereis dumerüii von je zwei sogenannten Giftkanälen durchbohrt sind. Die gebissenen
Tiere hatten wohl nur unter der Verwundung selbst zu leiden. Ganz anders sah ich die
Wirkung eines Bisses bei Nereis coccinea. Die Kiefer des gegnerischen Tieres hatten sich in den
ausgestülpten Rüssel eingegraben und beinahe augenblicklich tra t eine Lähmung des Vorderendes
ein. Der Rüssel konnte nicht mehr eingezogen werden, die Fühlercirren wurden unbeweglich, bald
auch die Parapodien der ersten Segmente. Nach mehreren Tagen ging das verwundete Tier ein,
ohne wieder eine Beweglichkeit des Vorderendes erlangt zu haben.
Nicht nur als Angriffs- und Verteidigungswaffe benutzen unsere Nereis dumerüii ihre Kiefer,
sondern sie bahnen sich gelegentlich auch einen Weg damit, indem sie kleine Hindernisse, z. B. Teile
alter Wohnröhren, zerbeißen. Diese Fähigkeit äußert sich auch darin, daß sie, in eine Uhrschale mit
wenig Wasser gesetzt, alsbald beginnen, heftig auf die nach allen Seiten ansteigenden Glaswände
loszubeißen, als wollten sie sich einen Durchgang bahnen. Schon bei ganz jungen Würmern mit wenigen
Segmenten bemerkte ich dieses Gebaren, indem sie unter dem Deckglas umherkriechend häufig
ihre Rüssel ausstreckten und mit den Kiefern schnappten.
Über die Bewegungswei s e der L y c o r i d e n haben Bohn (1904 und 1906) und Eisi g
(1906) Beobachtungen angestellt. Wenn wir den für die verschiedenen Lokomotionsarten von dem
letztgenannten Forscher gegebenen Bezeichnungen folgen, so können wir auch bei Nereis dumerüii
von einem „Paddeln mit einzelnen Podien“, der langsamsten Gangart auf glattem wie rauhem Boden
sprechen. Eine schnellere Fortbewegung auf dem Grunde ist dann der „Schwimmgang“, bei dem
der ganze Körper in kurzen Wellen mit kleiner Amplitude unduliert, „sinusoidale“ Bewegungen ausführt,
wie B o h n es nennt, unter gleichzeitigem „paradoxem“ Rückschlag der Podien auf der konvexen
Seite der einzelnen Bögen des Rumpfes nach hinten und auf der konkaven nach vorn. Nur
äußerst selten und immer nur durch starke Reize sind die gefangenen Tiere zum eigentlichen
„Schwimmen“ zu bewegen, obwohl sie hierzu wohl befähigt sind. Das Schwimmen kommt dadurch
zu Stande, daß die Wellen des Schwimmganges, der jenem immer vorauszugehen pflegt, länger und
länger werden, so daß gleichzeitig ihre Zahl auf einige wenige reduziert wird, während die Schwingungsamplitude
zunimmt. Ob unsere Würmer im freien Meere öfters wirklich schwimmen, ist kaum festzustellen.
Jedenfalls legen sie, wenn sie es tun sollten, nur sehr kurze Strecken auf diese Weise zurück,
denn dafür spricht sowohl ihr Verhalten in der Gefangenschaft als auch die Tatsache, daß man niemals
einen Wurm im Meere schwimmen sieht, auch wenn man sich länger zwischen den Steinen ihres seichten
Wohnreviers auf hält. — Eine letzte Bewegungsart ist endlich der „Kriechgang“, bei dem ein Teil
des Körpers peristaltisch vorgeschoben oder nachgezogen wird, während sich der übrige Teil meist
podial vorwärts bewegt. Besonders wenn die Tiere in den Glasgefäßen ihre Röhren aus irgend welchem
Grunde verlassen und sehr langsam vorwärtskriechen, kann man diese Art der Lokomotion beobachten.
— Es mag hier darauf hingewiesen werden, daß L o e b (1894) verschiedene Beiträge zur Gehirnphysiologie
von Nereis gab, und daß S t e e n (1897) den Einfluß der Exstirpation einzelner Teile
des Nervensystems auf die Bewegungen von Nereis virens untersuchte.
Bohn (1903 und 1904) hat sich noch mit einer ändern Bewegungsform der Lyco r i d en befaßt,
die aber nicht der Ortsveränderung dient, sondern durch welche die Atm u n g unterhalten wird.
Die in ihren Wohnröhren sitzenden Nereis dumerüii führen nämlich, ebenso wie die übrigen Mitglieder
dieser Familie, ständig undulierende Bewegungen mit ihrem Rumpfe aus, wodurch ein Wasserstrom
erzeugt wird, aus dem die Tiere, welche mit einem großen Teile der Haut atmen, den ihnen nötigen
Sauerstoff entnehmen können. Es ist ja bekannt, daß in den mannigfaltigen, vielfach lappenartigen
Anhängen der Parapodien zahlreiche feine Blutkapillaren dicht unter der Körperoberfläche verlaufen,
so daß hier der Gasaustausch stattfinden kann. Wohl in erster Linie das Blut ist es dann, welches
den Sauerstoff den einzelnen Organen des Körpers zuführt.
Es wurde ein paar Mal die Geschwindigkeit der Kontraktionen des Rückengefäßes gemessen.
Bei einem Wurm mit 14 Ruderpaaren liefen innerhalb von 60 Sekunden 28 Kontraktionswellen über
die Wände des Gefäßes, bei einem anderen mit 76 borstentragenden Segmenten in der gleichen Zeit 26.
Bei einem größeren Individuum bemerkte ich, nachdem es etwa 10 Minuten in Seewasser gelegen hatte,