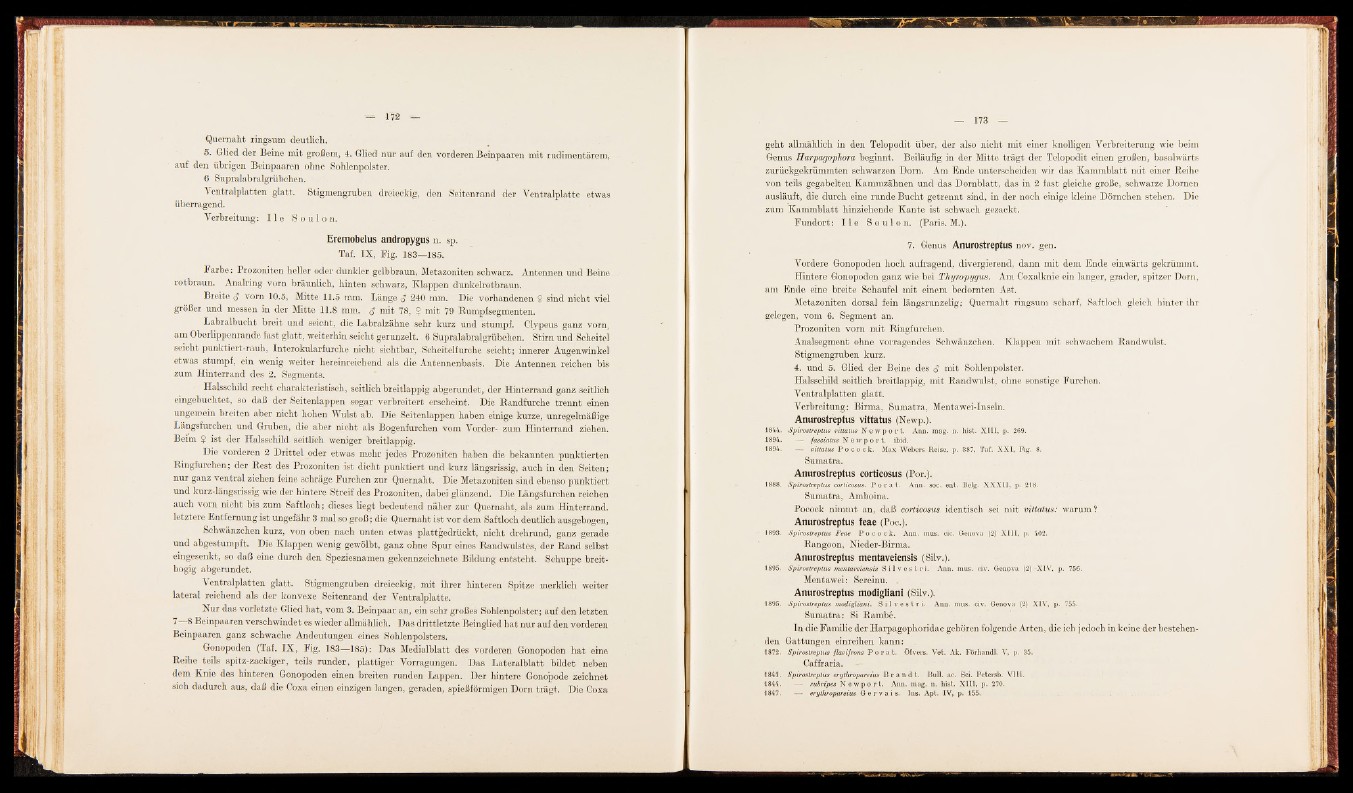
Quernaht ringsum deutlich.
5. Glied der Beine mit großem, 4. Glied nur auf den vorderen Beinpaaren mit rudimentärem,
auf den übrigen Beinpaaren ohne Sohlenpolster.
6 Supralabralgrübchen.
Ventralplatten glatt. Stigmengruben dreieckig, den Seitenrand der Ventralplatte etwas
überragend.
Verbreitung: I l e S o u l o n .
Eremobelus andropygus n. sp.
Taf. IX, Fig. 183—185.
Farbe: Prozoniten heller oder dunkler gelbbraun, Metazoniten schwarz, Antennen und Beine
rotbraun. Analring vorn bräunlich, hinten schwarz, Klappen dunkelrotbraun.
Breite vorn 10.5, Mitte-11.5 mm. Länge $ 240 mm. Die vorhandenen $ sind nicht viel
größer und messen in der Mitte 11.8 mm. $ mit 78, ° mit 79 Rumpfsegmenten.
Labralbucht breit und seicht, die Labralzähne sehr kurz und stumpf. Clypeus ganz vorn,
am Oberlippenrande fast glatt, weiterhin seicht gerunzelt. 6 Supralabralgrübchen. Stirn und Scheitel
seicht punktiert-rauh, Interokularfurche nicht sichtbar, Scheitelfurche seicht; innerer Augenwinkel
etwas stumpf, ein wenig weiter hereinreichend als die Antennenbasis. Die Antennen reichen bis
zum Hinterrand des 2. Segments.
Halsschild recht charakteristisch, seitlich breitlappig abgerundet, der Hinterrand ganz seitlich
eingebuchtet, so daß der Seitenlappen sogar verbreitert erscheint. Die Randfurche trennt einen
ungemein breiten aber nicht hohen Wulst ab. Die Seitenlappen haben einige kurze, unregelmäßige
Längsfurchen und Gruben, die aber nicht als Bogenfurchen vom Vorder- zum Hinterrand ziehen.
Beim $ ist der Halsschild seitlich weniger breitlappig.
Die vorderen 2 Drittel oder etwas mehr jedes Prozoniten haben die bekannten punktierten
Ringfurchen; der Rest des Prozoniten ist dicht punktiert und kurz längsrissig, auch in den Seiten;
nur ganz ventral ziehen feine schräge Furchen zur Quemaht. Die Metazoniten sind ebenso punktiert
und kurz-längsrissig wie der hintere Streif des Prozoniten, dabei glänzend. Die Längsfurchen reichen
auch vorn nicht bis zum Saftloch; dieses liegt bedeutend näher zur Quernaht, als zum Hinterrand,
letztere Entfernung ist ungefähr 3 mal so groß; die Quemaht ist vor dem Saftloch deutlich ausgebogen,
Schwänzchen kurz, von oben nach unten etwas plattgedrückt, nicht drehrund, ganz gerade
und abgestumpft. Die Klappen wenig gewölbt, ganz ohne Spur eines Randwulstes, der Rand selbst
eingesenkt, so daß eine durch den Speziesnamen gekennzeichnete Bildung entsteht. Schuppe breit-
bogig abgerundet.
Ventralplatten glatt. Stigmengruben dreieckig, mit ihrer hinteren Spitze merklich weiter
lateral reichend als der konvexe Seitenrand der Ventralplatte.
Nur das vorletzte Glied hat, vom 3. Beinpaar an, ein sehr großes Sohlenpolster; auf den letzten
7 8 Beinpaaren verschwindet es wieder allmählich. Das drittletzte Beinglied hat nur auf den vorderen
Beinpaaren ganz schwache Andeutungen eines Sohlenpolsters.
Gonopoden (Taf. IX , Fig. 183—185): Das Medialblatt des vorderen Gonopoden h.at eine
Reihe teils spitz-zackiger, teils runder, plattiger Vörragungen. Das Lateralblatt bildet neben
dem Knie des hinteren Gonopoden einen breiten runden Lappen. Der hintere Gonopode zeichnet
sich dadurch aus, daß die Coxa einen einzigen langen, geraden, spießförmigen Dorn trägt. Die Coxa
geht allmählich in den Telopodit über, der also nicht mit einer knolligen Verbreiterung wie beim
Genus Harpagophora beginnt. Beiläufig in der Mitte trägt der Telopodit einen großen, basalwärts
zurückgekrümmten schwarzen Dorn. Am Ende unterscheiden wir das Kammblatt mit einer Reihe
von teils gegabelten Kammzähnen und das Dornblatt, das in 2 fast gleiche große, schwarze Dornen
ausläuft, die durch eine runde Bucht getrennt sind, in der noch einige kleine Dörnchen stehen. Die
zum Kammblatt hinziehende Kante ist schwach gezackt.
Fundort: I l e S o u l o n . (Paris. M.).
7. Genus Anurostreptus nov. gen.
Vordere Gonopoden hoch aufragend, divergierend, dann mit dem Ende einwärts gekrümmt.
Hintere Gonopoden ganz wie bei Thyropygus. Am Coxalknie ein langer, grader, spitzer Dorn,
am Ende eine breite Schaufel mit einem bedornten Ast.
Metazoniten dorsal fein längsrunzelig; Quemaht ringsum scharf, Saftloch gleich hinter ihr
gelegen, vom 6. Segment an.
Prozoniten vorn mit Ringfurchen.
Analsegment ohne vorragendes Schwänzchen. Klappen mit schwachem Randwülst.
Stigmengruben kurz.
4. und 5. Glied der Beine des mit Sohlenpolster.
Halsschild seitlich breitlappig, mit Randwulst, ohne sonstige Furchen.
Ventralplatten glatt.
Verbreitung: Birma, Sumatra, Mentawei-Inseln.
Anurostreptus vittatus (Newp.).
1844. Spirostreptus vittatus N e w p o r t . Ann. mag. n. hist. X I II, p. 269.
1894. — fasciatus N e w p o r t , ibid.
1894. ||! | vittatus P o c o c k . Max Webers Reise, p. 387, Taf. XXI, Kg, 8.
Sumatra.
Anurostreptus corticosus (Por.-).
1888. Spirostreptus corticosus. P o r a t . Ann. soc. ent.-Belg. XXX II, p. 218.
Sumatra, Amboina.
Pocock nimmt an, daß corticosus identisch sei mit vittatus: warum?
Anurostreptus feae (Poe.).
1893. Spirostreptus Feae P o c o c k . Ann. mus. cic. Genova (2) X III, p\ 402.
Rangoon, Nieder-Birma.
Anurostreptus mentaveiensis (Silv.).
1895. Spirostreptus mentaveiensis ' S i l v e s t r A n n . mus. civ. Genova (2) -XIV, p. 756.
Mentawei: Sereinu. .
Anurostreptus modigliani (Silv.).
1895. Spirostreptus modigliani. S i l v e s t r i . Ann. mus. civ. Genova (2) XIV, p, 755,
Sumatra: Si Rambe.
In die Familie der Harpagophoridae gehören folgende Arten, die ich jedoch in keine der bestehenden
Gattungen einreihen kann:
1872. Spirostreptus flavifrons P o r a t . öfvers. Vet. Ak. Förfiandl. V, p. 35. ^
Caffraria.
1841. Spirostreptus erythropareius B r a n d t . Bull. ac. Sei. Petersb. VIII.
1844. — rubripes N e w p o r t . Ann. mag. n. hist. X III, p. 270.
1847. erythropareius G e r v a i s . Ins. Apt. IV, p. 155,