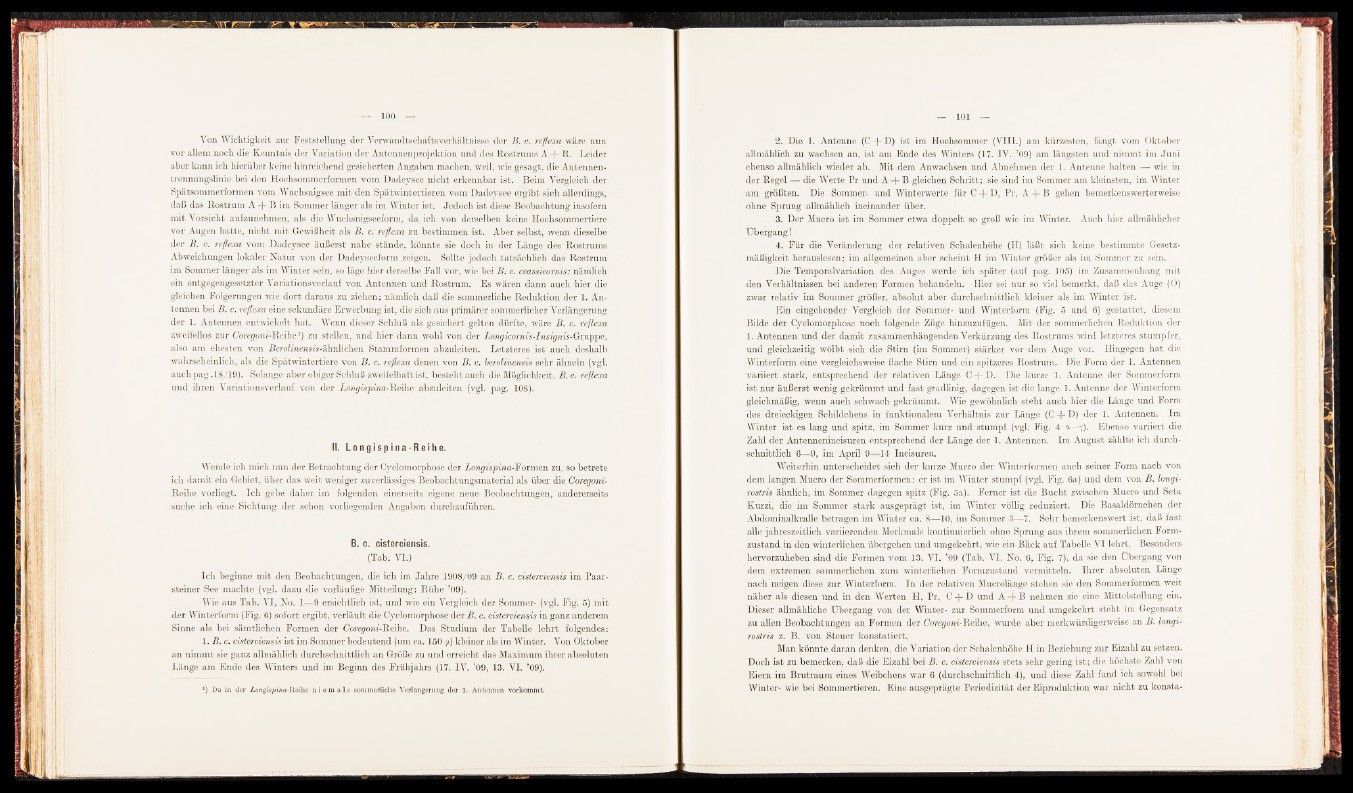
Von Wichtigkeit zur Feststellung der Verwandtschaftsverhältnisse der B. c. reflexa wäre nun
vor allem noch die Kenntnis der Variation der Antennenprojektion und des Rostrums A + B. Leider
aber kann ich hierüber keine hinreichend gesicherten Angaben machen, weil, wie gesagt, die Antennen-
trennungslinie bei den Hochsommerformen vom Dadeysee nicht erkennbar ist. Beim Vergleich der
Spätsommerformen vom Wuchsnigsee mit den Spätwintertieren vom Dadeysee ergibt sich allerdings,
daß das Rostrum A + B im Sommer länger als im Winter ist. Jedoch ist diese Beobachtung insofern
mit Vorsicht auf zunehmen, als die Wuchsnigseeform, da ich von derselben keine Hochsommertiere
vor Augen hatte, nicht mit Gewißheit als B. c. reflexa zu bestimmen ist. Aber selbst, wenn dieselbe
der B. c. reflexa vom Dadeysee äußerst nahe stände, könnte sie doch in der Länge des Rostrums
Abweichungen lokaler Natur von der Dadeyseeform zeigen. Sollte jedoch tatsächlich das Rostrum
im Sommer länger als im Winter sein, so läge hier derselbe Fall vor, wie bei B. c. crassicornis: nämlich
ein entgegengesetzter Variationsverlauf von Antennen und Rostrum. Es wären dann auch hier die
gleichen Folgerungen wie dort daraus zu ziehen; nämlich daß die sommerliche Reduktion der 1. Antennen
bei B. c. reflexa eine sekundäre Erwerbung ist, die sich aus primärer sommerlicher Verlängerung
der 1. Antennen entwickelt hat. Wenn dieser Schluß als gesichert gelten dürfte, wäre B. c. reflexa
zweifellos zur Coregww-Reihe1) zu stellen, und hier dann wohl von der Longicornis-Insignis-Giwppe,
also am ehesten von BeroZmewszs-ähnlichen Stammformen abzuleiten. Letzteres ist auch deshalb
wahrscheinlich, als die Spätwintertiere von B. c. reflexa denen von B. c. berolinensis sehr ähneln (vgl.
auch pag .18/19). Solange aber obiger Schluß zweifelhaft ist, besteht auch die Möglichkeit, B. c. reflexa
und ihren Variationsverlauf vou der Longispina-Reihe abzuleiten (vgl. pag. 108).
II. Long i spina -Re i h e .
Wende ich mich nun der Betrachtung der Cyclomorphose der Longispina-Formen zu, so betrete
ich damit ein Gebiet, über das weit weniger zuverlässiges Beobachtungsmaterial als über die Coregoni-
Reihe vorliegt. Ich gebe daher im folgenden einerseits eigene neue Beobachtungen, andererseits
suche ich eine Sichtung der schon vorhegenden Angaben durchzuführen.
B. c. cisterciensis.
(Tab. VI.)
Ich beginne mit den Beobachtungen, die ich im Jahre 1908/09 an B. c. cisterciensis im Paarsteiner
See machte (vgl. dazu die vorläufige Mitteilung: Rühe ’09).
Wie aus Tab. VI, No. 1—9 ersichtlich ist, und wie ein Vergleich der Sommer- (vgl. Fig. 5) mit
der Winterform (Fig. 6) sofort ergibt, verläuft die Cyclomorphose der B. c. cisterciensis in ganz anderem
Sinne als bei sämtlichen Formen der Coregoni-Reihe. Das Studium der Tabelle lehrt folgendes:
1. B. c. cisterciensis ist im Sommer bedeutend (um ca. 150 (j.) kleiner als im Winter. Von Oktober
an nimmt sie ganz allmählich durchschnittlich an Größe zu und erreicht das Maximum ihrer absoluten
Länge am Ende des Winters und im Beginn des Frühjahrs (17. IV. ’09, 13. VI. ’09).
x) Da in der Dongispma-Reihe n i e m a l s sommerliche Verlängerung d er 1. Antennen vorkommt.
2. Die 1. Antenne (C + D) ist im Hochsommer (VIII.) am kürzesten, fängt vom Oktober
allmählich zu wachsen an, ist am Ende des Winters (17. IV. ’09) am längsten und nimmt im Juni
ebenso allmählich wieder ab. Mit dem Anwachsen und Abnehmen der 1. Antenne halten — wie in
der Regel — die Werte Pr und A + B gleichen Schritt; sie sind im Sommer am kleinsten, im Winter
am größten. Die Sommer- und Winterwerte für C + D, Pr, A + B gehen bemerkenswerterweise
ohne Sprung allmählich ineinander über.
3. Der Mucro ist im Sommer etwa doppelt so groß wie im Winter. Auch hier allmählicher
Übergang!
4. Für die Veränderung der relativen Schalenhöhe (H) läßt sich keine bestimmte Gesetzmäßigkeit
herauslesen; im allgemeinen aber scheint H im Winter größer als im Sommer zu sein.
Die Temporalvariation des Auges werde ich später (auf pag. 105) im Zusammenhang mit
den Verhältnissen bei anderen Formen behandeln. Hier sei nur so viel bemerkt, daß das Auge (O)
zwar relativ im Sommer größer, absolut aber durchschnittlich kleiner als im Winter ist.
Ein eingehender Vergleich der Sommer- und Winterform (Fig. 5 und 6) gestattet, diesem
Bilde der Cyclomorphose noch folgende Züge hinzuzufügen. Mit der sommerlichen Reduktion der
1. Antennen und der damit zusammenhängendenVerkürzung des Rostrums wird letzteres stumpfer,
und gleichzeitig wölbt sich die Stirn (im Sommer) stärker vor dem Auge vor. Hingegen hat die
Winterform eine vergleichsweise flache Stirn und ein spitzeres Rostrum. Die Form der 1. Antennen
variiert stark, entsprechend der relativen Länge C + D. Die kurze 1. Antenne der Sommerform
ist nur äußerst wenig gekrümmt und fast gradlinig, dagegen ist die lange 1. Antenne der Winterform
gleichmäßig, wenn auch schwach gekrümmt. Wie gewöhnlich steht auch hier die Länge und Form
des dreieckigen Schildchens in funktionalem Verhältnis zur Länge (C + D) der 1. Antennen. Im
Winter ist es lang und spitz, im Sommer kurz und stumpf (vgl. Fig. 4 <*—t). Ebenso variiert die
Zahl der Antennenincisuren entsprechend der Länge der 1. Antennen. Im August zählte ich durchschnittlich
6—9, im April 9—14 Incisuren.
Weiterhin unterscheidet sich der kurze Mucro der Winterformen auch seiner Form nach von
dem langen Mucro der Sommerformen: er ist im Winter stumpf (vgl. Fig. 6a) und dem von B. longi-
rostris ähnlich, im Sommer dagegen spitz (Fig. 5a). Ferner ist die Bucht zwischen Mucro und Seta
Kurzi, die im Sommer stark ausgeprägt ist, im Winter völlig reduziert. Die Basaldörnchen der
Abdominalkralle betragen im Winter ca. 8—10, im Sommer 5—7. Sehr bemerkenswert ist, daß fast
alle jahreszeitlich variierenden Merkmale kontinuierlich ohne Sprung aus ihrem sommerlichen Formzustand
in den winterlichen übergehen und umgekehrt, wie ein Blick auf Tabelle VI lehrt. Besonders
hervorzuheben sind die Formen vom 13. VI. ’09 (Tab. VI, No. 6, Fig. 7), da sie den Übergang von
dem extremen sommerlichen zum winterlichen Formzustand vermitteln. Ihrer absoluten Länge
nach neigen diese zur Winterform. In der relativen Mucrolänge stehen sie den Sommerformen weit
näher als diesen und in den Werten H, Pr, C + D und A + B nehmen sie eine Mittelstellung ein.
Dieser allmähliche Übergang von der Winter- zur Sommerform und umgekehrt steht im Gegensatz
zu allen Beobachtungen an Formen der Coregrom-Reihe, wurde aber merkwürdigerweise an B. longi-
rostris z. B. von Steuer konstatiert.
Man könnte daran denken, die Variation der Schalenhöhe H in Beziehung zur Eizahl zu setzen.
Doch ist zu bemerken, daß die Eizahl bei B. c. cisterciensis stets sehr gering ist; die höchste Zahl von
Eiern im Brutraum eines Weibchens war 6 (durchschnittlich 4), und diese Zahl fand ich sowohl bei
Winter- wie bei Sommertieren. Eine ausgeprägte Periodizität der Eiproduktion war nicht zu konsta