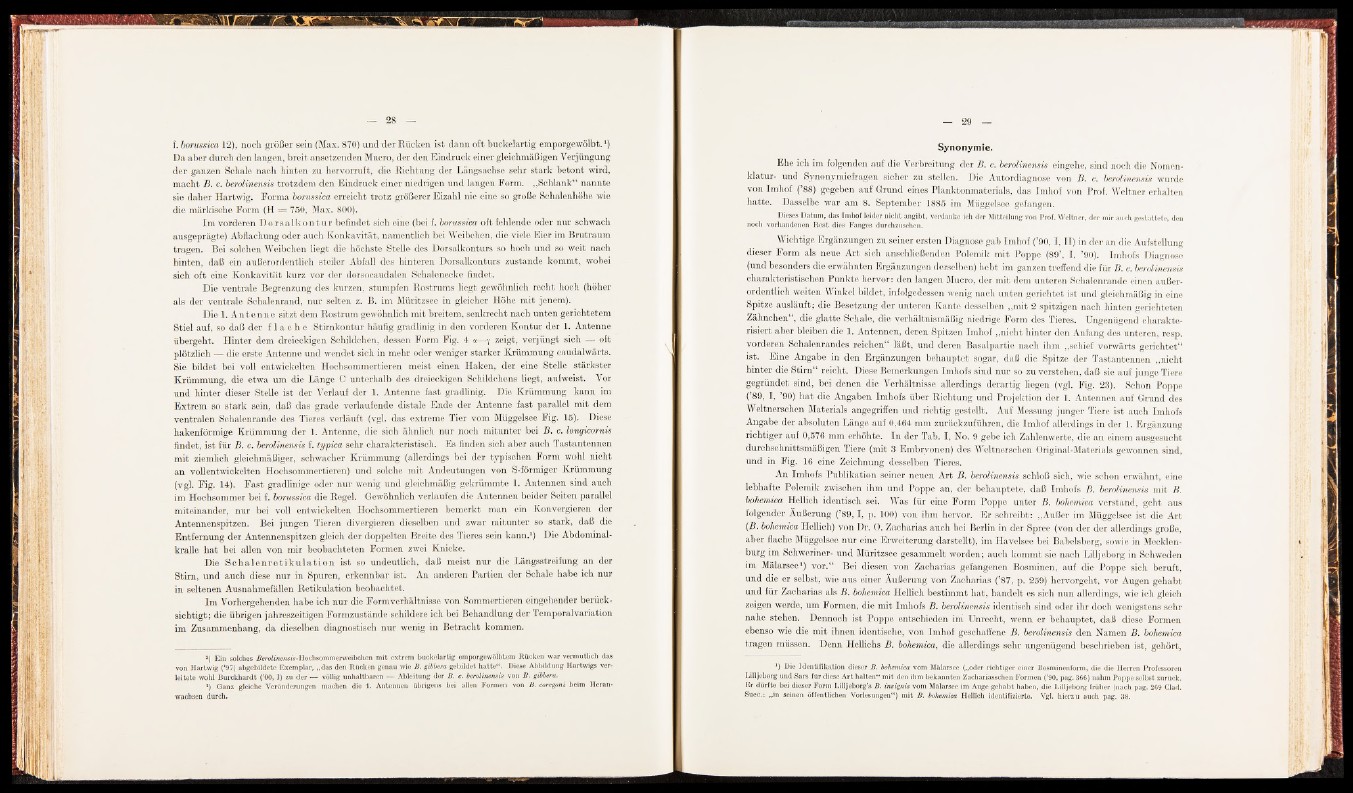
f. borussica 12), noch, größer sein (Max. 870) und der Rücken ist dann oft buckelartig emporgewölbt.1)
Da aber durch den langen, breit ansetzenden Mucro, der den Eindruck einer gleichmäßigen Verjüngung
der ganzen Schale nach hinten zu hervorruft, die Richtung der Längsachse sehr stark betont wird,
macht B. c. berolinensis trotzdem den Eindruck einer niedrigen und langen Form. „Schlank“ nannte
sie daher Hartwig. Forma borussica erreicht trotz größerer Eizahl nie eine so große Schalenhöhe wie
die märkische Form (H = 750, Max. 800).
Im vorderen Dor s a l kont ur befindet sich eine (bei f. borussica oft fehlende oder nur schwach
ausgeprägte) Abflachung oder auch Konkavität, namentlich bei Weibchen, die viele Eier im Brutraum
tragen. Bei solchen Weibchen liegt die höchste Stelle des Dorsalkonturs so hoch und so weit nach
hinten, daß ein außerordentlich steiler Abfall des hinteren Dorsalkonturs zustande kommt, wobei
sich oft eine Konkavität kurz vor der dorsocaudalen Schalenecke findet.
Die ventrale Begrenzung des kurzen, stumpfen Rostrums liegt gewöhnlich, recht hoch (höher
als der ventrale Schalenrand, nur selten z. B. im Müritzsee in gleicher Höhe mit jenem).
Die 1. Ant enne sitzt dem Rostrum gewöhnlich mit breitem, senkrecht nach unten gerichtetem
Stiel auf, so daß der f l a c h e Stirnkontur häufig gradlinig in den vorderen Kontur der 1. Antenne
übergeht. Hinter dem dreieckigen Schildchen, dessen Form Fig. 4 a—y zeigt, verjüngt sich — oft
plötzlich — die erste Antenne und wendet sich in mehr oder weniger starker Krümmung caudalwärts.
Sie bildet bei voll entwickelten Hochsommertieren meist einen Haken, der eine Stelle stärkster
Krümmung, die etwa um die Länge C unterhalb des dreieckigen Schildchens liegt, auf weist. Vor
und hinter dieser Stelle ist der Verlauf der 1. Antenne fast gradlinig. Die Krümmung kann im
Extrem so stark sein, daß das grade verlaufende distale Ende der Antenne fast parallel mit dem
ventralen Schalenrande des Tieres verläuft (vgl. das extreme Tier vom Müggelsee Fig. 15). Diese
hakenförmige Krümmung der 1. Antenne, die sich ähnlich nur noch mitunter bei B. c. longicornis
findet, ist für B. c. berolinensis f. typica sehr charakteristisch. Es finden sich aber auch Tastantennen
mit ziemlich gleichmäßiger, schwacher Krümmung (allerdings bei der typischen Form wohl nicht
an vollentwickelten Hochsommertieren) und solche mit Andeutungen von S-förmiger Krümmung
(vgl. Fig. 14). Fast gradlinige oder nur wenig und gleichmäßig gekrümmte 1. Antennen sind auch
im Hochsommer bei f. borussica die Regel. Gewöhnlich verlaufen die Antennen beider Seiten parallel
miteinander, nur bei voll entwickelten Hochsommertieren bemerkt man ein Konvergieren der
Antennenspitzen. Bei jungen Tieren divergieren dieselben und zwar mitunter so stark, daß die
Entfernung der Antennenspitzen gleich der doppelten Breite des Tieres sein kann.2) Die Abdominalkralle
hat bei allen von mir beobachteten Formen zwei Knicke.
Die Scha l enr e t ikul a t i on ist so undeutlich, daß meist nur die Längsstreifung an der
Stirn, und auch diese nur in Spuren, erkennbar ist. An anderen Partien der Schale habe ich nur
in seltenen Ausnahmefällen Retikulation beobachtet.
Im Vorhergehenden habe ich nur die Formverhältnisse von Sommertieren eingehender berücksichtigt;
die übrigen jahreszeitigen Formzustände schildere ich bei Behandlung der Temporalvariation
im Zusammenhang, da dieselben diagnostisch nur wenig in Betracht kommen.
i) Ein solches BeroZinerasis-Hochsommerweibchen m it extrem buckelartig emporgewölbtem Rücken war vermutlich das
von Hartwig (’97) abgebildete Exemplar, „das den Rücken genau wie B. gibbera gebildet h a tte “ . Diese Abbildung Hartwigs verleitete
wohl Burckha rdt (’0 0 ,1) zu der — völlig unhaltbaren — Ableitung der B. c. berolinensis von B. gibbera.
*) Ganz gleiche Veränderungen machen die 1. Antennen übrigens bei allen Formen von B. coregoni beim Heranwachsen
durch.
Synonymie.
Ehe ich im folgenden auf die Verbreitung der B. c. berolinensis eingehe, sind noch die Nomenklatur
und Synonymiefragen sicher zu. stellen. Die Autordiagnose von B. c. berolmensis wurde
von Imhof (’88) gegeben auf Grund eines Planktonmaterials, das Imhof von Prof. Weltner erhalten
hatte. Dasselbe war am 8. September 1885 im Müggelsee gefangen.
Dieses Datum, das Imhof leider nicht angibt, verdanke ich der Mitteilung von Prof. Weltner, der mir auch gestattete, den
noch vorhandenen Rest dies Fanges durchzusehen.
Wichtige Ergänzungen zu seiner ersten Diagnose gab Imhof (’90,1, II) in der an die Aufstellung
dieser Form als neue Art sich anschließenden Polemik mit Poppe (89’, I, ’90). Imhofs Diagnose
(und besonders die erwähnten Ergänzungen derselben) hebt im ganzen treffend die für B. c. berolinensis
charakteristischen Punkte hervor: den langen Mucro, der mit dem unteren Schalenrande einen außerordentlich
weiten Winkel bildet, infolgedessen wenig nach unten gerichtet ist und gleichmäßig in eine
Spitze ausläuft; die Besetzung der unteren Kante desselben „mit 2 spitzigen nach hinten gerichteten
Zähnchen“, die glatte Schale, die verhältnismäßig niedrige Form des Tieres. Ungenügend charakterisiert
aber bleiben die 1. Antennen, deren Spitzen Imhof „nicht hinter den Anfang des unteren, resp.
vorderen Schalenrandes reichen“ läßt, und deren Basalpartie nach ihm „schief vorwärts gerichtet“
ist. Eine Angabe in den Ergänzungen behauptet sogar, daß die Spitze der Tastantennen „nicht
hinter die Stirn“ reicht. Diese Bemerkungen Imhofs sind nur so zu verstehen, daß sie auf junge Tiere
gegründet sind, bei denen die Verhältnisse allerdings derartig liegen (vgl. Fig. 23). Schon Poppe
(’89, I, ’90) hat die Angaben Imhofs über Richtung und Projektion der 1. Antennen auf Grund des
Weltnerschen Materials angegriffen und richtig gestellt. Auf Messung junger Tiere ist auch Imhofs
Angabe der absoluten Länge auf 0,464 mm zurückzuführen, die Imhof allerdings in der 1. Ergänzung
richtiger auf 0,576 mm erhöhte. In der Tab. I, No. 9 gebe ich Zahlen werte, die an einem ausgesucht
durchschmttsmäßigen Tiere (mit 3 Embryonen) des Weltnerschen Original-Materials gewonnen sind,
und in Fig. 16 eine Zeichnung desselben Tieres.
An Imhofs Publikation seiner neuen Art B. berolinensis schloß sich, wie schon erwähnt, eine
lebhafte Polemik zwischen ihm und Poppe an, der behauptete, daß Imhofs B. berolinensis mit B.
bohemica Hellich identisch sei. Was für eine Form Poppe unter B. bohemica verstand, geht aus
folgender Äußerung (’89,1, p. 100) von ihm hervor. Er schreibt: „Außer im Müggelsee ist die Art
(B. bohemica Hellich) von Dr. O. Zacharias auch bei Berlin in der Spree (von der der allerdings große,
aber flache Müggelsee nur eine Erweiterung darstellt), im Havelsee bei Babelsberg, sowie in Mecklenburg
im Schweriner- und Müritzsee gesammelt worden; auch kommt sie nach Lilljeborg in Schweden
im Mälarsee1) vor.“ Bei diesen von Zacharias gefangenen Bosminen, auf die Poppe sich beruft,
und die er selbst, wie aus einer Äußerung von Zacharias (’87, p. 259) hervorgeht, vor Augen gehabt
und für Zacharias als B. bohemica Hellich bestimmt hat, handelt es sich nun allerdings, wie ich gleich
zeigen werde, um Formen, die mit Imhofs B. berolinensis identisch sind oder ihr doch wenigstens sehr
nahe stehen. Dennoch ist Poppe entschieden im Unrecht, wenn er behauptet, daß diese Formen
ebenso wie die mit ihnen identische, von Imhof geschaffene B. berolinensis den Namen B. bohemica
tragen müssen. Denn Hellichs B. bohemica, die allerdings sehr ungenügend beschrieben ist, gehört,
J) Die Identifikation dieser B. bohemica vom Mälarsee („oder richtiger einer Bosminenform, die die Herren Professoren
Lilljeborg und Sars für diese A rt halten“ mit den ihm bekannten Zachariasschen Formen (’90, pag. 366) nahm Poppe selbst, zurück.
E r dürfte bei dieser Form Lilljeborg’s B. insignis vom Mälarsee im Auge gehabt haben, die Lilljeborg früher (nach pag. 269 Clad.
S u e c .„ in seinen öffentlichen Vorlesungen“ ) m it B. bohemica Hellich identifizierte. Vgl. hierzu auch pag. 38.