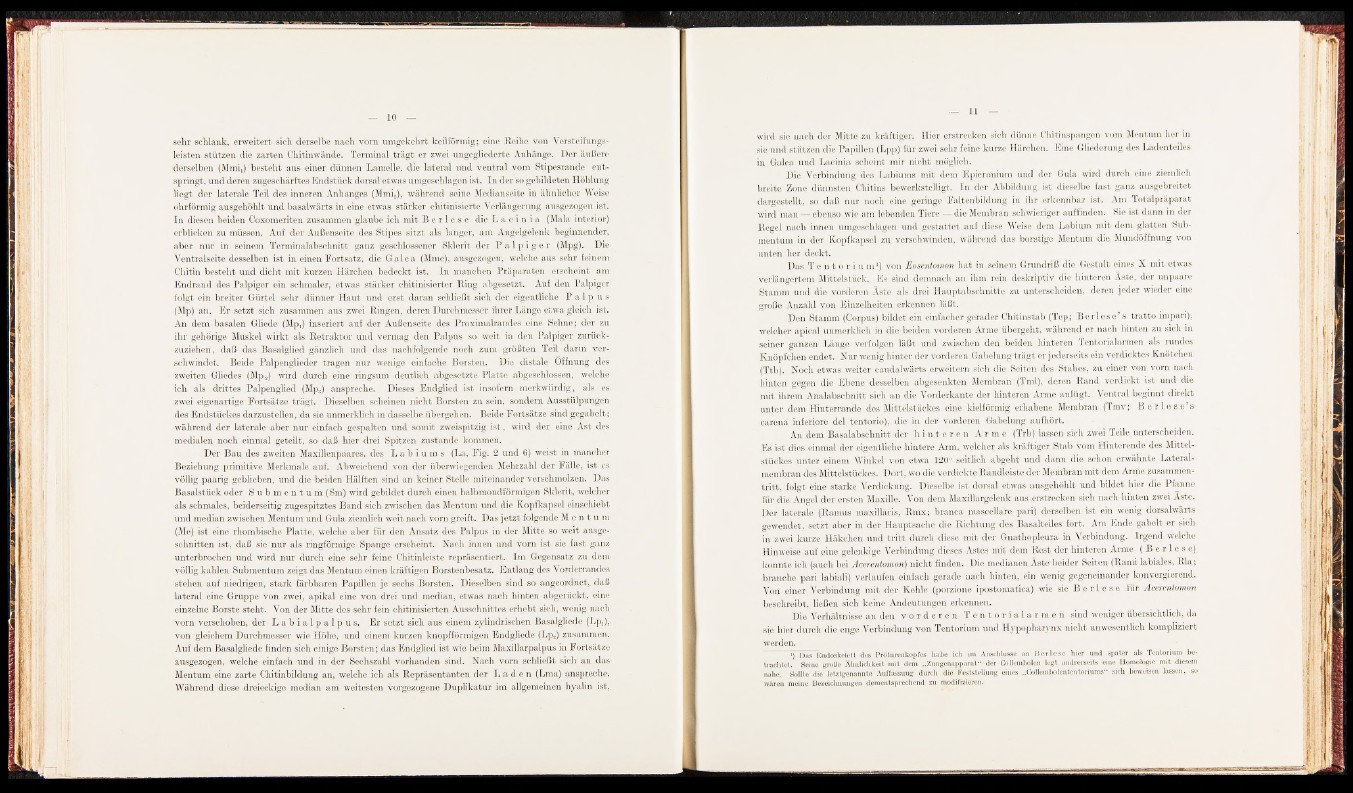
sehr schlank, erweitert sich derselbe nach vorn umgekehrt keilförmig; eine Reihe von Versteifungs-
leisten stützen die zarten Chitinwände. Terminal trägt er zwei ungegliederte Anhänge. Der äußere
derselben (Mmit) besteht aus einer dünnen Lamelle, die lateral und ventral vom Stipesrande entspringt,
und deren zugeschärftes Endstück dorsal etwas umgeschlagen ist. In der so gebildeten Höhlung
liegt der laterale Teil des inneren Anhanges (Mmi2), während seine Medianseite in ähnlicher Weise
ohrförmig ausgehöhlt und basalwärts in eine etwas stärker chitinisierte Verlängerung ausgezogen ist.
In diesen beiden Coxomeriten zusammen glaube ich mit B e r 1 e s e die L a c i n i a (Mala interior)
erblicken zu müssen. Auf der Außenseite des Stipes sitzt als langer, am Angelgelenk beginnender,
aber nur in seinem Terminalabschnitt ganz geschlossener Sklerit der P a l p i g e r (Mpg). Die
Ventralseite desselben ist in einen Eortsatz, die Galea (Mme), ausgezogen, welche aus sehr feinem
Chitin besteht und dicht mit kurzen Härchen bedeckt ist. In manchen Präparaten erscheint am
Endrand des Palpiger ein schmaler, etwas stärker chitinisierter Ring abgesetzt. Auf den Palpiger
folgt ein breiter Gürtel sehr dünner Haut und erst daran schließt sich der eigentliche P a 1 p u s
(Mp) an. Er setzt sich zusammen aus zwei Ringen, deren Durchmesser ihrer Länge etwa gleich ist.
An dem basalen Gliede (Mp,) inseriert auf der Außenseite des Proximalrandes eine Sehne; der zu
ihr gehörige Muskel wirkt als Retraktor und vermag den Palpus so weit in den Palpiger zurückzuziehen,
daß das Basalglied gänzlich und das nachfolgende noch zum größten Teil darin verschwindet.
Beide Palpenglieder tragen nur wenige einfache Borsten. Die distale Öffnung des
zweiten Gliedes (Mp2) wird durch eine ringsum deutlich abgesetzte Platte abgeschlossen, welche
ich als drittes Palpenglied (Mp3) anspreche. Dieses Endglied ist insofern merkwürdig, als es
zwei eigenartige Fortsätze trägt. Dieselben scheinen nicht Borsten zu sein, sondern Ausstülpungen
des Endstückes darzustellen, da sie unmerklich in dasselbe übergehen. Beide Fortsätze sind gegabelt;
während der laterale aber nur einfach gespalten und somit zweispitzig ist, wird der eine Ast des
medialen noch einmal geteilt, so daß hier drei Spitzen zustande kommen.
Der Bau des zweiten Maxillenpaares, des L a b i u m s (La, Fig. 2 und 6) weist in mancher
Beziehung primitive Merkmale auf. Abweichend von der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, ist es
völlig paarig geblieben, und die beiden Hälften sind an keiner Stelle miteinander verschmolzen. Das
Basalstück oder S u b m e n t u m (Sm) wird gebildet durch einen halbmondförmigen Sklerit, welcher
als schmales, beiderseitig zugespitztes Band sich zwischen das Mentum und die Kopfkapsel einschiebt
und median zwischen Mentum und Gula ziemlich weit nach vom greift. Das jetzt folgende M e n t u m
(Me) ist eine rhombische Platte, welche aber für den Ansatz des Palpus in der Mitte so weit ausgeschnitten
ist, daß sie nur als ringförmige Spange erscheint. Nach innen und vorn ist sie fast ganz
unterbrochen und wird nur durch eine sehr feine Chitinleiste repräsentiert. Im Gegensatz zu dem
völlig kahlen Submentum zeigt das Mentum einen kräftigen Borstenbesatz. Entlang des Vorderrandes
stehen auf niedrigen, stark färbbaren Papillen je sechs Borsten. Dieselben sind so angeordnet, daß
lateral eine Gruppe von zwei, apikal eine von drei und median, etwas nach hinten abgerückt, eine
einzelne Borste steht. Von der Mitte des sehr fein chitinisierten Ausschnittes erhebt sich, wenig nach
vorn verschoben, der L a b i a l p a l p u s . Er setzt sich aus einem zylindrischen Basalgliede (Lp,),
von gleichem Durchmesser wie Höhe, und einem kurzen knopfförmigen Endgliede (Lp2) zusammen.
Auf dem Basalgliede finden sich einige Borsten; das Endglied ist wie beim Maxillarpalpus in Fortsätze
ausgezogen, welche einfach und in der Sechszahl vorhanden sind. Nach vorn schließt sich an das
Mentum eine zarte Chitinbildung an, welche ich als Repräsentanten der L a d e n (Lma) anspreche.
Während diese dreieckige median am weitesten vorgezogene Duplikatur im allgemeinen hyalin ist,
wird sie nach der Mitte zu kräftiger. Hier erstrecken sich dünne Chitinspangen vom Mentum her in
sie und stützen die Papillen (Lpp) für zwei sehr feine kurze Härchen. Eine Gliederung des Ladenteiles
in Galea und Lacinia scheint mir nicht möglich.
Die Verbindung des Labiums mit dem Epicranium und der Gula wird durch eine ziemlich
breite Zone dünnsten Chitins bewerkstelligt. In der Abbildung ist dieselbe fast ganz ausgebreitet
dargestellt, so daß nur noch eine geringe Faltenbildung in ihr erkennbar ist. Am Totalpräparat
wird man — ebenso wie am lebenden Tiere — die Membran schwieriger auffinden. Sie ist dann in der
Regel nach innen umgeschlagen und gestattet auf diese Weise dem Labium mit dem glatten Submentum
in der Kopfkapsel zu verschwinden, während das borstige Mentum die Mundöffnung von
unten her deckt.
Das T e n t o r i u m 1) von Eosentomon hat in seinem Grundriß die Gestalt eines X mit etwas
verlängertem Mittelstück. Es sind demnach an ihm rein deskriptiv die hinteren Äste, der unpaare
Stamm und die vorderen Äste als drei Hauptabschnitte zu unterscheiden, deren jeder wieder eine
große Anzahl von Einzelheiten erkennen läßt.
Den Stamm (Corpus) bildet ein einfacher gerader Chitinstab (Tep; Be r l e s e ’s tratto impari),
welcher apical unmerklich in die beiden vorderen Arme übergeht, während er nach hinten zu sich m
seiner ganzen Länge verfolgen läßt und zwischen den beiden hinteren Tentorialarmen als rundes
Knöpfchen endet. Nur wenig hinter der vorderen Gabelung trägt er jederseits ein verdicktes Knötchen
(Ttb). Noch etwas weiter caudalwärts erweitern sich die Seiten des Stabes, zu einer von vorn nach
hinten gegen die Ebene desselben abgesenkten Membran (Tml), deren Rand verdickt ist und die
mit ihrem Analabschnitt sich an die Vorderkante der hinteren Arme anfügt. Ventral beginnt direkt
unter dem Hinterrande des Mittelstückes eine kielförmig erhabene Membran (Tmv; B e r l e s e ’s
carena inferiore del tentorio), die in der vorderen Gabelung auf hört.
An dem Basalabschnitt der h i n t e r e n A rm e (Trb) lassen sich zwei Teile unterscheiden.
Es ist dies einmal der eigentliche hintere Arm, welcher als kräftiger Stab vom Hinterende des Mittelstückes
unter einem Winkel von etwa 120° seitlich abgeht und dann die schon erwähnte Lateralmembran
des Mittelstückes. Dort, wo die verdickte Randleiste der Membran mit dem Arme Zusammentritt,
folgt eine starke Verdickung. Dieselbe ist dorsal etwas ausgehöhlt und bildet hier die Pfanne
für die Angel der ersten Maxille. Von dem Maxillargelenk aus erstrecken sich nach hinten zwei Äste.
Der laterale (Ramus maxillaris, Rmx; branca mascellare pari) derselben ist ein wenig dorsalwärts
gewendet, setzt aber in der Hauptsache die Richtung des Basalteiles fort. Am Ende gabelt er sich
in zwei kurze Häkchen und tritt durch diese mit der Gnathopleura in Verbindung. Irgend welche
Hinweise auf eine gelenkige Verbindung dieses Astes mit dem Rest der hinteren Arme ( B e r l e s e )
konnte ich (auch bei Acerentomon) nicht finden. Die medianen Äste beider Seiten (Rami labiales, Ria;
branche pari labiali) verlaufen einfach gerade nach hinten, ein wenig gegeneinander konvergierend.
Von einer Verbindung mit der Kehle (porzione ipostomatica) wie sie B e r 1 e s e für Acerentomon
beschreibt, ließen sich keine Andeutungen erkennen.
Die Verhältnisse an den v o r d e r e n T e n t o r i a l a r m e n sind weniger übersichtlich, da
sie hier durch die enge Verbindung von Tentorium und Hypopharynx nicht unwesentlich kompliziert
werden.
l) Das Endoskelett des Proturenkopfes habe ich im Anschlüsse an Be r l e s e hier und später als Tentorium betrach
tet. Seine große Ähnlichkeit m it dem „Zungenapparat“ d er Collembolen legt andrerseits eine Homologie m it diesem
nahe. Sollte die letztgenannte Auffassuug durch die Feststellung eines „Collembolententoriums“ sich beweisen lassen, so
wären meine Bezeichnungen dementsprechend zu modifizieren.