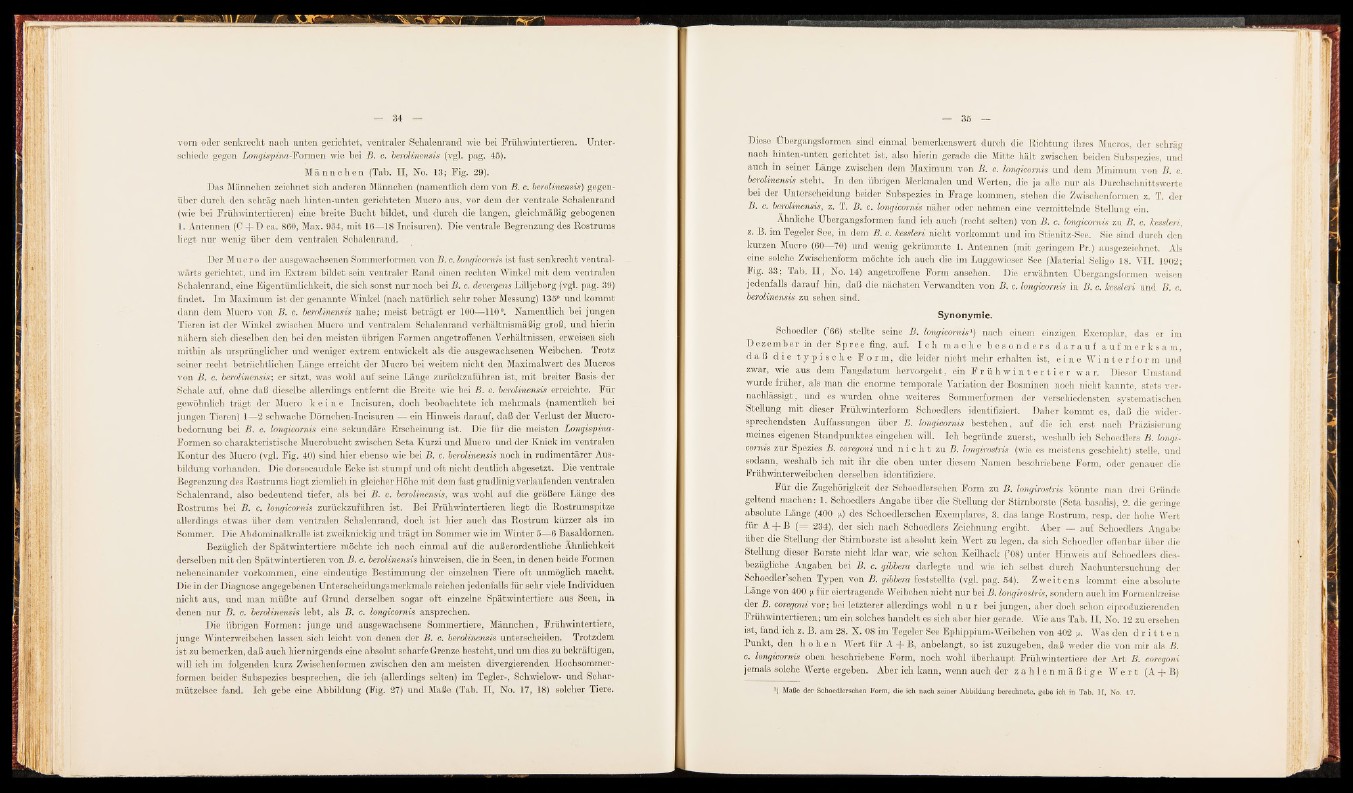
vorn oder senkrecht nach unten gerichtet, ventraler Schalenrand wie bei Frühwintertieren. Unterschiede
gegen Longispina-T?ormen wie bei B. c. berolinensis (vgl. pag. 45).
Mä n n c h e n (Tab. II, No. 13; Fig. 29).
Das Männchen zeichnet sich anderen Männchen, (namentlich dem von B. c. berolinensis) gegenüber
durch den schräg nach hinten-unten gerichteten Mucro aus, vor dem der ventrale Schalenrand
(wie bei Frühwintertieren) eine breite Bucht bildet, und durch die langen, gleichmäßig gebogenen
1. Antennen (C + D ca. 860, Max. 954, mit 16—18 Incisuren). Die ventrale Begrenzung des Rostruras
liegt nur wenig über dem ventralen Schalenrand. .
Der Mucro der ausgewachsenen Sommerformen von B. c. longicornis ist fast senkrecht ventral-
wärts gerichtet, und im Extrem bildet sein ventraler Rand einen rechten Winkel mit dem ventralen
Schalenrand, eine Eigentümlichkeit, die sich sonst nur noch bei B. c. devergens Lilljeborg (vgl. pag. 39)
findet. Im Maximum ist der genannte Winkel (nach natürlich sehr roher Messung) 135° und kommt
dann dem Mucro von B. c. berolinensis nahe; meist beträgt er 100—110°. Namentlich bei jungen
Tieren ist der Winkel zwischen Mucro und ventralem Schalenrand verhältnismäßig groß, und hierin
nähern sich dieselben den bei den meisten übrigen Formen angetroffenen Verhältnissen, erweisen sich
mithin als ursprünglicher und weniger extrem entwickelt als die ausgewachsenen Weibchen. Trotz
seiner recht beträchtlichen Länge erreicht der Mucro bei weitem nicht den Maximalwert des Mucros
von B. c. berolinensis; er sitzt, was wohl auf seine Länge zurückzuführen ist, mit breiter Basis- der
Schale auf, ohne daß dieselbe allerdings entfernt die Breite wie bei B. c. berolinensis erreichte. Für
gewöhnlich trägt der Mucro k e i n e Incisuren, doch beobachtete ich mehrmals (namentlich bei
jungen Tieren) 1—2 schwache Dörnchen-Incisuren — ein Hinweis darauf, daß der Verlust der Mucro-
bedornung bei B. c. longicornis eine sekundäre Erscheinung ist. Die für die meisten Longispina-
Formen so charakteristische Mucrobucht zwischen Seta Kurzi und Mucro und der Knick im ventralen
Kontur des Mucro (vgl. Fig. 40) sind hier ebenso wie bei B. c. berolinensis noch in rudimentärer Ausbildung
vorhanden. Die dorsocaudale Ecke ist stumpf und oft nicht deutlich abgesetzt. Die ventrale
Begrenzung des Rostrums liegt ziemlich in gleicher Höhe mit dem fast gradlinig verlaufenden ventralen
Schalenrand, also bedeutend tiefer, als bei B. c. berolinensis, was wohl auf die größere Länge des
Rostrums bei B. c. longicornis zurückzuführen ist. Bei Frühwintertieren liegt die Rostrumspitze
allerdings etwas über dem ventralen Schalenrand, doch ist hier auch das Rostrum kürzer als im
Sommer. Die Abdominalkralle ist zweiknickig und trägt im Sommer wie im Winter 5—6 Basaldornen.
Bezüglich der Spätwintertiere möchte ich noch einmal auf die außerordentliche Ähnlichkeit
derselben mit den Spätwintertieren von B. c. berolinensis hinweisen, die in Seen, in denen beide Formen
nebeneinander Vorkommen, eine eindeutige Bestimmung der einzelnen Tiere oft unmöglich macht.
Die in der Diagnose angegebenen Unterscheidungsmerkmale reichen jedenfalls für sehr viele Individuen
nicht aus, und man müßte auf Grund derselben sogar oft einzelne Spätwintertiere aus Seen, in
denen nur B. c. berolinensis lebt, als B. c. longicornis ansprechen.
Die übrigen Formen: junge und ausgewachsene Sommertiere, Männchen, Frühwintertiere,
junge Winterweibchen lassen sich leicht von denen der B. c. berolinensis unterscheiden. Trotzdem
ist zu bemerken, daß auch hier nirgends eine absolut scharfe Grenze besteht, und um dies zu bekräftigen,
will ich im folgenden kurz Zwischenformen zwischen den am meisten divergierenden Hochsommerformen
beider Subspezies besprechen, die ich (allerdings selten) im Tegler-, Schwielow- und Scharmützelsee
fand. Ich gebe eine Abbildung (Fig. 27) und Maße (Tab. II, No. 17, 18) solcher Tiere.
Diese Übergangsfoimen sind einmal bemerkenswert durch die Eiclitung ihres Mucros, der schräg
nach hinten-unten gerichtet ist, also hierin gerade die Mitte hält zwischen beiden Subspezies, und
auch in seiner Länge zwischen dem Maximum von B. iMiilcmgicorms und dem Minimum von B. c.
beroUnensis steht. In den übrigen Merkmalen und Werten, die ja alle nur als Durchschnittswerte
bei der Unterscheidung beider Subspezies in Frage kommen, stehen die Zwischenformen z. T. der
B. c. berolinensis, z. T. B. e. longichrnis näher oder nehmen eine vermittelnde Stellung ein.
Ähnliche ÜbergängsfOrmen fand ich auch (recht selten) von B, c, longicornis zu B. c. Icessleri,
z. B. im Tegeler See, in dem B. c.MssUfi. nicht vorkommt und im Stienitz-See. Sie sind durch den
kurzen Mucro; (60W-3ÄI und wenig gekrünnnte 1. Antennen (mit geringem Pr.) ausgezeichnet. Als
eine solche Zwischenform möchte ich auch die im Luggewieser See (Material Seligo 18. VII. 1902;
Fig. 33; Tab. I I , No. 14) angetroffene Form ansehen. Die erwähnten Übergangsformen weisen
jedenfalls darauf hin, daß die nächsten Verwandten von B. c. longicornis in B. o. Icessleri und B. c.
berolinensis zu sehen sind. .
Synonymie.
Schoedler (’66) stellte seine B. longicornis1) nach einem einzigen Exemplar, das er im
Dezember in der Spree fing, auf. I c h m a c h e b e s o n d e r s d a r a u f a u f m e r k s a m ,
d a ß d i e t y p i s c h e j o r m , die leider nicht mehr erhalten ist, e i n e \V i n t r r i ' o r in und
zwar, wie aus dem Fangdatum hervorgeht, ein F r ü h w i n t e r t i e r war . Dieser Umstand
wurde früher, als, man die enorme temporale Variation der Bosminen noch n if it kannte, stets vernachlässigt,
und fsr wurden ohne weiteres Sommerformen <j(r verschiedensten systematischen
Stellung mit dieser Frühwinterform Schoedlers identifiziert. Daher kommt es, daß die -wider -
sprechendsten Auffassungen über 7». longicornis bestehen, auf die ich, erst, nach Präzisierung
meines eigenen Standpunktes eingehen will. Ich begründe zuerst, "weshalb ich Schoedlers B. longi-
cornis zur Spezies B. coregoni und n i c h t zu E. longirostris (wie es meistens geschieht) stelle, und
sodann, weshalb ich mit ihr die oben unter diesem Namen beschriebene Form, oder genauer die
Frühwinterweibchen derselben identifiziere.
Für die Zugehörigkeit der Schoedlerschen Form zu B. longirostris könnte man drei Gründe
geltend machen: 1. Schoedlers Angabe über die Stellung der Stirnborste (Seta basaM)), 2. die geringe
absolute Länge (400 n) des Schoedlerschen Exemplares, 3. das lange Eostrum, resp; ;äer hohe Wert
für A + B (= 234), der sich nach Schoedlers Zeichnung ergibt. Aber I auf Schoedlers Angabe
über die Stellung der Stirnborste ist absolut kein Wert zu legen, da sich Schoedler offenbar über die
-Stellung dieser Borste nicht klar war, wie schon Keilhäck (’03) unter Hinweis auf Schoedlers diesbezügliche
Angaben bei B. c. gibbera darlegte und wie ich selbst durch Nachuntersuchung der
Schoedler’schen Typen von B. gibbera feststellte (vgl. pag. 54). Zwei tens' kommt eine absolute
Länge von 400 für eiertragende Weibchen nicht nur bei B. longirostris, sondern auch im Formenkreise
der B. coregoni vor; bei letzterer allerdings wohl n u r bei jungen, aber doch schon eiproduzierenden
Frühwintertieren; um ein solches handelt es sich aber hier gerade. Wie aus Tab. II, No. 12 zu ersehen
ist, fand ich z. B. am 28. X. 08 im Tegeler See Ephippium-Weibchen von 402 u. Was den d r i t t e n
Punkt, den h o h e n Wert für A-f-B, anbelangt, so ist zuzugeben, daß weder die von mir als B.
c. longicornis oben beschriebene Form, noch wohl überhaupt Frühwintertiere der Art B. coregoni
jemals solche Werte ergeben. Aber ich kann, wenn auch der z a h l e n m ä ß i g e We r t (A + B)
J) Maße d er Schoedlerschen Form, die ich nach seiner Abbildung berechnete, gebe ich in Tab. I I , No. 17.