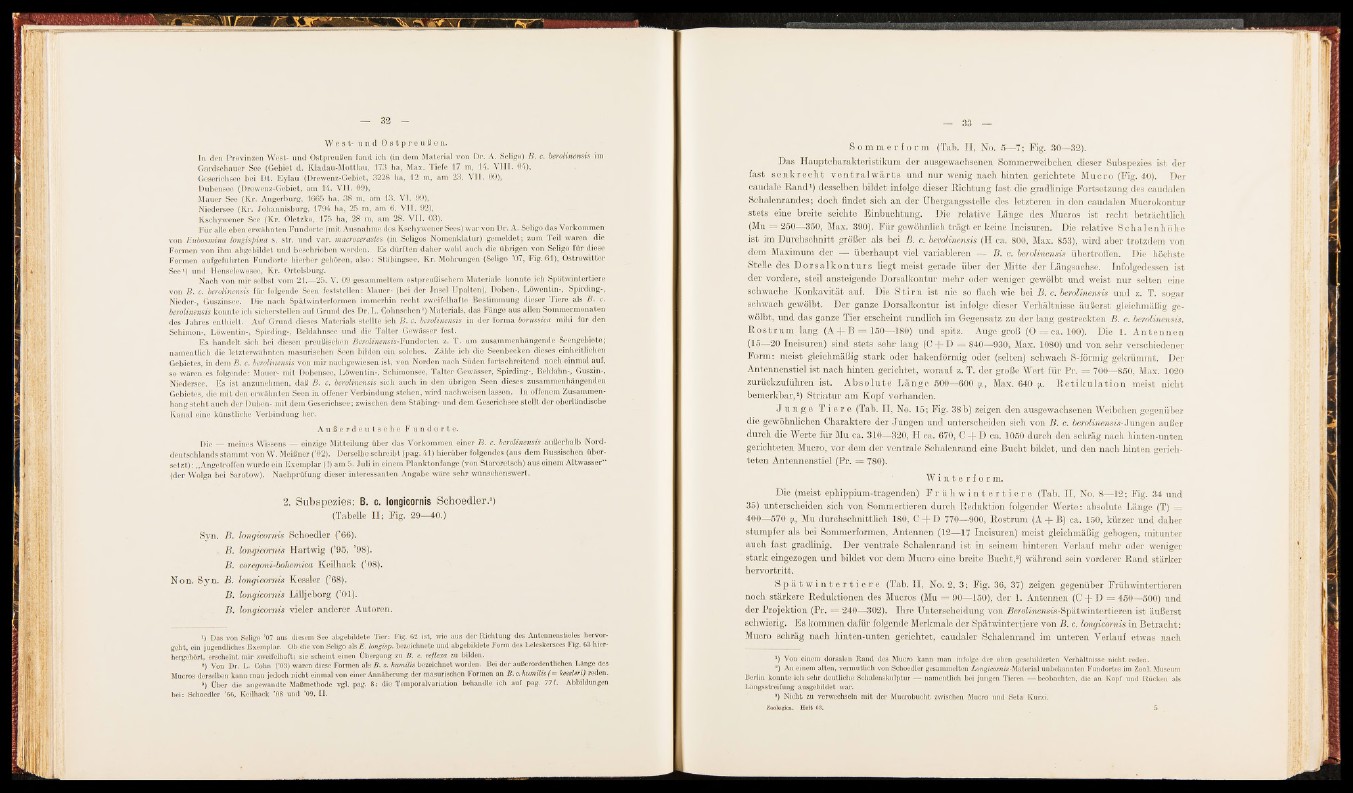
Wes t - un d O s t p r e u ß e n .
In den Provinzen West- und Ostpreußen fand ich (in dem Material von Dr. A. Seligo) B. c. berolinensis im
Gardschauer See (Gebiet d. Kladau-Mottlau, 173 ha, Max. Tiefe 17 m, 14. VIII. 04),
Geserichsee bei Dt. Eylau (Drewenz-Gebiet, 3228 ha, 12 m, am 23. VII. 09),
Dubensee (Drewenz-Gebiet, am 14. VII. 09),
Mauer See (Kr. Angerburg, 1665 ha, 38 m, am 13. VI. 99),
Niedersee (Kr. Johannisburg, 1794 ha, 25 m, am 6. VII. 92),
Kschywener See (Kr. Oletzko, 175 ha, 28 m, am 28. VII. 03).
Für alle eben erwähnten Fundorte (mit Ausnahme des Kschywener Sees) war von Dr. A. Seligo das Vorkommen
von Eubosntina longispina s. str. und var. macrocerastes (in Seligos Nomenklatur) gemeldet; zum Teil waren die
Formen von ihm abgebildet und beschrieben worden. Es dürften daher wohl auch die übrigen von Seligo für diese
Formen aufgeführten Fundorte hierher gehören, also: Stäbingsee, Kr. Mohrungen (Seligo ’07, Fig. 61), Ostrowitter
See1) und Henselewosee. Kr. Orteisburg.
Nach von mir selbst vom 21.—25. V. 09 gesammeltem ostpreußischem Materiale konnte ich Spätwintertiere
von B . c. berolinensis für folgende Seen feststellen: Mauer- (bei der Jnsel Upalten), Doben-, Löwentin-, Spirding-,
Nieder-, Guszinsee. Die nach Spätwinterformen immerhin recht zweifelhafte Bestimmung dieser Tiere als B . c.
berolinensis konnte ich sicherstellen auf Grund des Dr. L. Cohnschen2) Materials, das Fänge aus allen Sommermonaten
des Jahres enthielt. Auf Grund dieses Materials stellte ich B . c. berolinensis in der forma borussica mihi für den
Schimon-, Löwentin-, Spirding-, Beldahnsee und die Talter Gewässer fest.
Es handelt sich bei diesen preußischen Berolinensis-Fundorten z. T. um zusammenhängende Seengebiete;
namentlich die letzterwähnten masurischen Seen bilden ein solches. Zähle ich die Seenbecken dieses einheitlichen
Gebietes, in dem B . c. berolinensis von mir nachgewiesen ist, von Norden nach Süden fortschreitend noch einmal auf,
so wären es folgende: Mauer- mit Dobensee, Löwentin-, Schimonsee, Talter Gewässer, Spirding-, Beldahn-, Guszin-,
Niedersee. Es ist anzunehmen, daß B. c. berolinensis sich auch in den übrigen Seen dieses zusammenhängenden
Gebietes, die mit den erwähnten Seen in offener Verbindung stehen, wird nachweisen lassen. In offenem Zusammenhang
steht auch der Duben- mit dem Geserichsee; zwischen dem Stäbing- und dem Geserichsee stellt der oberländische
Kanal eine künstliche Verbindung her.
A u ß e r d e u t s c h e F u n d o r t e .
Die — meines Wissens — einzige Mitteilung über das Vorkommen einer B . c. berolinensis außerhalb Norddeutschlands
stammt von W. Meißner (’02). Derselbe schreibt (pag. 41) hierüber folgendes (aus dem Russischen übersetzt):
,;Angetroffen wurde ein Exemplar (!) am 5. Juli in einem Planktonfange (von Staroretsch) aus einem Altwasser“
(der Wolga bei Saratow). Nachprüfung dieser interessanten Angabe wäre sehr wünschenswert.
2. Subspezies: B. c. longicornis Schoedler.3)
(Tabelle I I ; Fig. 29—40.)
Syn. B. longicornis Schoedler (’66).
. B. longicornis Hartwig (’95, ’98).
B. coregoni-bohemica Keilhack (’08).
Non. Syn. B. longicornis Kessler (’68).
B. longicornis Lilljeborg (’01).
B. longicornis vieler anderer Autoren.
1) Das von Seligo *07 aus diesem See abgebildete Tier: Fig. 62 ist, wie aus der Richtung des Antennenstieles hervor-
geht, ein jugendliches Exemplar. Ob die von Seligo als E. longisp. bezeichnete und abgebildete Form des Leleskersees Fig. 63 hierhergehört,
erscheint mir zweifelhaft; sie scheint einen Übergang zu B. c. reflexa zu bilden.
2) Von Dr. L. Cohn (’03) waren diese Formen als B. c. humilis bezeichnet worden. Bei der außerordentlichen. Länge des
Mucros derselben kann man jedoch nicht einmal von einer Annäherung der masurischen Formen an B. c. humilis (= kessleri) reden.
3) Über die angewandte Maßmethode vgl. pag. 8; die Temporalvariation behandle ich auf pag. 77 f. Abbildungen
bei: Schoedler ’66, Keilhack ’08 und ’09, II.
S o m m e r f o r m (Tab. II, No. 5—7; Fig. 30—32).
Das Hauptcharakteristikum der ausgewachsenen Sommerweibchen dieser Subspezies ist der
fast s enkr e cht v ent r a lwä r t s und nur wenig nach hinten gerichtete Mucro (Fig. 40). Der
caudale Rand1) desselben bildet infolge dieser Richtung fast die gradlinige Fortsetzung des caudalen
Schalenrandes; doch findet sich an der Übergangsstelle des letzteren in den caudalen Mucrokontur
stets eine breite seichte Einbuchtung. Die relative Länge des Mucros ist recht beträchtlich
(Mu = 250—350, Max. 390). Für gewöhnlich trägt er keine Incisuren. Die relative Schal enhöhe
ist im Durchschnitt größer als bei B. c. bewlmensis (H ca. 800, Max. 853), wird aber trotzdem von
dem Maximum der — überhaupt viel variableren —- B. c. berolinensis übertroffen. Die höchste
Stelle des Dor s a l kont ur s liegt meist gerade über der Mitte der Längsachse. Infolgedessen ist
der vordere, steil ansteigende Dorsalkontur mehr oder weniger gewölbt und weist nur selten eine
schwache Konkavität auf. Die St i rn ist nie so flach wie bei B. c. berolinensis und z. T. sogar
schwach gewölbt. Der ganze Dorsalkontur ist infolge dieser Verhältnisse äußerst gleichmäßig gewölbt,
und das ganze Tier erscheint rundlich im Gegensatz zu der lang gestreckten B. c. berolinensis.
Ro s t r um lang (A + B=4|jL50—.180) und spitz. Auge groß (O — ca. 100). Die 1. Ant ennen
(15—20 Incisuren) sind stets sehr lang (C + D = 840—930, Max. 1080) und von sehr verschiedener
Form: meist gleichmäßig stark oder hakenförmig oder (selten) schwach S-förmig gekrümmt. Der
Antennenstiel ist nach hinten gerichtet, worauf z. T. der große Wert für Pr. = 700—850, Max. 1020
zurückzuführen ist. Absolut e Länge 500—600 pi, Max. 640 p.. Re t i kul a t i on meist nicht
bemerkbar,2) Striatur am Kopf vorhanden.
J u n g e T i e r e (Tab. II, No. 15; Fig. 38 b) zeigen den ausgewachsenen Weibchen gegenüber
die gewöhnlichen Charaktere der Jungen und unterscheiden sich von B. c. berolinensis-Jungen außer
durch die Werte für Mu ca. 310—320, H ca. 670, C -f- D ca. 1050 durch den schräg nach hinten-unten
gerichteten Mucro, vor dem der ventrale Schalenrand eine Bucht bildet, und den nach hinten gerichteten
Antennenstiel (P r.|= 780).
W ' i n t e r f o r m .
Die (meist ephippium-tragenden) F r ü h w i n t e r t i e r e (Tab. II, No. 8—12; Fig. 34 und
35) unterscheiden sich von Sommertieren durch Reduktion folgender Werte: absolute Länge (T) =
400—570 p., Mu durchschnittlich 180, C + D 770—900, Rostrum (A + B) ca. 150, kürzer und daher
stumpfer als bei Sommerformen, Antennen (12—17 Incisuren) meist gleichmäßig gebogen, mitunter
auch fast gradlinig. Der ventrale Schalenrand ist in seinem hinteren Verlauf mehr oder weniger
stark eingezogen und bildet vor dem Mucro eine breite Bucht,3) während sein vorderer Rand stärker
hervortritt.
S p ä t w i n t e r t i e r e (Tab. II, No. 2, 3; Fig. 36, 37) zeigen gegenüber Frühwintertieren
noch stärkere Reduktionen des Mucros (Mu = 90—150), der 1. Antennen (C + D = 450—500) und
der Projektion (Pr. = 240—302). Ihre Unterscheidung von BeroZmewsis-Spätwintertieren ist äußerst
schwierig. Es kommen dafür folgende Merkmale der Spätwintertiere von B. c. longicornis in Betracht:
Mucro schräg nach hinten-unten gerichtet, caudaler Schalenrand im unteren Verlauf etwas nach
x) Von einem dorsalen Ran d des Mucro kann man infolge der oben geschilderten Verhältnisse nicht reden.
2) An einem alten, vermutlich von Schoedler gesammelten Zongicornis-Material unbekannten Fundortes im Zool. Museum
Berlin konnte ich sehr deutliche Schalenskulptur — namentlich bei jungen Tieren — beobachten, die an Kopf und Rücken als
Längsstreifung ausgebildet war.
8) Nicht zu verwechseln m it der Mucrobucht zwischen Mucro und Seta Kurzi.
Zoologica. H e ft 68. 5