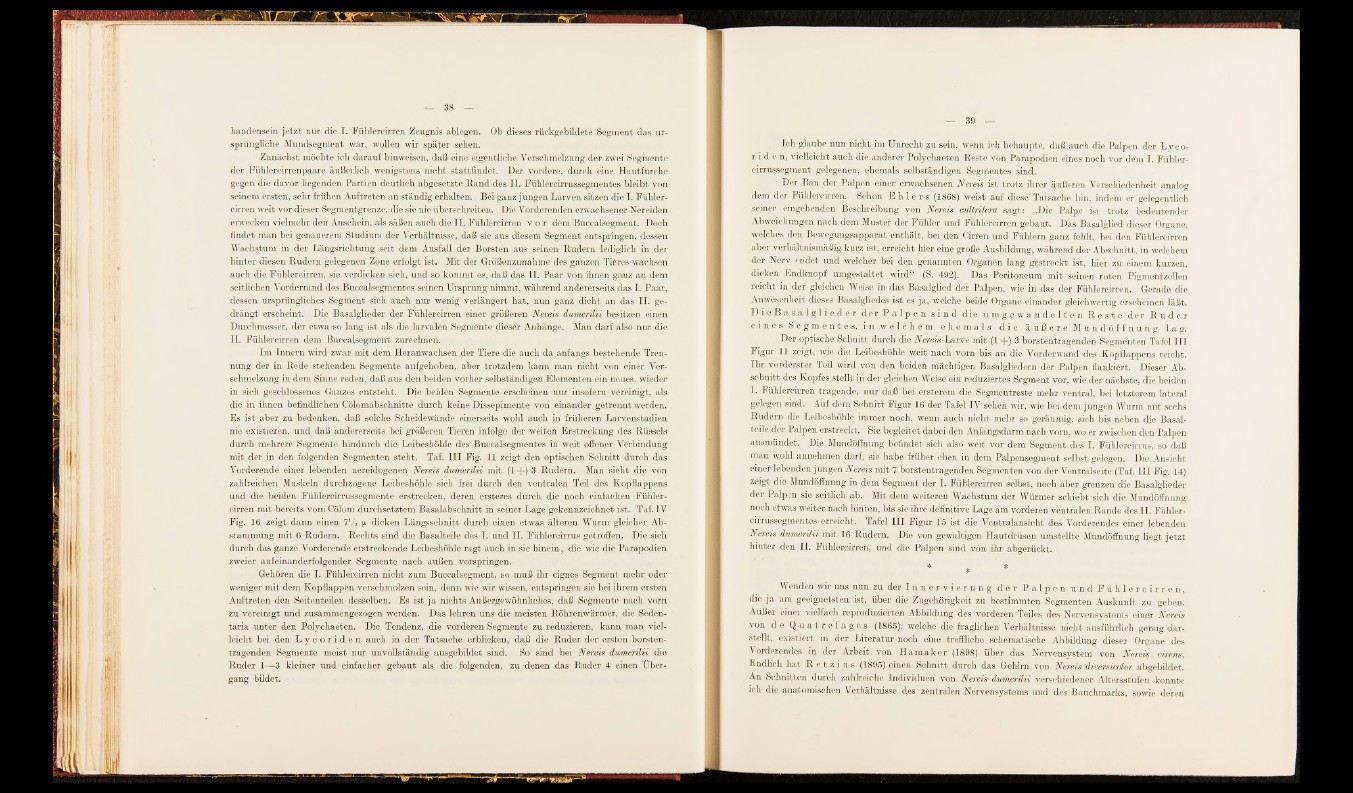
B B —
Eandensein jetzt nur die I. Fühlercirren Zeugnis ablegen. Ob dieses rückgebildete Segment das ursprüngliche
Mundsegment war, wollen wir später sehen.
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß eine eigentliche Verschmelzung der zwei Segmente
der Fühlercirrenpaare äußerlich wenigstens nicht stattfindet. Der vordere, durch eine Hautfurche
gegen die davor liegenden Partien deutlich abgesetzte Rand des II. Fühlercirrussegmentes bleibt von
•seinem ersten, sehr frühen Auftreten an ständig erhalten. Bei ganz jungen Larven sitzen die I. Fühlercirren
weit vor dieser Segmentgrenze, die sie nie überschreiten. Die Vorderenden erwachsener Nereiden
erwecken vielmehr den Anschein, als säßen auch die II. Fühlercirren v o r dem Buccalsegment. Doch
findet man bei genauerem Studium der Verhältnisse, daß sie aus diesem Segment entspringen, dessen
Wachstum in der Längsrichtung seit dem Ausfall der Borsten aus seinen Rudern lediglich in der
hinter diesen Rudern gelegenen Zone erfolgt ist. Mit der Größenzunahme des ganzen Tieres wachsen
auch die Fühlercirren, sie verdicken sich, und so kommt es, daß das II. Paar von ihnen ganz an dem
seitlichen Vorderrand des Buccalsegmentes seinen Ursprung nimmt, während andererseits das I. Paar,
dessen ursprüngliches Segment sich auch nur wenig verlängert hat, nun ganz dicht an das II. gedrängt
erscheint. Die Basalglieder der Fühlercirren einer größeren Nereis dumerilii besitzen einen
Durchmesser, der etwa so lang ist als die larvalen Segmente dieser Anhänge. Man darf also nur die
II. Fühlercirren dem Buccalsegment zurechnen.
Im Innern wird zwar mit dem Heranwachsen der Tiere die auch da anfangs bestehende Trennung
der in Rede stehenden Segmente aufgehoben, aber trotzdem kann man nicht von einer Verschmelzung
in dem Sinne reden, daß aus den beiden vorher selbständigen Elementen ein neues, wieder
in sich geschlossenes Ganzes entsteht. Die beiden Segmente erscheinen nur insofern vereinigt, als
die in ihnen befindlichen Cölomabschnitte durch keine Dissepimente von einander getrennt werden.
Es ist aber zu bedenken, daß solche Scheidewände einerseits wohl auch in früheren Larvenstadien
nie existieren, und daß andererseits bei größeren Tieren infolge der weiten Erstreckung des Rüssels
durch mehrere Segmente hindurch die Leibeshöhle des Buccalsegmentes in weit offener Verbindung
mit der in den folgenden Segmenten steht. Taf. I II Fig. 11 zeigt den optischen Schnitt durch das
Vorderende einer lebenden nereidogenen Nereis dumerilii mit (1+) 3 Rudern. Man sieht die von
zahlreichen Muskeln durchzogene Leibeshöhle sich frei durch den ventralen Teil des Kopflappens
und die beiden Fühlercirrussegmente erstrecken, deren ersteres durch die noch einfachen Fühlercirren
mit bereits vom Cölom durchsetztem Basalabschnitt in seiner Lage gekennzeichnet ist. Taf. IV
Fig. 16 zeigt dann einen 7V2 [x dicken Längsschnitt durch einen etwas älteren Wurm gleicher Abstammung
mit 6 Rudern. Rechts sind die Basalteile des I. und II. Fühlercirrus getroffen. Die sich
durch das ganze Vorderende erstreckende Leibeshöhle ragt auch in sie hinein, die wie die Parapodien
zweier aufeinanderfolgender Segmente nach außen vorspringen.
Gehören die I. Fühlercirren nicht zum Buccalsegment, so muß ihr eignes Segment mehr oder
weniger mit dem Kopflappen verschmolzen sein, denn wie wir wissen, entspringen sie bei ihrem ersten
Auftreten den Seitenteilen desselben. Es ist ja nichts Außergewöhnliches, daß Segmente nach vorn
zu vereinigt und zusammengezogen werden. Das lehren uns die meisten Röhrenwürmer, die Seden-
tariä unter den Polychaeten. Die Tendenz, die vorderen Segmente zu reduzieren, kann man vielleicht
bei den L y c o r i d e n auch in der Tatsache erblicken, daß die Ruder der ersten borstentragenden
Segmente meist nur unvollständig ausgebildet sind. So sind bei Nereis dumerilii die
Ruder 1 —3 kleiner und einfacher gebaut als die folgenden, zu denen das Ruder 4 einen Übergang
bildet.
Ich glaube nun nicht im Unrecht zu sein, wenn ich behaupte, daß auch die Palpen der Lyco-
r i d e n, vielleicht auch die anderer Polychaeten Reste von Parapodien eines noch vor dem I. Fühlercirrussegment
gelegenen, ehemals selbständigen Segmentes sind.
Der Bau der Palpen einer erwachsenen Nereis ist trotz ihrer äußeren Verschiedenheit analog
dem der Fühlercirren. Schon E h l e r s (1868) weist auf diese Tatsache hin, indem er gelegentlich
seiner eingehenden Beschreibung von Nereis cultrifera sagt: „Die Palpe ist trotz bedeutender
Abweichungen nach dem Muster der Fühler und Fühlercirren gebaut. Das Basalglied dieser Organe,
welches den Bewegungsapparat enthält, bei den Girren und Fühlern ganz fehlt, bei den Fühlercirren
aber verhältnismäßig kurz ist, erreicht hier eine große Ausbildung, während der Abschnitt, in welchem
der Nerv endet und welcher bei den genannten Organen lang gestreckt ist, hier zu einem kurzen,
dicken Endknopf umgestaltet wird“ (S. 492). Das Peritoneum mit seinen roten Pigmentzellen
reicht in der gleichen Weise in das Basalglied der Palpen, wie in das der Fühlercirren. Gerade die
Anwesenheit dieses Basalgliedes ist es ja, welche beide Organe einander gleichwertig erscheinen läßt.
D i e B a s a l g l i e d e r der P a l p e n s i n d die um g e w a n d e l t e n R e s t e d e r R u d e r
e i n e s S e g m e n t e s , i n w e l c h e m e h e m a l s d i e ä u ß e r e M u n d ö f f n u n g l a g .
Der optische Schnitt durch die Werns-Larve mit (1 + ) 3 borstentragenden Segmenten Tafel III
Figur 11 zeigt, wie die Leibeshöhle weit nach vorn bis an die Vorderwand des Kopflappens reicht.
. Ihr vorderster Teil wird von den beiden mächtigen Basalgliedern der Palpen flankiert. Dieser Abschnitt
des Kopfes stellt in der gleichen Weise ein reduziertes Segment vor, wie der nächste, die beiden
I. Fühlercirren tragende, nur daß bei ersterem die Segmentreste mehr ventral, bei letzterem lateral
gelegen sind. Auf dem Schnitt Figur 16 der Tafel IV sehen wir, wie bei dem jungen Wurm mit sechs
Rudern die Leibeshöhle immer noch, wenn auch nicht mehr so geräumig, sich bis neben die Basalteile
der Palpen erstreckt. Sie begleitet dabei den Anfangsdarm nach vorn, wo er zwischen den Palpen
ausmündet. Die Mundöffnung befindet sich also weit vor dem Segment des I. Fühlercirrus, so daß
man wohl annehmen darf, sie habe früher eben in dem Palpensegment selbst gelegen. Die Ansicht
einer lebenden jungen Nereis mit 7 borstentragenden Segmenten von der Ventralseite (Taf. III Fig. 14)
zeigt die Mundöffnung in dem Segment der I. Fühlercirren selbst, noch aber grenzen die Basalglieder
der Palpen sie seitlich ab. Mit dem weiteren Wachstum der Würmer schiebt sich die Mundöffnung
noch etwas weiter nach hinten, bis sie ihre definitive Lage am vorderen ventralen Rande des II. Fühlercirrussegmentes
erreicht. Tafel III Figur 15 ist die Ventralansicht des Vorderendes einer lebenden
Nereis dumerilii mit 16 Rudern. Die von gewaltigen Hautdrüsen umstellte Mundöffnung liegt jetzt
hinter den II. Fühlercirren, und die Palpen sind von ihr abgerückt.
* ^* *
Wenden wir uns näjjtiu der I n n é r v i e r u nigfd e r P a l p e n u n d F ü h l e r c i r r e n ,
die ja am geeignetsten ist, über die Zugehörigkeit zu bestimmten Segmenten Auskunft zu geben.
Außer einer vielfach reproduzierten Abbildung des vorderen Teiles des Nervensystems einer Nereis
von d e Q-u a t f e f ä g e s (1866), welche' die fraglicher! Verhältnisse nicht ausführlich genug dar-
Btellt, existiert in der Literatur noch eine treffliche schematische Abbildung dieser Organe des
Vorderendes in der Arbeit-Won H am a k e r (1898) über das. Nervensystem von -Nereis virens.
Endlich hat B e t z i u s (-(895) einen Schnitt durch das Gehirn von Nereis diversiedor abgebildet.
An Schnitten durch zahlreiche Individuen von Nereis dumerilii verschiedener Altersstufen konnte
ich die anatomischen Verhältnisse4 * . zentralen Nervensystems und des Bauchmarks, sowie deren