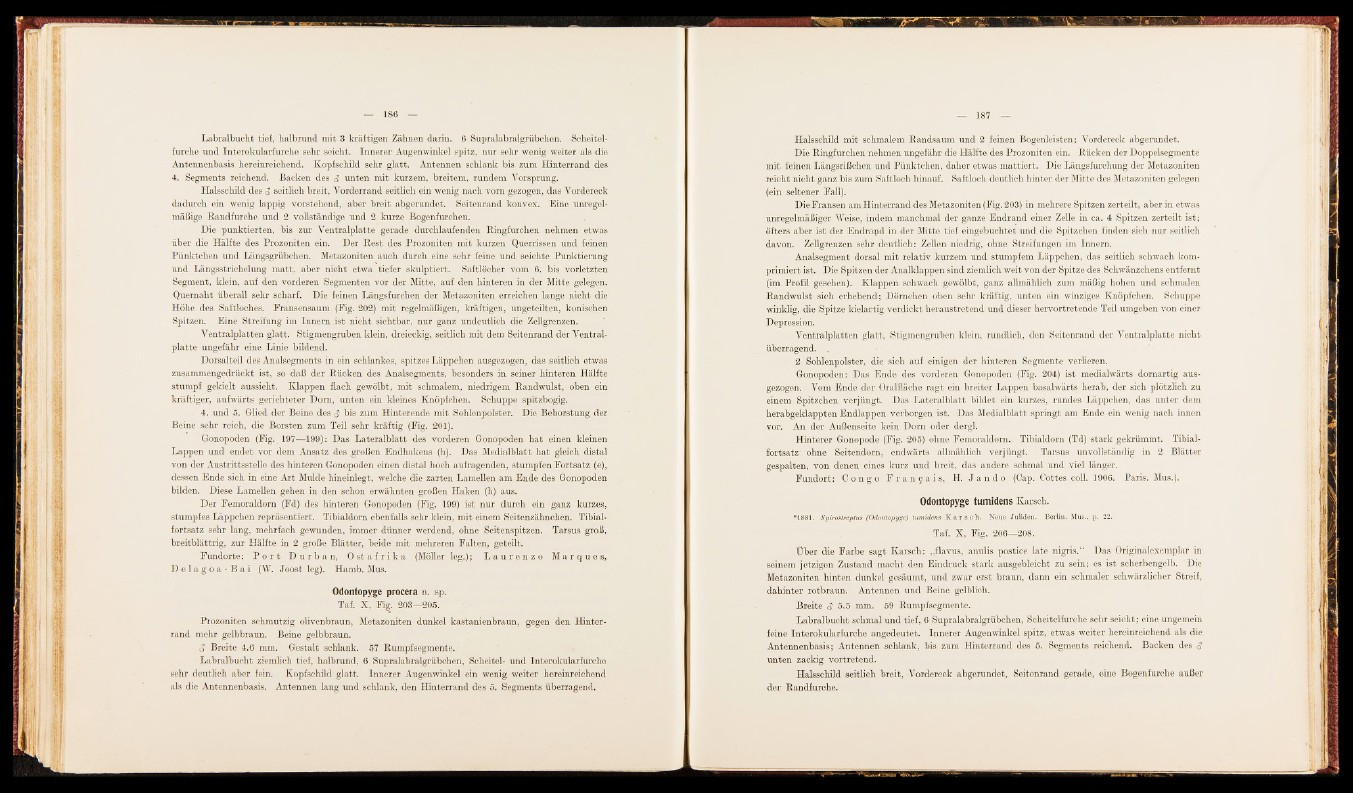
Labralbuclit tief, halbrund mit 3 kräftigen Zähnen darin. 6 Supralabralgrübchen. -Scheitelfurche
und Interokularfurche sehr seicht. Innerer Augenwinkel spitz, nur sehr wenig weiter als die
Antennenbasis, hereinreichend. Kopfschild sehr glatt. Antennen schlank bis zum Hinterrand des
4. Segments reichend. Backen des unten mit kurzem, breitem, rundem Vorsprung.
Halsschild des $ seitlich breit, Vorderrand seitlich ein wenig nach vorn gezogen, das Vordereck
dadurch ein wenig lappig vorstehend, aber breit abgerundet. Seitenrand konvex. Eine unregelmäßige
Randfurche und 2 vollständige und 2 kurze Bogenfurchen.
Die punktierten, bis zur Ventralplatte gerade durchlaufenden Ringfurchen nehmen etwas
über die Hälfte des Prozoniten ein. Der Rest des Prozoniten mit kurzen Querrissen und feinen
Pünktchen und Längsgrübchen. Metazoniten auch durch eine sehr feine und seichte Punktierung
und Längsstrichelung matt, aber nicht etwa tiefer skulptiert. Saftlöcher vom 6. bis vorletzten
Segment, klein, auf den vorderen Segmenten vor der Mitte, auf den hinteren in der Mitte gelegen.
Quernaht überall sehr scharf. Die feinen Längsfurchen der Metazoniten erreichen lange nicht die
Höhe des Saftloches. Eransensaum (Fig. 202) mit regelmäßigen, kräftigen, ungeteilten, konischen
Spitzen. Eine Streifung im Innern ist nicht sichtbar, nur ganz undeutlich die Zellgrenzen.
Ventralplatten glatt. Stigmengruben klein, dreieckig, seitlich mit dem Seitenrand der Ventralplatte
ungefähr eine Linie bildend.
Dorsalteil des Analsegments in ein schlankes, spitzes Läppchen ausgezogen, das seitlich etwas
zusammengedrückt ist, so daß der Rücken des Analsegments, besonders in seiner hinteren Hälfte
stumpf gekielt aussieht. Klappen flach gewölbt, mit schmalem, niedrigem Randwulst, oben ein
kräftiger, aufwärts gerichteter Dom, unten ein kleines Knöpfchen. Schuppe spitzbogig.
4. und 5. Glied der Beine des bis zum Hinterende mit Sohlenpolster. Die Beborstung der
Beine sehr reich, die Borsten, zum Teil sehr kräftig (Fig. 201).
Gonopoden (Fig. 197—199): Das Lateralblatt des vorderen Gonopoden hat einen kleinen
Lappen und endet vor dem Ansatz des großen Endhakens (h). Das Medialblatt hat gleich -distal
von der Austrittsstelle des hinteren Gonopoden einen distal hoch aufragenden, stumpfen Fortsatz (e),
dessen Ende sich in eine Art Mulde hineinlegt, welche die zarten Lamellen am Ende des Gonopoden
bilden. Diese Lamellen gehen in den schon erwähnten großen Haken (h) aus.
Der Femoraldorn (Fd) des hinteren Gonopoden (Fig. 199) ist nur durch ein ganz kurzes,
stumpfes Läppchen repräsentiert. Tibialdorn ebenfalls sehr klein, mit einem Seitenzähnchen. Tibial-
fortsatz sehr lang, mehrfach gewunden, immer dünner werdend, ohne Seitenspitzen. Tarsus groß,
breitblättrig, zur Hälfte in 2 große Blätter, beide mit mehreren Falten, geteilt.
Fundorte: P o r t D u r b a n , O s t a f r i k a (Möller leg.); L a u r e n z o Ma r q u e s ,
D e l a g o a - B a i (W. Joost leg). Hamb. Mus.
Odontopyge procera n. sp.
Taf. X, Fig. 203—205.
Prozoniten schmutzig olivenbraun, Metazoniten dunkel kastanienbraun, gegen den Hinterrand
mehr gelbbraun. Beine gelbbraun.
o Breite 4.6 mm. Gestalt schlank. 57 Rumpf Segmente.
Labralbucht ziemlich tief, halbrund, 6 Supralabralgrübchen, Scheitel- und Interokularfurche
sehr deutlich aber fein. Kopfschild glatt. Innerer Augenwinkel ein wenig weiter hereinreichend
als die Antennenbasis. Antennen lang und schlank, den Hinterrand des 5. Segments überragend.
Halsschild mit schmalem Randsaum und 2 feinen Bogenleisten; Vordereck abgerundet.
Die Ringfurchen nehmen ungefähr die Hälfte des Prozoniten ein. Rücken der Doppelsegmente
mit feinen Längsrißchen und Pünktchen, daher etwas mattiert. Die Längsfurchung der Metazoniten
reicht nicht ganz bis zum Saftloch hinauf. Saftloch deutlich hinter der Mitte des Metazoniten gelegen
(ein seltener Fall).
Die Fransen am Hinterrand des Metazoniten (Fig. 203) in mehrere Spitzen zerteilt, aber in etwas
unregelmäßiger Weise, indem manchmal der ganze Endrand einer Zelle in ca. 4 Spitzen zerteilt ist;
öfters aber ist der Endrapd in der Mitte tief eingebuchtet und die Spitzchen finden sich nur seitlich
davon. Zellgrenzen sehr deutlich: Zellen niedrig,, ohne Streifungen im Innern.
Analsegment, dorsal mit relativ kurzem und stumpfem Läppchen, das seitlich schwach komprimiert
ist. Die Spitzen der Analklappen sind ziemlich weit von der Spitze des Schwänzchens entfernt
(im Profil gesehen). Klappen schwach gewölbt, ganz allmählich zum mäßig hohen und schmalen
Randwülst sich erhebend; Dörnchen oben sehr kräftig, unten ein winziges Knöpfchen. Schuppe
winklig, die Spitze kielartig verdickt heraustretend und dieser hervortretende Teil umgeben von einer
Depression.
Ventralplatten glatt, Stigmengruben klein, rundlich, den Seitenrand der Ventralplatte nicht
überragend. .
2 Sohlenpolster, die sich auf einigen der hinteren Segmente verlieren.
Gonopoden: Das Ende des vorderen Gonopoden (Fig. 204) ist medialwärts dornartig aus-
gezogen. Vom Ende der Oralfläche ragt ein breiter Lappen basalwärts herab, der sich plötzlich zu
einem Spitzchen verjüngt. Das Lateralblatt bildet ein kurzes, rundes Läppchen, das unter dem
herabgeklappten Endlappen verborgen ist. Das Medialblatt springt am Ende ein wenig nach innen
vor. An der Außenseite kein Dorn oder dergl.
Hinterer Gonopode (Fig. 205) ohne Femoraldorn. Tibialdorn (Td) stark gekrümmt. Tibial-
fortsatz ohne Seitendorn, endwärts allmählich verjüngt. Tarsus unvollständig in 2 Blätter
gespalten, von denen eines kurz und breit, das andere schmal und viel länger.
Fundort: C o n g 0 F r a n ç a i s , H. J a n d o - (Cap. Cottes coll. 1906. Paris. Mus.).
Odontopyge tumidens Karsch.
*1881. Spiroètreptus (Odontopyge) tumidens K a r s c h . Neue Juliden. Berlin. Mus., p. 22.
Taf. X, Fig. 206—208.
Über die Farbe sagt Karsch: „flavus, anulis postice late nigris.“ Das Originalexemplar in
seinem jetzigen Zustand macht den Eindruck stark ausgebleicht zu sein;, es ist scherbengelb. Die
Metazoniten hinten dunkel gesäumt, und zwar erst braun, dann ein schmaler schwärzlicher Streif,
dahinter rotbraun. Antennen und Beine gelblich.
Breite 3 5.5 mm. 59 Rumpfsegmente.
Labralbucht schmal und tief, 6 Supralabralgrübchen, Scheitelfurche sehr seicht; eine ungemein
feine Interokularfurche angedeutet. Innerer Augenwinkel spitz, etwas weiter hereinreichend als die
Antennenbasis; Antennen schlank, bis zum Hinterrand des 5. Segments reichend. Backen des $
unten zackig vortretend.
Halsschild seitlich breit, Vordereck abgerundet, Seitenrand gerade, eine Bogenfurche außer
der Randfurche.