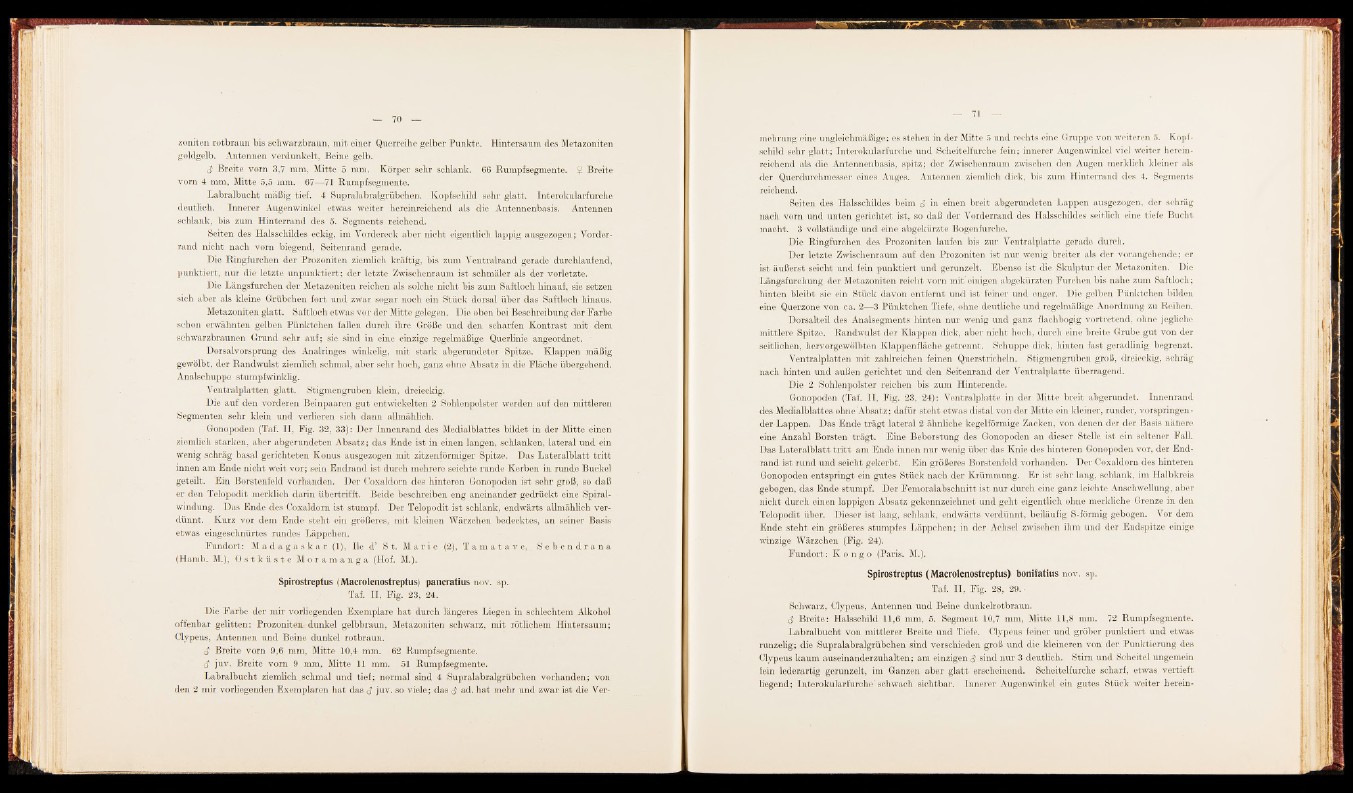
zoniten rotbraun bis schwarzbraun, mit einer Querreibe gelber Punkte. Hintersaum des Metazoniten
goldgelb. Antennen verdunkelt, Beine gelb.
Breite vorn 3,7 mm, Mitte 5 mm. Körper sehr schlank. 66 Rumpfsegmente. $ Breite
vorn 4 mm, Mitte 5,5 mm. 67—71 Rumpfsegmente.
Labralbucht mäßig tief. 4 Supralabralgrübchen. Kopfschild sehr glatt. Interokularfurche
deutlich. Innerer Augenwinkel etwas weiter hereinreichend als die Antennenbasis. Antennen
schlank, bis zum Hinterrand des 5. Segments reichend.
Seiten des Halsschildes eckig, im Vordereck aber nicht eigentlich lappig ausgezogen; Vorderrand
nicht nach vorn biegend, Seitenrand gerade.
Die Ringfurchen der Prozoniten ziemlich kräftig, bis zum Ventralrand gerade durchlaufend,
punktiert, nur die letzte unpunktiert; der letzte Zwischenraum ist schmäler als der vorletzte.
Die Längsfurchen der Metazoniten reichen als solche nicht bis zum Saftloch hinauf, sie setzen
sich aber als kleine Grübchen fort und zwar sogar noch ein Stück dorsal über das Saftloch hinaus.
Metazoniten glatt. Saftloch etwas vor der Mitte gelegen. Die oben bei Beschreibung der Farbe
schon erwähnten gelben Pünktchen fallen durch ihre Größe und den scharfen Kontrast mit dem
schwarzbraunen Grund sehr auf; sie sind in eine einzige regelmäßige Querlinie angeordnet.
Dorsalvorsprung des Analringes winkelig, mit stark abgerundeter Spitze. Klappen mäßig
gewölbt, der Randwulst ziemlich schmal, aber sehr hoch, ganz ohne Absatz in die Fläche übergehend.
Analschuppe stumpfwinklig.
Ventralplatten glatt,. Stigmengruben klein, dreieckig.
Die auf den vorderen Beinpaaren gut entwickelten 2 Sohlenpolster werden auf den mittleren
Segmenten sehr klein und verlieren sich dann allmählich.
Gonopoden (Taf. II, Fig. 32, 33): Der Innenrand des Medialblattes bildet in der Mitte einen
ziemlich starken, aber abgerundeten Absatz; das Ende ist in einen langen, schlanken, lateral und ein
wenig schräg basal gerichteten Konus ausgezogen mit zitzenförmiger Spitze. Das Lateralblatt tritt
innen am Ende nicht weit vor; sein Endrand ist durch mehrere seichte runde Kerben in runde Buckel
geteilt. Ein Borstenfeld vorhanden. Der Coxaldorn des hinteren Gonopoden ist sehr groß, so daß
er den Telopodit merklich darin übertrifft. Beide beschreiben eng aneinander gedrückt eine Spiralwindung.
Das Ende des Coxaldorn ist stumpf. Der Telopodit ist schlank, endwärts allmählich verdünnt.
Kurz vor dem Ende steht ein größeres, mit kleinen Wärzchen bedecktes, an seiner Basis
etwas eingeschnürtes rundes Läppchen.
Fundort: M a d a g a s k a r (1), Ile d’ S t. Ma r i e (2), T a m a t a v e , . . S e b e n d r a n a
(Hamb. M.), O s t k ü s t e M o r a m a n g a (Hof. M.).
Spirostreptus (Macrolenostreptus) pancratius nov. sp.
Taf. II, Fig. 23, 24.
Die Farbe der mir vorliegenden Exemplare hat durch längeres Liegen in schlechtem Alkohol
offenbar gelitten: Prozoniten. dunkel gelbbraun, Metazoniten schwarz, mit rötlichem Hintersaum;
Clypeus, Antennen und Beine dunkel rotbraun.
d Breite vorn 9,6 mm, Mitte 10,4 mm. 62 Rumpfsegmente.
d juv. Breite vom 9 mm, Mitte 11 mm. 51 Rumpfsegmente.
Labralbucht ziemlich.schmal und tief; normal sind 4 Supralabralgrübchen vorhanden; von
den 2 mir vorliegenden Exemplaren hat das S juv. so viele; das $ ad. hat mehr und zwar ist die Vermehrung
eine ungleichmäßige; es stehen in der Mitte 5 und rechts eine Gruppe von weiteren 5. Kopf-
schild sehr glatt; Interokularfurche und Scheitelfurche fein; innerer Augenwinkel viel Weiter hereinreichend
als die Antennenbasis, spitz; der Zwischenraum zwischen den Augen merklich kleiner als
der Querdurchmesser eines Auges. Antennen ziemlich dick, bis zum Hinterrand des 4. Segments
reichend.
Seiten des Halsschildes beim in einen breit abgerundeten Lappen ausgezogen, der schräg
nach vorn und unten gerichtet ist, so daß der Vorderrand des Halsschildes seitlich eine tiefe Bucht
macht. 3 vollständige und eine abgekürzte Bogenfurche.
Die Ringfurchen des Prozoniten laufen bis zur Ventralplatte gerade durch.
Der letzte Zwischenraum auf den Prozoniten ist nur wenig breiter als der vorangehende; er
ist äußerst seicht und fein punktiert und gerunzelt. Ebenso ist die Skulptur der Metazoniten. Die
Längsfurchung der Metazoniten reicht vorn mit einigen abgekürzten Furchen bis nahe zum Saftloch;
hinten bleibt sie ein Stück davon entfernt und ist feiner und enger. Die gelben Pünktchen bilden
eine Querzone von ca. 2—3 Pünktchen Tiefe, ohne deutliche und regelmäßige Anordnung zu Reihen.
Dorsalteil des Analsegments hinten nur wenig und ganz flachbogig vortretend, ohne jegliche
mittlere Spitze. Randwulst der Klappen dick, aber nicht hoch, durch eine breite Grube gut von der
seitlichen, hervorgewölbten Klappenfläche getrennt. Schuppe dick, hinten fast geradlinig begrenzt.
Ventralplatten mit zahlreichen feinen Querstricheln. Stigmengruben groß, dreieckig, schräg
nach hinten und außen gerichtet und den Seitenrand der Ventralplatte überragend.
Die 2 Sohlenpolster reichen bis zum Hinterende.
Gonopoden (Taf. II, Fig. 23, 24): Ventralplatte in der Mitte breit abgerundet. Innenrand
des Medialblattes ohne Absatz; dafür steht etwas distal von der Mitte ein kleiner, runder, vorspringender
Lappen. Das Ende trägt lateral 2 ähnliche kegelförmige Zacken, von denen der der Basis näiiere
eine Anzahl Borsten trägt. Eine Beborstung des Gonopoden an dieser Stelle ist ein seltener Fall.
Das Lateralblatt tritt am Ende innen nur wenig über das Knie des hinteren Gonopoden vor, der Endrand
ist rund und seicht gekerbt. Ein größeres Borstenfeld vorhanden. Der Coxaldorn des hinteren
Gonopoden entspringt ein gutes Stück nach der Krümmung. Er ist sehr lang, schlank, im Halbkreis
gebogen, das Ende stumpf. Der Femoralabschnitt ist nur durch eine ganz leichte Anschwellung, aber
nicht durch einen lappigen Absatz gekennzeichnet und geht eigentlich ohne merkliche Grenze in den
Telopodit über. Dieser ist lang, schlank, endwärts verdünnt, beiläufig S-förmig gebogen. Vor dem
Ende steht ein größeres stumpfes Läppchen; in der Achsel zwischen ihm und der Endspitze einige
winzige Wärzchen (Fig. 24).
Fundort: K o n g o (Paris. M.).
Spirostreptus (Macrolenostreptus) bonifatius nov. sp.
Taf. II, Fig. 28, 29. ■
Schwarz, Clypeus, Antennen und Beine dunkelrotbraun.
d Breite: Halsschild 11,6 mm, 5. Segment 10,7 mm, Mitte 11,8 mm. 72 Rumpfsegmente.
Labralbucht von mittlerer Breite und Tiefe. Clypeus feiner und gröber punktiert und etwas
runzelig; die Supralabralgrübchen sind verschieden groß und die kleineren von der Punktierung des
Clypeus kaum auseinanderzuhalten; am einzigen $ sind nur 3 deutlich. Stirn und Scheitel ungemein
fein lederartig gerunzelt, im Ganzen aber glatt erscheinend. Scheitelfurche scharf, etwas vertieft
liegend; Interokularfurche schwach sichtbar. Innerer Augenwinkel ein gutes Stück weiter herein