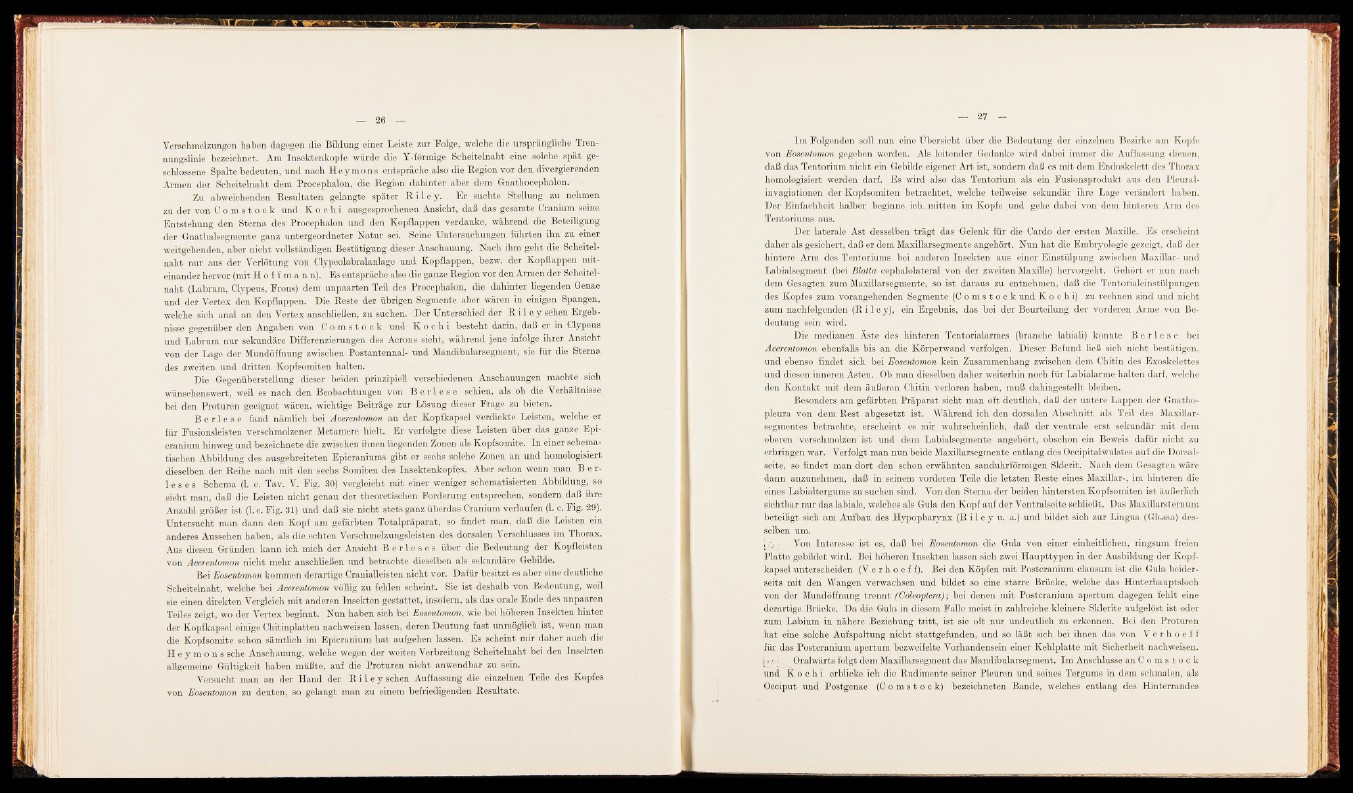
Verschmelzungen haben dagegen die Bildung einer Leiste zur Folge, welche die ursprüngliche Trennungslinie
bezeichnet. Am Insektenkopfe würde die Y-förmige Scheitelnaht eine solche spät geschlossene
Spalte bedeuten, und nach Heymons entspräche also die Region vor den divergierenden
Armen der Scheitelnaht dem Procephalon, die Region dahinter aber dem Gnathocephalon. -
Zu abweichenden Resultaten gelangte später R i 1 e y. Er suchte Stellung zu nehmen
zu der von C o m s t o c k und K o c h i ausgesprochenen Ansicht, daß das gesamte Cranium seine
Entstehung den Sterna des Procephalon und den Kopflappen verdanke, während die Beteiligung
der Gnathalsegmente ganz untergeordneter Natur sei. Seine Untersuchungen führten ihn zu einer
weitgehenden, aber nicht vollständigen Bestätigung dieser Anschauung. Nach ihm geht die Scheitelnaht
nur aus der Verlötung von Clypeolabralanlage und Kopflappen, bezw. der Kopflappen miteinander
hervor (mit H o f f m a n n). Es entspräche also die ganze Region vor den Armen der Scheitelnaht
(Labrum, Clypeus, Frons) dem unpaarten Teil des Procephalon, die dahinter liegenden Genae
und der Vertex den Kopflappen. Die Reste der übrigen Segmente aber wären in einigen Spangen,
welche sich anal an den Vertex anschließen, zu suchen. Der Unterschied der R i l e y sehen Ergebnisse
gegenüber den Angaben von C o m s t o c k und K o c h i besteht darin, daß er in Clypeus
und Labrum nur sekundäre Differenzierungen des Acrons sieht, während jene infolge ihrer Ansicht
von der Lage der Mundöffnung zwischen Postantennal- und Mandibularsegment, sie für die Sterna
des zweiten und dritten Kopfsomiten halten.
Die Gegenüberstellung dieser beiden prinzipiell verschiedenen Anschauungen machte sich
wünschenswert, weil es nach den Beobachtungen von B e r l e s e schien, als ob die Verhältnisse
bei den Proturen geeignet wären, wichtige Beiträge zur Lösung dieser Frage zu bieten.
B e r 1 e s e fand nämlich bei Acerentomon an der Kopfkapsel verdickte Leisten, welche er
für Fusionsleisten verschmolzener Metamere hielt. Er verfolgte diese Leisten über das ganze Epi-
cranium hinweg und bezeichnete die zwischen ihnen liegenden Zonen als Kopfsomite. In einer schematischen
Abbildung des ausgebreiteten Epicraniums gibt er sechs solche Zonen an und homologisiert
dieselben der Reihe nach mit den sechs Somiten des Insektenkopfes. Aber schon wenn man Ber -
1 e s e s Schema (1. c. Tav. V. Fig. 30) vergleicht mit einer weniger schematisierten Abbildung, so
sieht man, daß die Leisten nicht genau der theoretischen Forderung entsprechen, sondern daß ihre
Anzahl größer ist (1. c. Fig. 31) und daß sie nicht stets ganz überdas Cranium verlaufen (1. c. Fig. 29).
Untersucht man dann den Kopf am gefärbten Totalpräparat, so findet man, daß die Leisten ein
anderes Aussehen haben, als die echten Verschmelzungsleisten des dorsalen Verschlusses im Thorax.
Aus diesen Gründen kann ich mich der Ansicht B e r l e s e s über die Bedeutung der Kopfleisten
von Acerentomon nicht mehr anschließen und betrachte dieselben als sekundäre Gebilde.
Bei Eosentomon kommen derartige Cranialleisten nicht vor. Dafür besitzt es aber eine deutliche
Scheitelnaht, welche bei Acerentomon völlig zu fehlen scheint. Sie ist deshalb von Bedeutung, weil
sie einen direkten Vergleich mit anderen Insekten gestattet, insofern, als das orale Ende des unpaaren
Teiles zeigt, wo der Vertex beginnt. Nun haben sich bei Eosentomon, wie bei höheren Insekten hinter
der Kopfkapsel einige Chitinplatten nachweisen lassen, deren Deutung fast unmöglich ist, wenn man
die Kopfsomite schon sämtlich im Epicranium hat aufgehen lassen. Es scheint mir daher auch die
H e y m o n s sehe Anschauung, welche wegen der weiten Verbreitung Scheitelnaht bei den Insekten
allgemeine Gültigkeit haben müßte, auf die Proturen nicht anwendbar zu sein.
Versucht man an der Hand der R ile y s e h e n Auffassung die einzelnen Teile des Kopfes
von Eosentomon zu deuten, so gelangt man zu einem befriedigenden Resultate.
Im Folgenden soll nun eine Übersicht über die Bedeutung der einzelnen Bezirke am Kopfe
von Eosentomon gegeben werden. Als leitender Gedanke wird dabei immer die Auffassung dienen,
daß das Tentorium nicht ein Gebilde eigener Art ist, sondern daß es mit dem Endoskelett des Thorax
homologisiert werden darf. Es wird also das Tentorium als ein Fusionsprodukt aus den Pleural-
invagiationen der Kopfsomiten betrachtet, welche teilweise sekundär ihre Lage verändert haben.
Der Einfachheit halber beginne ich,, mitten im Kopfe und gehe dabei von dem hinteren Arm des
Tentoriums aus.
Der laterale Ast desselben trägt das Gelenk für die Cardo der ersten Maxille. Es erscheint
daher als gesichert, daß er dem Maxillarsegmente angehört. Nun hat die Embryologie gezeigt, daß der
hintere Arm des Tentoriums bei anderen Insekten aus einer Einstülpung zwischen Maxillar- und
Labialsegment (bei Blatta cephalolateral von der zweiten Maxille) hervorgeht. Gehört er nun nach
dem Gesagten zum Maxillarsegmente, so ist daraus zu entnehmen, daß die Tentorialeinstülpungen
des Kopfes zum vorangehenden Segmente ( C o m s t o c k und K o c h i) zu rechnen sind und nicht
zum nachfolgenden (Ri ley) , ein Ergebnis, das bei der Beurteilung der vorderen Arme von Bedeutung
sein wird.
Die medianen Äste des hinteren Tentorialarmes (branche labiali) konnte B e r 1 e s e bei
Acerentomon ebenfalls bis an die Körperwand verfolgen. Dieser Befund ließ sich nicht bestätigen,
und ebenso findet sich bei Eosentomon kein Zusammenhang zwischen dem Chitin des Exoskelettes
und diesen inneren Ästen. Ob man dieselben daher weiterhin noch für Labialarme halten darf, welche
den Kontakt mit dem äußeren Chitin verloren haben, muß dahingestellt bleiben.
Besonders am gefärbten Präparat sieht man oft deutlich, daß der untere Lappen der Gnatho-
pleura von dem Rest abgesetzt ist. Während ich den dorsalen Abschnitt als Teil des Maxillar-
segmentes betrachte, erscheint es mir wahrscheinlich, daß der ventrale erst sekundär mit dem
oberen verschmolzen ist und dem Labialsegmente angehört, obschon ein Beweis dafür nicht zu
erbringen war. Verfolgt man nun beide Maxillarsegmente entlang des Occipitalwulstes auf die Dorsalseite,
so findet man dort den schon erwähnten sanduhrförmigen Sklerit. Nach dem Gesagten wäre
dann anzunehmen, daß in seinem vorderen Teile die letzten Reste eines Maxillar-, im hinteren die
eines Labialtergums zu suchen sind. Von den Sterna der beiden hintersten Kopfsomiten ist äußerlich
sichtbar nur das labiale, welches als Gula den Kopf auf der Ventralseite schließt. Das Maxillarsternum
beteiligt sich am Aufbau des Hypopharynx (R i 1 e y u. a.) und bildet sich zur Lingua (Glovssa) desselben
um.
i Von Interesse ist es, daß bei Eosentomon die Gula von einer einheitlichen, ringsum freien
Platte gebildet wird. Bei höheren Insekten lassen sich zwei Haupttypen in der Ausbildung der Kopfkapsel
unterscheiden (V e r h o e f f). Bei den Köpfen mit Postcranium clausum ist die Gula beiderseits
mit den Wangen verwachsen und bildet so eine starre Brücke, welche das Hinterhauptsloch
von der Mundöffnung trennt (Coleoptera); bei denen mit Postcranium apertum dagegen fehlt eine
derartige Brücke. Da die Gula in diesem Falle meist in zahlreiche kleinere Sklerite aufgelöst ist oder
zum Labium in nähere Beziehung tritt, ist sie oft nur undeutlich zu erkennen. Bei den Proturen
hat eine solche Aufspaltung nicht stattgefunden, und so läßt sich bei ihnen das von V e r h o e f f
für das Postcranium apertum bezweifelte Vorhandensein einer Kehlplatte mit Sicherheit nachweisen.
L i\ i Oralwärts folgt dem Maxillarsegment das Mandibularsegment. Im Anschlüsse an C o m s t o c k
und K o c h i erblicke ich die Rudimente seiner Pleuren und seines Tergums in dem schmalen, als
Occiput und Postgenae ( Co ms t o c k ) bezeichneten Bande, welches entlang des Hinterrandes