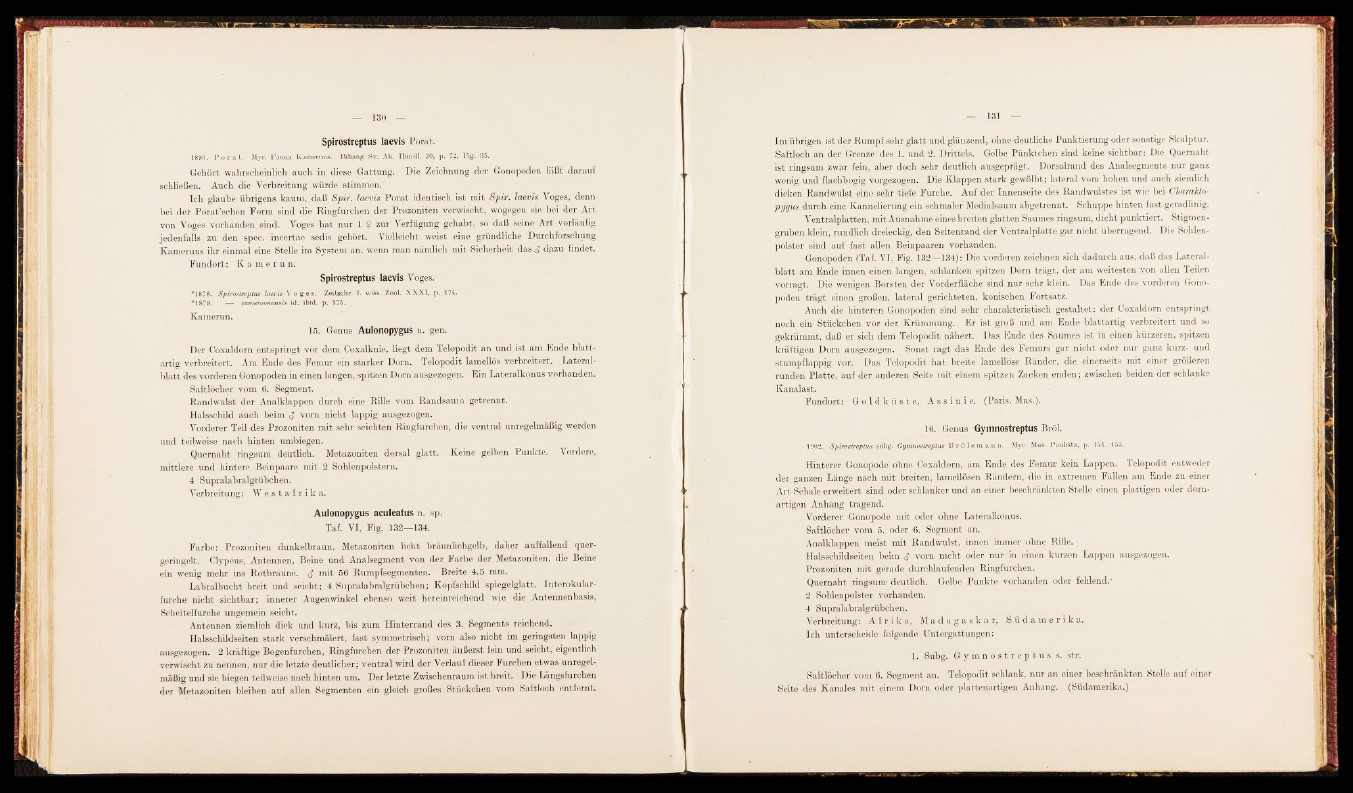
Spirostreptus laevis Porat.
1893. P o r a t . Myr. F au n a Kameruns. Bihang Sv. Ak. Handl. 20, p. 72, Fig. 35. .
Gehört wahrscheinlich auch in diese Gattung. Die Zeichnung der Gonopoden läßt darauf
schließen. Auch die Verbreitung würde stimmen.
Ich glaube übrigens, kaum, daß Spir. laevis Porat identisch ist mit Spir. laevis Voges, denn
bei der Porat’schen Form sind die Ringfurchen der Prozoniten verwischt, wogegen sie bei der Art
von Voges vorhanden sind. Voges hat nur 1 $ zur Verfügung gehabt, so daß seine Art vorläufig
jedenfalls zu den spec. incertae sedis gehört. Vielleicht weist eine gründliche Durchforschung
Kameruns ihr einmal eine Stelle im System an, wenn man nämlich mit Sicherheit das cJ dazu findet.
Fundort: K a m e r u n .
Spirostreptus laevis Voges.
*1878. Spirostreptus laevis V o g e s . Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX I, p. 174.
*1878. — cameroonensis id. ibid. p. 175.
Kamerun.
15 Genus Aulonopygus n. gen.
Der Coxaldorn entspringt vor dem Coxalknie, liegt dem Telopodit an und ist am Ende blattartig
verbreitert. Am Ende des Femur ein starker Dom. Telopodit lamellös verbreitert. Lateralblatt
des vorderen Gonopoden in einen langen, spitzen Dorn ausgezogen. Ein Lateralkonus vorhanden.
Saftlöcher vom 6. Segment.
Randwulst der Analklappen durch eine Rille vom Randsaum getrennt.
Halsschild auch beim S vorn nicht lappig ausgezogen.
Vorderer Teil des Prozoniten mit sehr seichten Ringfurchen, die ventral unregelmäßig werden
und teilweise nach hinten umbiegen.
Quernaht ringsum deutlich. Metazoniten dorsal glatt. Keine gelben Punkte. Vordere,
mittlere und hintere Beinpaare mit 2 Sohlenpolstern.
4 Supralabralgrübchen.
Verbreitung: W e s t a f r i k a.
Aulonopygus aculeatus n. sp.
Taf. VI, Fig. 132—134.
Farbe: Prozoniten dunkelbraun, Metazoniten licht bräunlichgelb, daher auffallend quergeringelt.
Clypeus, Antennen, Beine und Analsegment von der Farbe der Metazoniten, die Beine
ein wenig mehr ins Rotbraune. $ mit 56 Rumpf Segmenten. Breite 4.5 mm.
Labralbucht breit und seicht; 4 Supralabralgrübchen; Kopfschild spiegelglatt. Interokular-
furche- nicht sichtbar; innerer Augenwinkel ebenso weit hereinreichend wie die Antennenbasis,
Scheitelfurche ungemein seicht.
Antennen ziemlich dick und kurz, bis zum Hinterrand des 3. Segments reichend.
Halsschildseiten stark verschmälert, fast symmetrisch; vorn also nicht im geringsten lappig
ausgezogen. 2 kräftige Bogenfurchen, Ringfurchen der Prozoniten äußerst fein und seicht, eigentlich
verwischt zu nennen, nur die letzte deutlicher; ventral wird der Verlauf dieser Furchen etwas unregelmäßig
und sie biegen teilweise nach hinten um. Der letzte Zwischenraum ist breit. Die Längsfurchen
der Metazoniten bleiben auf allen Segmenten ein gleich großes Stückchen vom Saftloch entfernt.
Im übrigen ist der Rumpf sehr glatt und glänzend, ohne deutliche Punktierung oder sonstige Skulptur.
Saftloch an der Grenze des 1. und 2. Drittels. Gelbe Pünktchen sind keine sichtbar: Die Quernaht
ist ringsum zwar fein, aber doch sehr deutlich ausgeprägt. Dorsalrand des Analsegments nur ganz
wenig und flachbogig vorgezogen. Die Klappen stark gewölbt; lateral vom hohen und auch ziemlich
dicken Randwulst eine sehr tiefe Furche. Auf der Innenseite des Randwulstes ist wie bei CharaJcto-
pygus durch eine Kannelierung ein schmaler Medialsaum abgetrennt. Schuppe hinten fast geradlinig.
Ventralplatten, mit Ausnahme eines breiten glatten Saumes ringsum, dicht punktiert. Stigmengruben
klein, rundlich dreieckig, den Seitenrand der Ventralplatte gar nicht überragend. Die Sohlenpolster
sind auf fast allen. Beinpaaren vorhanden.
Gonopoden (Taf. VI, Fig. 132—134): Die vorderen zeichnen sich dadurch aus, daß das Lateralblatt
am Ende innen einen langen, schlanken spitzen Dorn trägt, der am weitesten von allen Teilen
vorragt. Die wenigen Borsten der Vorderfläche sind nur sehr klein. Das Ende des vorderen Gonopoden
trägt einen großen, lateral gerichteten, konischen Fortsatz.
Auch die hinteren Gonopoden sind sehr charakteristisch gestaltet: der Coxaldorn entspringt
noch ein Stückchen vor der Krümmung. Er ist groß und am Ende blattartig verbreitert und so
gekrümmt, daß er sich dem Telopodit nähert. Das Ende des Saumes ist in einen kürzeren, spitzen
kräftigen Dorn ausgezogen. Sonst ragt das Ende des Femurs gar nicht oder nur ganz kurz- und
stumpflappig vor. Das Telopodit hat breite lamellöse Ränder, die einerseits mit einer größeren
runden Platte, auf der anderen Seite mit einem spitzen Zacken enden; zwischen beiden der schlanke
Kanalast.
Fundort: G o l d k ü s t e , A s s i n i e. (Paris. Mus.).
16. Genus Gymnostreptus Bröl.
1902. Spirostreptus subg. Gymnostreptus B r ö l e m a n n . Myr. Mus. Paulista, p. 141. 153.
Hinterer Gonopode ohne Coxaldorn, am Ende des Femur kein Lappen. Telopodit entweder
der ganzen Länge nach mit breiten, lamellösen Rändern, die in extremen Fällen am Ende zu einer
Art Schale erweitert sind oder schlanker und an einer beschränkten Stelle einen plattigen oder domartigen
Anhang tragend.
Vorderer Gonopode mit oder ohne Lateralkonus.
Saftlöcher vom 5. oder 6. Segment an.
Analklappen meist mit Randwulst, innen immer ohne Rille.
Halsschildseiten beim $ vorn nicht oder nur in einen kurzen Lappen ausgezogen.
Prozoniten mit gerade durchlaufenden Ringfurchen.
Quernaht ringsum* deutlich. Gelbe Punkte vorhanden oder fehlend.-
2 Sohlenpolster vorhanden.
4 Supralabralgrübchen.
Verbreitung: A f r i k a , Ma d a g a s k a r , S ü d a m e r i k a .
Ich unterscheide folgende Untergattungen:
1. Subg. G y m n o s t r e p t u s s. str.
Saftlöcher vom 6. Segment an. Telopodit schlank, nur an einer beschränkten Stelle auf einer
Seite des Kanales mit einem Dorn oder plattenartigen Anhang. (Südamerika.)