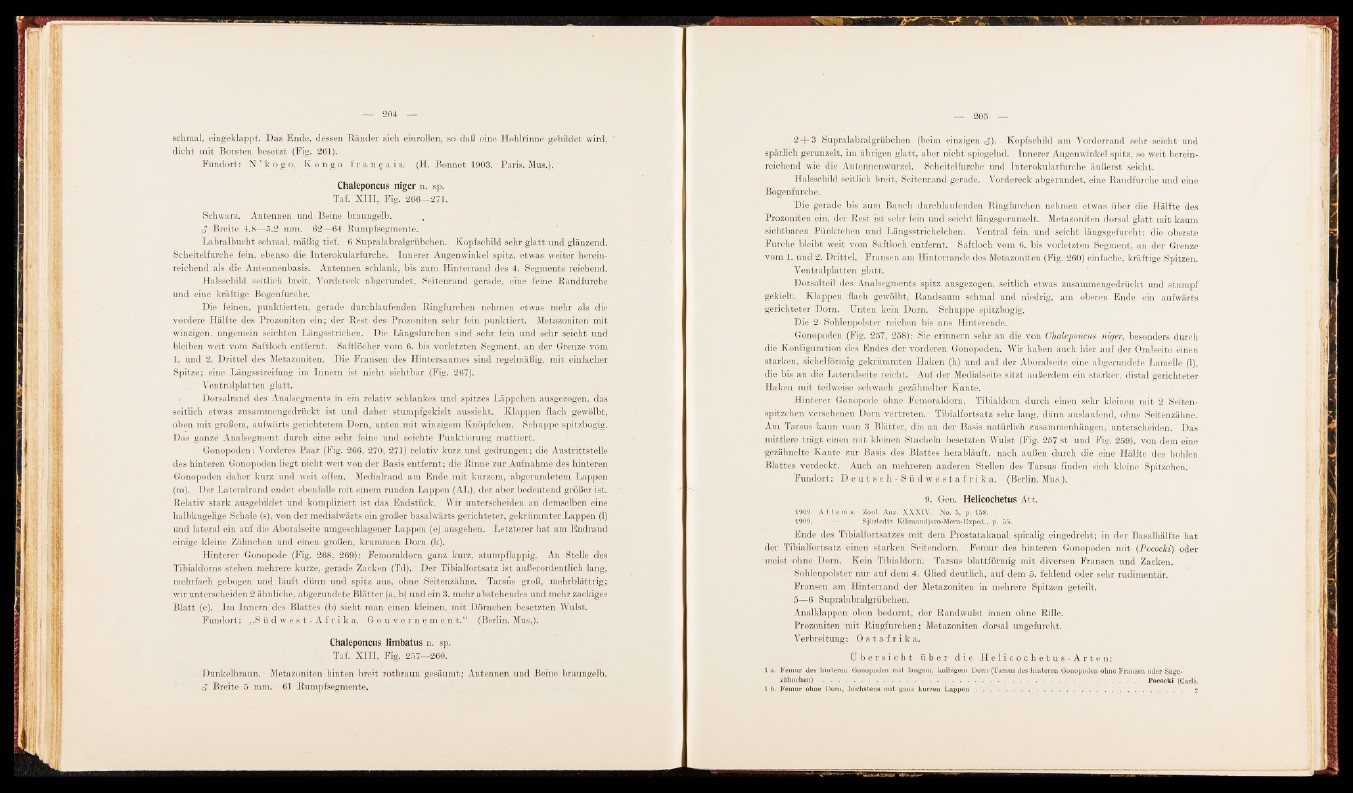
schmal, eingeklappt. Das Ende, dessen Ränder sich einrollen, so daß eine Hohlrinne gebildet wird,
dicht mit Borsten besetzt (Fig. 261).
Fundort: N ’ k o g o, K o n g o f r a n ç a i s . (H. Bonnet 1903. Paris. Mus.).
Chaleponcus niger n. sp.
Taf. XIII, Fig. 266—271.
Schwarz. Antennen und Beine braungelb.
(J Breite 4.8—5.2 mm. 62—64 Rumpfsegmente.
Labralbueht schmal, mäßig tief. 6 Supralabralgrübchen. Kopfschild sehr glatt und glänzend.
Scheitelfurche fein, ebenso die Interokularfurche. Innerer Augenwinkel spitz, etwas weiter hereinreichend
als die Antennenbasis. Antennen schlank, bis zum Hinterrand des 4. Segments reichend.
Halsschild seitlich breit, Vordereck abgerundet, Seitenrand gerade, eine feine Randfurche
und eine kräftige Bogenfurche.
Die feinen, punktierten, gerade durchlaufenden Ringfurchen nehmen etwas mehr als die
vordere Hälfte des Prozoniten ein; der Rest des Prozoniten sehr fein punktiert. Metazoniten mit,
winzigen, ungemein seichten Längsstrichen. Die Längsfurchen sind sehr fein und sehr seicht und
bleiben weit vom Saftloch entfernt. Saftlöcher vom 6. bis vorletzten Segment, an der Grenze vom
1. und 2. Drittel des. Metazoniten. Die Fransen des Hintersaumes sind regelmäßig, mit einfacher
Spitze; eine Längsstreifung im Innern ist nicht sichtbar (Fig. 267).
Ventralplatten glatt,
Dorsalrand des Analsegments in ein relativ schlankes und spitzes Läppchen ausgezogen, das
seitlich etwas zusammengedrückt ist und daher stumpfgekielt aussieht. Klappen flach gewölbt,
oben mit großem, aufwärts gerichtetem Dorn, unten mit winzigem Knöpfchen. Schuppe spitzbogig.
Das ganze Analsegment durch eine sehr feine und seichte Punktierung mattiert.
Gonopoden: Vorderes Paar (Fig. 266, 270, 271) relativ kurz und gedrungen; die Austrittstelle
des hinteren Gonopoden liegt nicht weit von der Basis entfernt; die Rinne zur Aufnahme des hinteren
Gonopoden daher kurz und weit offen. Medialrand am Ende mit kurzem, abgerundetem Lappen
(m). Der Lateralrand endet ebenfalls mit einem runden Lappen (AL), der aber bedeutend größer ist.
Relativ stark ansgebildet und kompliziert ist das Endstück. Wir unterscheiden an demselben eine
halbkugelige Schale (s), von der medialwärts ein großer basalwärts gerichteter, gekrümmter Lappen (1)
und lateral ein auf die Aboralseite nmgeschlagener Lappen (e) ausgehen. Letzterer hat am Endrand
einige kleine Zähnchen und einen großen, krummen Dorn (k).
Hinterer Gonopode (Fig. 268, 269): Femoraldorn ganz kurz, stumpflappig. An Stelle des
Tibialdorns stehen mehrere kurze, gerade Zacken (Td). Der Tibialfortsatz ist außerordentlich lang,
mehrfach gebogen und läuft dünn und spitz aus, ohne Seitenzähne. Tarsus groß, mehrblättrig;
wir unterscheiden 2 ähnliche, abgerundete Blätter (a, b) und ein 3. mehr abstehendes und mehr zackiges
Blatt (c). Im Innern des Blattes (b) sieht man einen kleinen, mit Dörnchen besetzten Wulst.
Fundort: „S ü d w e s t - A f r i k a, G o u v e r n e m e n t . “ (Berlin. Mus.).
Chaleponcus limbatus n. sp.
Taf. XIII, Fig. 257—260.
Dunkelbraun. Metazoniten hinten breit rotbraun gesäumt; Antennen und Beine braungelb.
cJ Breite 5 mm. 61 Rumpf segmente.
2 + 3 Supralabralgrübchen (beim einzigen <$). Kopfschild am Vorderrand sehr seicht und
spärlich gerunzelt, im übrigen glatt, aber nicht spiegelnd. Innerer Augenwinkel spitz, so weit hereinreichend
wie die Antennenwurzel. Scheitelfurche und Interokularfurche äußerst seicht.
Halsschild seitlich breit, Seitenrand gerade. Vordereck abgerundet, eine Randfurche und eine
Bogenfurche.
Die gerade bis zum Bauch durchlaufenden Ringfurchen nehmen etwas über die Hälfte des
Prozoniten ein, der Rest ist sehr fein und seicht längsgerunzelt. Metazoniten dorsal glatt mit kaum
sichtbaren Pünktchen und Längsstrichelchen. Ventral fein und seicht längsgefurcht: die oberste
Furche bleibt weit vom Saftloch entfernt. Saftloch vom 6. bis vorletzten Segment, an der Grenze
vom 1. und 2. Drittel. Fransen am Hinterrande des Metazoniten (Fig. 260) einfache, kräftige Spitzen.
Ventralplatten glatt.
Dorsalteil des Analsegments spitz ausgezogen, seitlich etwas zusammengedrückt und stumpf
gekielt. Klappen flach gewölbt, Randsaum schmal und niedrig, am oberen Ende ein aufwärts
gerichteter Dorn. Unten kein Dorn. Schuppe spitzbogig.
Die 2 Sohlenpolster reichen bis ans Hinterende.
Gonopoden (Fig. 257, 258): Sie erinnern sehr an die von Chaleponcus niger, besonders durch
die Konfiguration des Endes der vorderen Gonopoden. Wir haben auch hier auf der Oralseite einen
starken, sichelförmig gekrümmten Haken (h) und auf der Aboralseite eine abgerundete Lamelle (1),
die bis an die Lateralseite reicht. Auf der Medialseite sitzt außerdem ein starker, distal gerichteter
Haken mit teilweise schwach gezähnelter Kante.
Hinterer Gonopode ohne Femoraldorn. Tibialdorn durch einen sehr kleinen mit 2 Seiten-
spitzchen versehenen Dorn vertreten. Tibialfortsatz sehr lang, dünn auslaufend, ohne Seitenzähne.
Am Tarsus kann man .3 Blätter, die an der Basis natürlich Zusammenhängen, unterscheiden. Das
mittlere trägt einen mit kleinen Stacheln besetzten Wulst (Fig. 257 st und Fig. 259), von dem eine
gezähnelte Kante zur Basis des Blattes herablänft, nach außen durch die eine Hälfte des hohlen
Blattes verdeckt. Auch an mehreren anderen Stellen des Tarsus finden sich kleine Spitzchen.
Fundort: D e u t s c h - S ü d w e s t a f r i k a , (Berlin. Mus.).
9. Gen. Helicochetus Att.
1909. A 1 1 e m s. Zool. Anz. XXXIV. No. 5, p. 158.
1909. — Sjöstedts Kilimandjaro-Meru-ExpCd., p. 55.
Ende des Tibialfortsatzes mit dem Prostatakanal spiralig eingedreht; in der Basalhälfte hat
der Tibialfortsatz einen starken Seitendorn. Femur des hinteren Gonopoden mit (Pococki) oder
meist ohne Dorn. Kein Tibialdorn. Tarsus blattförmig mit diversen Fransen und Zacken.
Sohlenpolster nur auf dem 4. Glied deutlich, auf dem 5. fehlend oder sehr rudimentär.
Fransen am Hinterland der Metazoniten in mehrere Spitzen geteilt.
5—6 Supralabralgrübchen.
Analklappen oben bedornt, der Randwulst innen ohne Rille.
Prozoniten mit Ringfurchen; Metazoniten dorsal ungefurcht.
Verbreitung: O s t a f r i k a.
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e H e l i c o c h e t u s - A r t e n :
1 a. Femur des hinteren Gono p o d en mit langem, kolbigem Dorn (Tarsus des hinteren Gonopoden ohne Fransen oder Sägezähnchen)
. . . Pococki (Carl).
1 b. Femur ohne Dorn, höchstens m it ganz kurzen Lappen . ......................... . 2