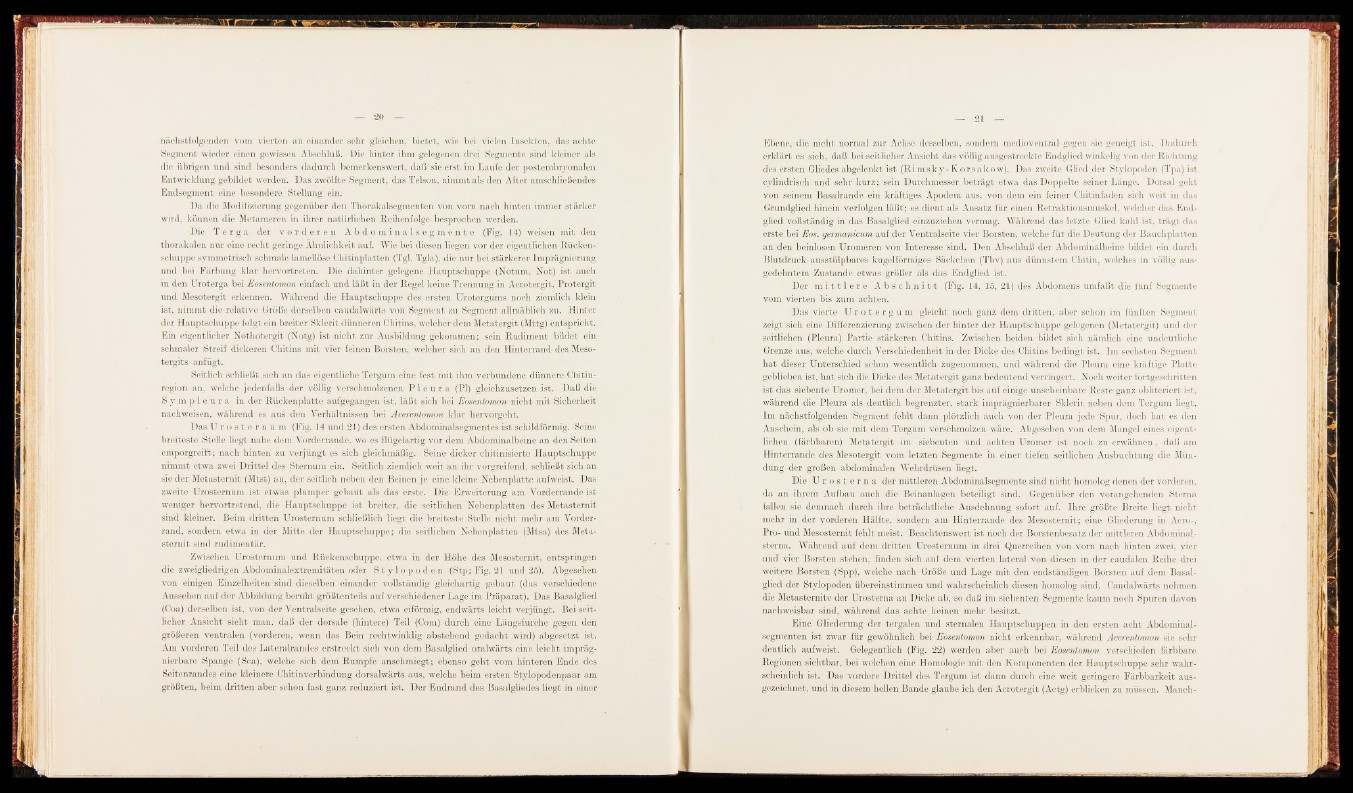
nächstfolgenden vom vierten an einander sehr gleichen, bietet, wie bei vielen Insekten, das achte
Segment wieder einen gewissen Abschluß. Die hinter ihm gelegenen drei Segmente sind kleiner als
die übrigen und sind besonders dadurch bemerkenswert, daß sie erst im Laufe der postembryonalen
Entwicklung gebildet werden. Das zwölfte Segment, das Telson, nimmt als den After umschließendes
Endsegment eine besondere Stellung ein.
Da die Modifizierung gegenüber den Thorakalsegmenten von vorn nach hinten immer stärker
wird, können die Metameren in ihrer natürlichen Reihenfolge besprochen werden.
Die T e r g a der v o r d e r e n A b d o m i n a l s e g m e n t e (Fig. 14) weisen mit den
thorakalen nur eine recht geringe Ähnlichkeit auf. Wie bei diesen liegen vor der eigentlichen Rückenschuppe
symmetrisch schmale lamellöse Chitinplatten (Tgl, Tgla), die nur bei stärkerer Imprägnierung
und bei Färbung klar hervortreten. Die dahinter gelegene Hauptschuppe (Notum, Not) ist auch
in den Uroterga bei Eosentomon einfach und läßt in der Regel keine Trennung in Acrotergit, Protergit
und Mesotergit erkennen. Während die Hauptschuppe des ersten Urotergums noch ziemlich klein
ist, nimmt die relative Größe derselben caudalwärts von Segment zu Segment allmählich zu. Hinter
der Hauptschuppe folgt ein breiter Sklerit dünneren Chitins, welcher dem Metatergit (Mttg) entspricht.
Ein eigentlicher Nothotergit (Notg) ist nicht zur Ausbildung gekommen; sein Rudiment bildet ein
schmaler Streif dickeren Chitins mit vier feinen Borsten, welcher sich an den Hinterrand des Meso-
tergits anfügt.
Seitlich schließt sich an das eigentliche Tergum eine fest mit ihm verbundene dünnere Chitinregion
an, welche jedenfalls der völlig verschmolzenen P l e u r a (PI) gleichzusetzen ist. Daß die
S y m p l e u r a in der Rückenplatte aufgegangen ist, läßt sich bei Eosentomon nicht mit Sicherheit
nachweisen, während es aus den Verhältnissen bei Acerentomon klar hervorgeht.
Das U r o s t e r n u m (Fig. 14 und 21) des ersten Abdominalsegmentes ist schildförmig. Seine
breiteste Stelle liegt nahe dem Vorderrande, wo es flügelartig vor dem Abdominalbeine an den Seiten
emporgreift; nach hinten zu verjüngt es sich gleichmäßig. Seine dicker chitinisierte Hauptschuppe
nimmt etwa zwei Drittel des Sternum ein. Seitlich ziemlich weit an ihr vorgreifend, schließt sich an
sie der Metasternit (Mtst) an, der seitlich neben den Beinen je eine kleine Nebenplatte aufweist. Das
zweite Urosternum ist etwas plumper gebaut als das erste. Die Erweiterung am Vorderrande ist
weniger hervortretend, die Hauptschuppe ist breiter, die seitlichen Nebenplatten des Metasternit
sind kleiner. Beim dritten Urosternum schließlich hegt die breiteste Stelle nicht mehr am Vorderrand,
sondern etwa in der Mitte der Hauptschuppe; die seitlichen Nebenplatten (Mtsa) des Metasternit
sind rudimentär.
Zwischen Urosternum und Rückenschuppe, etwa in der Höhe des Mesosternit, entspringen
die zweigliedrigen Abdominalextremitäten oder S t y l o p o d e n (Stp; Fig. 21 und 25). Abgesehen
von einigen Einzelheiten sind dieselben einander vollständig gleichartig gebaut (das verschiedene
Aussehen auf der Abbildung beruht größtenteils auf verschiedener Lage im Präparat). Das Basalglied
(Coa) derselben ist, von der Ventralseite gesehen, etwa eiförmig, endwärts leicht verjüngt. Bei seitlicher
Ansicht sieht man, daß der dorsale (hintere) Teil (Com) durch eine Längsfurche gegen den
größeren ventralen (vorderen, wenn das Bein rechtwinklig abstehend gedacht wird) abgesetzt ist.
Am vorderen Teil des Lateralrandes erstreckt sich von dem Basalglied oralwärts eine leicht imprägnierbare
Spange (Sca), welche sich dem Rumpfe anschmiegt; ebenso geht vom hinteren Ende des
Seitenrandes eine kleinere Chitinverbindung dorsalwärts aus, welche beim ersten Stylopodenpaar am
größten, beim dritten aber schon fast ganz reduziert ist. Der Endrand des Basalgliedes liegt in einer
Ebene, die nicht normal zur Achse desselben, sondern medioventral gegen sie geneigt ist. Dadurch
erklärt es sich, daß bei seitlicher Ansicht das völlig ausgestreckte Endglied winkelig von der Richtung
des ersten Gliedes abgelenkt ist (R im sk y -K o r.sak ow ). Das zweite Glied der Stylopoden (Tpa) ist
cylindrisch und sehr kurz; sein Durchmesser beträgt etwa das Doppelte seiner Länge. Dorsal geht
von seinem Basalrande ein kräftiges Apodem aus, von dem ein feiner Chitinfaden sich weit in das
Grundglied hinein verfolgen läßt; es dient als Ansatz für einen Retraktionsmuskel, welcher das Endglied
vollständig in das Basalglied einzuziehen vermag. Während das letzte Glied kahl ist, trägt das
erste bei Eos. germanicum auf der Ventralseite vier Borsten, welche für die Deutung der Bauchplatten
an den beinlosen Uromeren von Interesse sind. Den Abschluß der Abdominalbeine bildet ein durch
Blutdruck ausstülpbares kugelförmiges Säckchen (Tbv) aus dünnstem Chitin, welches in völlig ausgedehntem
Zustande etwas größer als das Endglied ist.
Der m i t t l e r e A b s c h n i t t (Fig. 14, 15, 21) des Abdomens umfaßt die fünf Segmente
vom vierten bis zum achten.
Das vierte U r o t e r g u m gleicht noch ganz dem dritten, aber schon im fünften Segment
zeigt sich eine Differenzierung zwischen der hinter der Hauptschuppe gelegenen (Metatergit) und der
seitlichen (Pleura) Partie stärkeren Chitins. Zwischen beiden bildet sich nämlich eine undeutliche
Grenze aus, welche durch Verschiedenheit in der Dicke des Chitins bedingt ist. Im sechsten Segment
hat dieser Unterschied schon wesentlich zugenommen, und während die Pleura eine kräftige Platte
geblieben ist, hat sich die Dicke des Metatergit ganz bedeutend verringert. Noch weiter fortgeschritten
ist das siebente Uromer, bei dem der Metatergit bis auf einige unscheinbare Reste ganz obliteriert ist,
während die Pleura als deutlich begrenzter, stark imprägnierbarer Sklerit neben dem Tergum hegt.
Im nächstfolgenden Segment fehlt dann plötzlich auch von der Pleura jede Spur, doch hat es den
Anschein, als ob sie mit dem Tergum verschmolzen wäre. Abgesehen von dem Mangel eines eigentlichen
(färbbaren) Metatergit im siebenten und achten Uromer ist noch zu erwähnen, daß am
Hinterrande des Mesotergit vom letzten Segmente in einer tiefen seitlichen Ausbuchtung die Mündung
der großen abdominalen Wehrdrüsen hegt.
Die U r o s t e r n a der mittleren Abdominalsegmente sind nicht homolog denen der vorderen,
da an ihrem Aufbau auch die Beinanlagen beteiligt sind. Gegenüber den vorangehenden Sterna
fallen sie demnach durch ihre beträchtliche Ausdehnung sofort auf. Ihre größte Breite hegt, nicht
mehr in der vorderen Hälfte, sondern am Hinterrande des Mesosternit; eine Gliederung in Acro-,
Pro- und Mesosternit fehlt meist. Beachtenswert ist noch der Borstenbesatz der mittleren Abdominalsterna.
Während auf dem dritten Urosternum in drei Querreihen von vorn nach hinten zwei, vier
und vier Borsten stehen, finden sich auf dem vierten lateral von diesen in der caudalen Reihe drei
weitere Borsten (Spp), welche nach Größe und Lage mit den endständigen Borsten auf dem Basal-
ghed der Stylopoden übereinstimmen und wahrscheinlich diesen homolog sind. Caudalwärts nehmen
die Metasternite der Urosterna an Dicke ab, so daß im siebenten Segmente kaum noch Spuren davon
nachweisbar sind, während das achte keinen mehr besitzt.
Eine Gliederung der tergalen und sternalen Hauptschuppen in den ersten acht Abdominalsegmenten
ist zwar für gewöhnhch bei Eosentomon nicht erkennbar, während Acerentomon sie sehr
deutlich aufweist. Gelegentlich (Fig. 22) werden aber auch bei Eosentomon verschieden färbbare
Regionen sichtbar, bei welchen eine Homologie mit den Komponenten der Hauptschuppe sehr wahrscheinlich
ist. Das vordere Drittel des Tergum ist dann durch eine weit geringere Färbbarkeit ausgezeichnet,
und in diesem hellen Bande glaube ich den Acrotergit (Actg) erblicken zu müssen. Manch