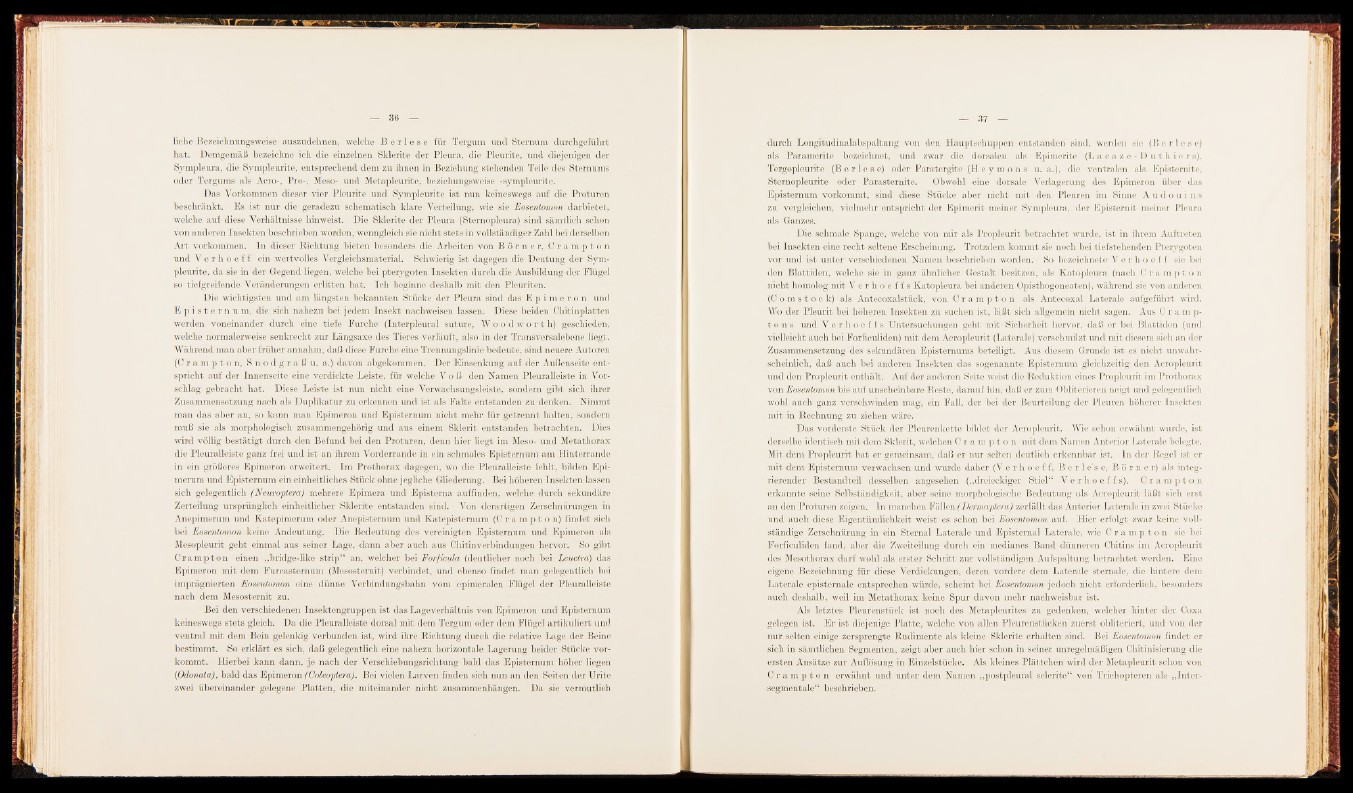
liehe Bezeichnungsweise auszudehnen, welche B e r 1 e s e für Tergum und Sternum durchgeführt
hat. Demgemäß bezeichne ich die einzelnen Slderite der Pleura, die Pleurite, und diejenigen der
Sympleura, die Sympleurite, entsprechend dem zu ihnen in Beziehung stehenden Teile des Sternums
oder Tergums als Acro-, Pro-, Meso- und Metapleurite, beziehungsweise -sympleurite.
Das Vorkommen dieser vier Pleurite und Sympleurite ist nun keineswegs auf die Proturen
beschränkt. Es ist nur die geradezu schematisch klare Verteilung, wie sie Eosentomon darbietet,
welche auf diese Verhältnisse hinwéist. Die Sklerite der Pleura (Sternopleura) sind sämtlich schon
von anderen Insekten beschrieben worden, wenngleich sie nicht stets in vollständiger Zahl bei derselben
Art Vorkommen. In dieser Richtung bieten besonders die Arbeiten von B ö r n e r , C r a m p t o n
und V e r h o e f f ein wertvolles Vergleichsmaterial. Schwierig ist dagegen die Deutung der Sympleurite,
da sie in der Gegend liegen, welche bei pterygoten Insekten durch die Ausbildung der Flügel
so tiefgreifende Veränderungen erlitten hat. Ich beginne deshalb mit den Pleuriten.
Die wichtigsten und am längsten bekannten Stücke der Pleura sind das E p i m e r o n und
E p i s t e r n u m , die sich nahezu bei jedem Insekt nach weisen lassen. Diese beiden Chitinplatten
werden voneinander durch eine tiefe Furche (Interpleural suture, Wo o d w o r t h ) geschieden,
welche normalerweise senkrecht zur Längsaxe des Tieres verläuft, also in der Transversalebene liegt.
Während man aber früher annahm, daß diese Furche eine Trennungslinie bedeute, sind neuere Autoren
( C r a m p t o n , S n o d g r a ß u . a.) davon abgekommen. Der Einsenkung auf der Außenseite entspricht
auf der Innenseite eine verdickte Leiste, für welche V o ß den Namen Pleuralleiste in Vorschlag
gebracht hat. Diese Leiste ist nun nicht eine Verwachsungsleiste, sondern gibt sich ihrer
Zusammensetzung nach als Duplikatur zu erkennen und ist als Falte entstanden zu denken. Nimmt
man das aber an, so kann man Epimeron und Episternum nicht mehr für getrennt halten, sondern
muß sie als morphologisch zusammengehörig und aus einem Sklerit entstanden betrachten. Dies
wird völlig bestätigt durch den Befund bei den Proturen, denn hier liegt im Meso- und Metathorax
die Pleurall eiste ganz frei und ist an ihrem Vorderrande in ein schmales Episternum am Hinterrande
in ein größeres Epimeron erweitert. Im Prothorax dagegen, wo die Pleuralleiste fehlt, bilden Epi-
merum und Episternum ein einheitliches Stück ohne jegliche Gliederung. Bei höheren Insekten lassen
sich gelegentlich (Neuroptera) mehrere Epimera und Epistema auffinden, welche durch sekundäre
Zerteilung ursprünglich einheitlicher Slderite entstanden sind. Von derartigen Zerschniirungen in
Anepimerum und Katepimerum oder Anepisternum und Katepisternum ( C r a m p t o n ) findet sich
bei Eosentomon keine Andeutung. Die Bedeutung des vereinigten Episternum und Epimeron als
Mesopleurit geht einmal aus seiner Lage, dann aber auch aus Chitinverbindungen hervor. So gibt
Cr ampt o n einen ,,bridge-like strip“ an, welcher bei Forficula (deutlicher noch bei Leuctra) das
Epimeron mit dem Furcasternum (Mesosternit) verbindet, und ebenso findet man gelegentlich bei
imprägnierten Eosentomon eine dünne Verbindungsbahn vom epimeralen Flügel der Pleuralleiste
nach dem Mesosternit zu.
Bei den verschiedenen Insektengruppen ist das Lageverhältnis von Epimeron und Episternum
keineswegs stets gleich. Da die Pleuralleiste dorsal mit dem Tergum oder dem Flügel artikuliert und
ventral mit dem Bein gelenkig verbunden ist, wird ihre Richtung durch die relative Lage der Beine
bestimmt. So erklärt es sich, daß gelegentlich eine nahezu horizontale Lagerung beider Stücke vorkommt.
Hierbei kann dann, je nach der Verschiebungsrichtung bald das Episternum höher liegen
(Odonata), bald das Epimeron (Coleóptera). Bei vielen Larven finden sich nun an den Seiten der Urite
zwei übereinander gelegene Platten, die miteinander nicht Zusammenhängen. Da sie vermutlich
durch Longitudinalabspaltung von den Hauptschuppen entstanden sind, werden sie (B e r 1 e s e)
als Paramerite bezeichnet, und zwar die dorsalen als Epimerite ( L a c a z e -D u t h i e r s ) ,
Tergopleurite (B e r l e s e ) oder Paratergite (H e ymo n s u. a.), die ventralen als Episternite,
Sternopleurite oder Parasternite. Obwohl eine dorsale Verlagerung des Epimeron über das
Episternum vorkommt, sind diese Stücke aber nicht mit den Pleuren im Sinne A u d o u i n s
zu vergleichen, vielmehr entspricht der Epimerit meiner Sympleura, der Episternit meiner Pleura
als Ganzes.
Die schmale Spange, welche von mir als Propleurit betrachtet wurde, ist in ihrem Auftreten
bei Insekten eine recht seltene Erscheinung. Trotzdem kommt sie noch bei tiefstehenden Pterygoten
vor und ist unter verschiedenen Namen beschrieben worden. So bezeichnete V e r h o e f f sie bei
den Blattiden, welche sie in ganz ähnlicher Gestalt besitzen, als Katopleura (nach C r a m p t o n
nicht homolog mit V e r h o e f f s Katopleura bei anderen Opisthogoneaten), während sie von anderen
( Coms t o c k ) als Antecoxalstück, von C r a m p t o n als Antecoxal Laterale auf geführt wird.
Wo der Pleurit bei höheren Insekten zu suchen ist, läßt sich allgemein nicht sagen. Aus C r a m p-
t o n s und V e r h o e f f s Untersuchungen geht mit Sicherheit hervor, daß er bei Blattiden (und
vielleicht auch bei Forficuliden) mit dem Acropleurit (Laterale) verschmilzt und mit diesem sich an der
Zusammensetzung des sekundären Episternums beteiligt. Aus diesem Grunde ist es nicht unwahrscheinlich,
daß auch bei anderen Insekten das sogenannte Episternum gleichzeitig den Acropleurit
und den Propleurit enthält. Auf der anderen Seite weist die Reduktion eines Propleurit im Prothorax
von Eosentomon bis auf unscheinbare Reste, darauf hin, daß er zum Obliterieren neigt und gelegentlich
wohl auch ganz verschwinden mag, ein Fall, der bei der Beurteilung der Pleuren höherer Insekten
mit in Rechnung zu ziehen wäre.
Das vorderste Stück der Pleurenkette bildet der Acropleurit. Wie schon erwähnt wurde, ist
derselbe identisch mit dem Sklerit, welchen C r a m p t o n mit dem Namen Anterior Laterale belegte.
Mit dem Propleurit hat er gemeinsam, daß er nur selten deutlich erkennbar ist. In der Regel ist er
mit dem Episternum verwachsen und wurde daher ( V e r h o e f f , B e r 1 e's e, B ö r n e r ) als integrierender
Bestandteil desselben angesehen („dreieckiger Stiel“ V e r h o e f f s ) . C r a m p t o n
erkannte seine Selbständigkeit, aber seine morphologische Bedeutung als Acropleurit läßt sich erst
an den Proturen zeigen. In manchen Fällen (Dermaptera) zerfällt das Anterior Laterale in zwei Stücke
und auch diese Eigentümlichkeit weist es schon bei Eosentomon auf. Hier erfolgt zwar keine vollständige
Zerschnürung in ein Sternal Laterale und Episternal Laterale, wie C r a m p t o n sie bei
Forficuliden fand, aber die Zweiteilung durch ein medianes Band dünneren Chitins im Acropleurit
des Mesothorax darf wohl als erster Schritt zur vollständigen Aufspaltung betrachtet werden. Eine
eigene Bezeichnung für diese Verdickungen, deren vordere dem Laterale sternale, die hintere dem
Laterale episternale entsprechen würde, scheint bei Eosentomon jedoch nicht erforderlich, besonders
auch deshalb, weil im Metathorax keine Spur davon mehr nachweisbar ist.
Als letztes Pleurenstück ist noch des Metapleurites zu gedenken, welcher hinter der Coxa
gelegen ist. Er ist diejenige Platte, welche von allen Pleurenstücken zuerst obliteriert, und von der
nur selten einige zersprengte Rudimente als kleine Sklerite erhalten sind. Bei Eosentomon findet er
sich in sämtlichen Segmenten, zeigt aber auch hier schon in seiner unregelmäßigen Chitinisierung die
ersten Ansätze zur Auflösung in Einzelstücke. Als kleines Plättchen wird der Metapleurit schon von
C r a m p t o n erwähnt und unter dem Namen ,,postpleural sclerite“ von Trichopteren als ,,Inter-
segmentale“ beschrieben.