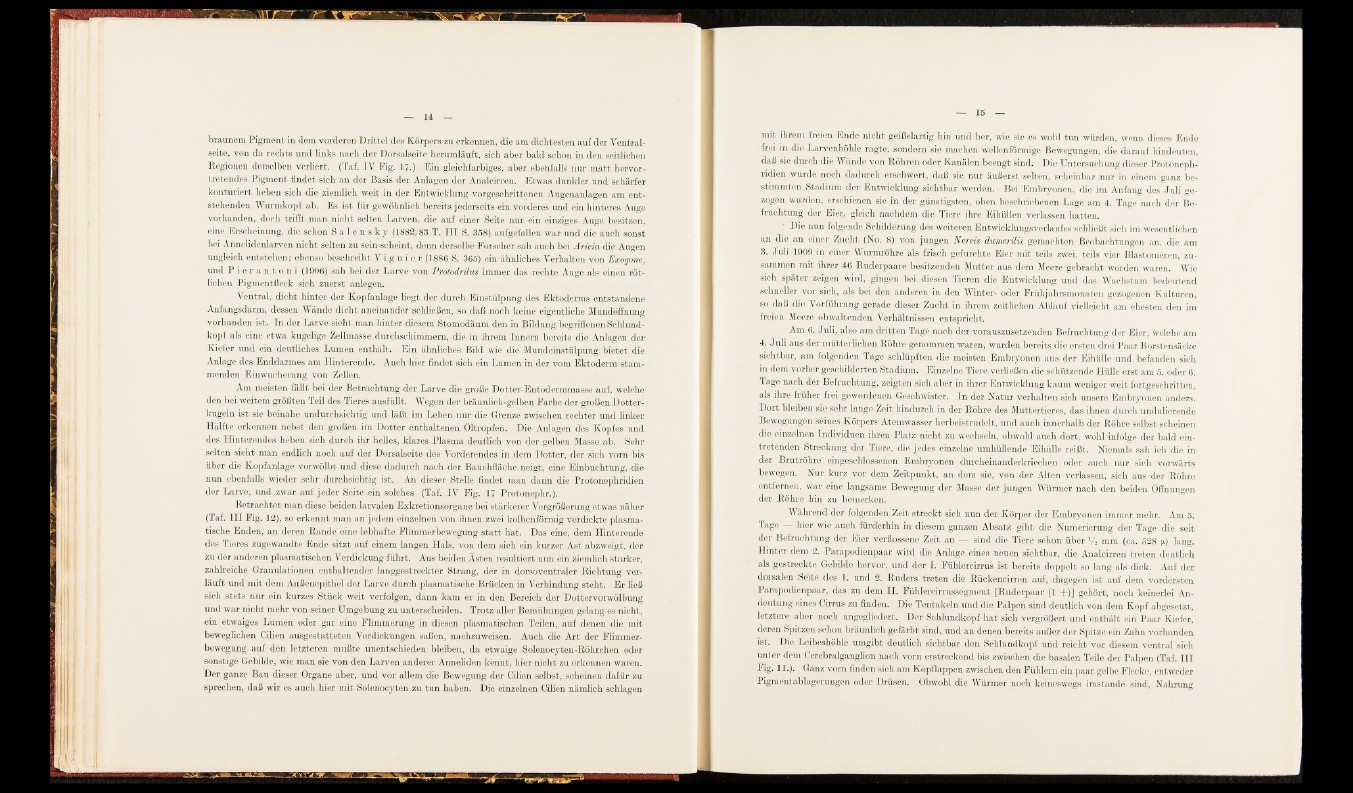
braunem Pigment in dem vorderen Drittel des Körpers zu erkennen, die am dichtesten auf der Ventralseite,
von da rechts und links nach der Dorsalseite herumläuft, sich aber bald schon in den seitlichen
Regionen derselben verliert. (Taf. IV Fig. 17.) Ein gleichfarbiges, aber ebenfalls nur matt hervortretendes
Pigment findet sich an der Basis der Anlagen der Analcirren. Etwas dunkler und schärfer
konturiert heben sich die ziemlich weit in der Entwicklung vorgeschrittenen Augenanlagen am entstehenden
Wurmkopf ab. Es ist für gewöhnlich bereits jederseits ein vorderes und ein hinteres Auge
vorhanden, doch trifft man nicht selten Larven, die auf einer Seite nur ein einziges Auge besitzen,
eine Erscheinung, die schon S a 1 e n s k y (1882/83 T. I II S. 358) aufgefallen war und die auch sonst
bei Annelidenlarven nicht selten zu sein scheint, denn derselbe Forscher sah auch bei Aricia die Augen
ungleich entstehen; ebenso beschreibt V i g u i e r (1886 S. 365) ein ähnliches Verhalten von Exogöne,
und P i e r a n t o n i (1906) sah bei der Larve von Protodrilus immer das rechte Auge als einen rötlichen
Pigmentfleck sich zuerst anlegen.
Ventral, dicht hinter der Kopfanlage liegt der durch Einstülpung des Ektoderms entstandene
Anfangsdarm, dessen Wände dicht aneinander schließen, so daß noch keine eigentliche Mundöffnung
vorhanden ist. In der Larve sieht man hinter diesem Stomodäum den in Bildung begriffenen Schlundkopf
als eine etwa kugelige Zellmasse durchschimmern, die in ihrem Innern bereits die Anlagen der
Kiefer und ein deutliches Lumen enthält. Ein ähnliches Bild wie die Mundeinstülpung bietet die
Anlage des Enddarmes am Hinterende.. Auch hier findet sich ein Lumen in der vom Ektoderm stammenden
Einwucherung von Zellen.
Am meisten fällt bei der Betrachtung der Larve die große Dotter-Entodermmasse auf, welche
den bei weitem größten Teil des Tieres ausfüllt. Wegen der bräunlich-gelben Farbe der großen Dotterkugeln
ist sie beinahe undurchsichtig und läßt im Leben nur die Grenze zwischen rechter und linker
Hälfte erkennen nebst den großen im Dotter enthaltenen öltropfen. Die Anlagen des Kopfes und
des Hinterendes heben sich durch ihr helles, klares Plasma deutlich von der gelben Masse ab. Sehr
selten sieht man endlich noch auf der Dorsalseite des Vorderendes in dem Dotter, der sich vorn bis
über die Kopfanlage vorwölbt und diese dadurch nach der Bauchfläche neigt, eine Einbuchtung, die
nun ebenfalls wieder sehr durchsichtig ist. An dieser Stelle findet man dann die Protonephridien
der Larve, und zwar auf jeder Seite ein solches (Taf. IV Fig. 17 Protonephr.).
Betrachtet man diese beiden larvalen Exkretionsorgane bei stärkerer Vergrößerung etwas näher
(Taf. I I I Fig. 12), so erkennt man an jedem einzelnen von ihnen zwei kolbenförmig verdickte plasmatische
Enden, an deren Rande eine lebhafte Flimmerbewegung sta tt hat. Das eine, dem Hinterende
des Tieres zugewandte Ende sitzt auf einem langen Hals, von dem sich ein kurzer Ast abzweigt, der
zu der anderen plasmatischen Verdickung führt. Aus beiden Ästen resultiert nun ein ziemlich starker,
zahlreiche Granulationen enthaltender langgestreckter Strang, der in dorsoventraler Richtung verläuft
und mit dem Außenepithel der Larve durch plasmatische Brücken in Verbindung steht. Er ließ
sich stets nur ein kurzes Stück weit verfolgen, dann kam er in den Bereich der Dottervorwölbung
und war nicht mehr von seiner Umgebung zu unterscheiden. Trotz aller Bemühungen gelang es nicht,
ein etwaiges Lumen oder gar eine Flimmerung in diesen plasmatischen Teilen, auf denen die mit
beweglichen Cilien ausgestatteten Verdickungen saßen, nachzuweisen. Auch die Art der Flimmerbewegung
auf den letzteren mußte unentschieden bleiben, da etwaige Solenocyten-Röhrchen oder
sonstige Gebilde, wie man sie von den Larven anderer Anneliden kennt, hier nicht zu erkennen waren.
Der ganze Bau dieser Organe aber, und vor allem die Bewegung der Cilien selbst, scheinen dafür zu
sprechen, daß wir es auch hier mit Solenocyten zu tun haben. Die einzelnen Cilien nämlich schlagen
mit ihrem freien Ende nicht geißelartig hin und her, wie sie es wohl tun würden, wenn dieses Ende
frei in die Larvenhöhle ragte, sondern sie machen wellenförmige Bewegungen, die darauf hindeuten,
daß sie durch die Wände von Röhren oder Kanälen beengt sind. Die Untersuchung dieser Protonephridien
wurde noch dadurch erschwert, daß sie nur äußerst selten, scheinbar nur in einem ganz bestimmten
Stadium der Entwicklung sichtbar werden. Bei Embryonen, die im Anfang des Juli gezogen
wurden, erschienen sie in der günstigsten, oben beschriebenen Lage am 4. Tage nach der Befruchtung
der Eier, gleich nachdem die Tiere ihre Eihüllen verlassen hatten.
Die nun folgende Schilderung des weiteren Entwicklungsverlaufes schließt sich im wesentlichen
an die an einer Zucht (No. 8) von jungen Nereis dumerilii gemachten Beobachtungen an, die am
3. Juli 1909 in einer Wurmröhre als frisch gefurchte Eier mit teils zwei, teils vier Blastomeren, zusammen
mit ihrer 46 Ruderpaare besitzende^ Mutter aus dem Meere gebracht worden waren. Wie
sich später zeigen wird, gingen bei diesen Tieren die Entwicklung und das Wachstum bedeutend
schneller vor sich, als bei den anderen in den Winter- oder Frühjahrsmonaten gezogenen Kulturen,
so daß die Vorführung gerade dieser Zucht in ihrem zeitlichen Ablauf vielleicht am ehesten den im
freien Meere obwaltenden Verhältnissen entspricht.
Am 6. Juli, also am dritten Tage nach der vorauszusetzenden Befruchtung der Eier, welche am
4. Juli aus der mütterlichen Röhre genommen waren, wurden bereits die ersten drei Paar Borstensäcke
sichtbar, am folgenden Tage schlüpften die meisten Embryonen aus der Eihülle und befanden sich
in dem vorher geschilderten Stadium. Einzelne Tiere verließen die schützende Hülle erst am 5. oder 6.
Tage nach der Befruchtung, zeigten sich aber in ihrer Entwicklung kaum weniger weit fortgeschritten,
als ihre früher frei gewordenen Geschwister. In der Natur verhalten sich unsere Embryonen anders.
Dort bleiben sie sehr lange Zeit hindurch in der Röhre des Muttertieres, das ihnen durch undulierende
Bewegungen seines Körpers Atemwasser herbeistrudelt, und auch innerhalb der Röhre selbst scheinen
die einzelnen Individuen ihren Platz nicht zu wechseln, obwohl auch dort, wohl infolge der bald eintretenden
Streckung der Tiere, die jedes einzelne umhüllende Eihülle reißt. Niemals sah ich die in
der Brutröhre eingeschlossenen Embryonen durcheinanderkriechen oder auch nur sich vorwärts
bewegen. Nur kurz vor dem Zeitpunkt, an dem sie, von der Alten verlassen, sich aus der Röhre
entfernen, war eine langsame Bewegung der Masse der jungen Würmer nach den beiden Öffnungen
der Röhre hin zu bemerken.
Während der folgenden Zeit streckt sich nun der Körper der Embryonen immer mehr. Am 5.
Tage — hier wie auch fürderhin in diesem ganzen Absatz gibt die Numerierung der Tage die seit
der Befruchtung der Eier verflossene Zeit an — sind die Tiere schon über y2 mm (ca. 528 n) lang.
Hinter dem 2. Parapodienpaar wird die Anlage eines neuen sichtbar, die Analcirren treten deutlich
als gestreckte Gebilde hervor, und der I. Fühlercirrus ist bereits doppelt so lang als dick. Auf der
dorsalen Seite des 1. und 2. Ruders treten die Rückencirren auf, dagegen ist auf dem vordersten
Parapodienpaar, das zu dem II. Fühlercirrussegment [Ruderpaar (1 +)] gehört, noch keinerlei Andeutung
eines Cirrus zu finden. Die Tentakeln und die Palpen sind deutlich von dem Kopf abgesetzt,
letztere aber noch ungegliedert. Der Schlundkopf hat sich vergrößert und enthält ein Paar Kiefer,
deren Spitzen schon bräunlich gefärbt sind/lind an denen bereits außer der Spitze ein Zahn vorhanden
ist. Die Leibeshöhle umgibt deutlich sichtbar den Schlundkopf und reicht vor diesem ventral sich
unter dem Cerebralganglion nach vorn e rs tre c k e n « ? ¡¡wischen die basalen Teile der Palpen (Tai III
Kg. 11.). Ganz vom finden sich am Ivopilappe» zwischen den Fühlern ein paar gelbe Kecke, entweder
Pigmentablagerungen S fte Drüsen. Obwohl die Würmer noch keineswegs imstande sind, Nahrung