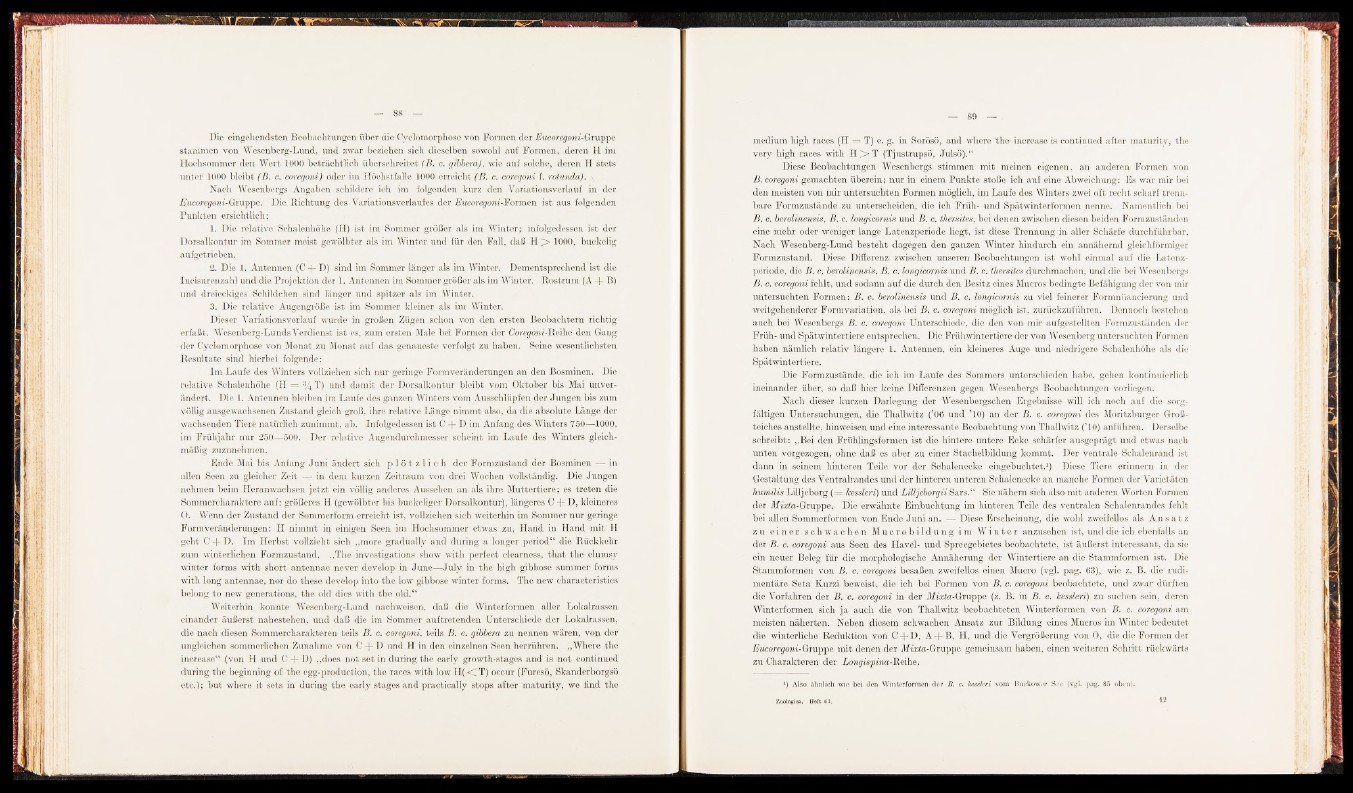
Die eingehendsten Beobachtungen über die Cyclomorphose von Formen der Eucoregoni-Gruppe
stammen von Wesenberg-Lund, und zwar beziehen sich dieselben sowohl auf Formen, deren H im
Hochsommer den Wert 1000 beträchtlich überschreitet (B. c. gibbera), wie auf solche, deren H stets
unter 1000 bleibt (B. c. coregoni) oder im Höchstfälle 1000 erreicht (B. c. coregoni f. rotunda). \
Nach Wesenbergs Angaben schildere ich im folgenden kurz den Variationsverlauf in der
Eucoregoni-Giwgpe. Die Richtung des Variationsverlaufes der Eucoregoni-’Foim.en ist aus folgenden
Punkten ersichtlich:
1. Die relative Schalenhöhe (H) ist im Sommer größer als im Winter; infolgedessen ist der
Dorsalkontur im Sommer meist gewölbter als im Winter und für den Fall, daß H > 1000, buckelig
aufgetrieben.
2. Die 1. Antennen (C + D) sind im Sommer länger als im Winter. Dementsprechend ist die
Incisurenzahl und die Projektion der 1. Antennen im Sommer größer als im Winter. Rostrum (A -f- B)
und dreieckiges Schildchen sind länger und spitzer als im Winter.
3. Die relative Augengröße ist im Sommer kleiner als im Winter.
Dieser Variationsverl auf wurde in großen Zügen schon von den ersten Beobachtern richtig
erfaßt. Wesenberg-Lunds Verdienst ist es, zum ersten Male bei Formen der Coregoni-'Reihe den Gang
der Cyclomorphose von Monat zu Monat auf das genaueste verfolgt zu haben. Seine wesentlichsten
Resultate sind hierbei folgende:
Im Laufe des Winters vollziehen sich nur geringe Formveränderungen an den Bosminen. Die
relative Schalenhöhe (H = % T) und damit der Dorsalkontur bleibt vom Oktober bis Mai unverändert.
Die 1. Antennen bleiben im Laufe des ganzen Winters vom Ausschlüpfen der Jungen bis zum
völlig ausgewachsenen Zustand gleich groß, ihre relative Länge nimmt also, da die absolute Länge der
wachsenden Tiere natürlich zunimmt, ab. Infolgedessen ist C + D im Anfang des Winters 750—1000,
im Frühjahr nur 250—500. Der relative Augendurchmesser scheint im Laufe des Winters gleichmäßig
zuzunehmen.
Ende Mai bis Anfang Juni ändert sich p l ö t z l i c h der Formzustand der Bosminen — in
allen Seen zu gleicher Zeit — in dem kurzen Zeitraum von drei Wochen vollständig. Die Jungen
nehmen beim Heranwachsen jetzt ein völlig anderes Aussehen an als ihre Muttertiere; es treten die
Sommercharaktere auf: größeres H (gewölbter bis buckeliger Dorsalkontur), längeres C + D, kleineres
O. Wenn der Zustand der Sommerform erreicht ist, vollziehen sich weiterhin im Sommer nur geringe
Formveränderungen: H nimmt in einigen Seen im Hochsommer etwas zu, Hand in Hand mit H
geht C + D. Im Herbst vollzieht sich „more gradually and during a longer period“ die Rückkehr
zum winterlichen Formzustand. „The investigations show with perfect clearness, th a t the clumsy
winter forms with short antennae never develop in June—July in the high gibbose summer forms
with long antennae, nor do these develop into the low gibbose winter forms. The new characteristics
belong to new generations, the old dies with the old.“
Weiterhin konnte Wesenberg-Lund nachweisen, daß die Winterformen aller Lokalrassen
einander äußerst nahestehen, und daß die im Sommer auftretenden Unterschiede der Lokalrassen,
die nach diesen Sommercharakteren teils B. c. coregoni, teils B. c. gibbera zu nennen wären, von der
ungleichen sommerlichen Zunahme von C -J- D und H in den einzelnen Seen herrühren. „Where the
increase“ (von H und C + D) „does not set in during the early growth-stages and is not continued
during the beginning of the egg-production, the races with low H( < T) occur (Furesö, Skanderborgsö
etc.); but where it sets in during the early stages and practically stops after maturity, we find the
medium high races (H = T) e. g. in Sorösö, and where the increase is continued after maturity, the
very high races with H > T (Tjustrupsö, Julsö).“
Diese Beobachtungen Wesenbergs stimmen mit meinen eigenen, an anderen Formen von
B. coregoni gemachten überein; nur in einem Punkte stoße ich auf eine Abweichung: Es war mir bei
den meisten von mir untersuchten Formen möglich, im Laufe des Winters zwei oft recht scharf trennbare
Formzustände zu unterscheiden, die ich Früh- und Spätwinterformen nenne. Namentlich bei
B. c. berolinensis, B. c. longicornis und B. c. thersites, bei denen zwischen diesen beiden Formzuständen
eine mehr oder weniger lange Latenzperiode liegt, ist diese Trennung in aller Schärfe durchführbar.
Nach Wesenberg-Lund besteht dagegen den ganzen Winter hindurch ein annähernd gleichförmiger
Formzustand. Diese Differenz zwischen unseren Beobachtungen ist wohl einmal auf die Latenzperiode,
die B. c. berolinensis, B. c. longicornis und B. c. thersites durchmachen, und die bei Wesenbergs
B. c. coregoni fehlt, und sodann auf die durch den Besitz eines Mucros bedingte Befähigung der von mir
untersuchten Formen: B. c. berolinensis und B. c. longicornis zu viel feinerer Formnüancierung und
weitgehenderer Formvariation, als bei B. c. coregoni möglich ist, zurückzuführen. Dennoch bestehen
auch bei Wesenbergs B. c. coregoni Unterschiede, die den von mir auf gestellten Formzuständen der
Früh- und Spätwintertiere entsprechen. Die Frühwintertiere der von Wesenberg untersuchten Formen
haben nämlich relativ längere 1. Antennen, ein kleineres Auge und niedrigere Schalenhöhe als die
Spätwintertiere.
Die Formzustände, die ich im Laufe des Sommers unterschieden habe, gehen kontinuierlich
ineinander über, so daß hier keine Differenzen gegen Wesenbergs Beobachtungen vorliegen.
Nach dieser kurzen Darlegung der Wesenbergschen Ergebnisse will ich noch auf die sorgfältigen
Untersuchungen, die Thallwitz (’06 und ’10) an der B. c. coregoni des Moritzburger Großteiches
anstellte, hinweisen und eine interessante Beobachtung von Thallwitz (’10) anführen. Derselbe
schreibt: „Bei den Frühlingsformen ist die hintere untere Ecke schärfer ausgeprägt und etwas nach
unten vorgezogen, ohne daß es aber zu einer Stachelbildung kommt. Der ventrale Schalenrand ist
dann in seinem hinteren Teile vor der Schalenecke eingebuchtet.1) Diese Tiere erinnern in der
Gestaltung des Ventralrandes und der hinteren unteren Schalenecke an manche Formen der Varietäten
humilis Lilljeborg (= hessleri) und Lilljeborgii Sars.“ Sie nähern sich also mit anderen Worten Formen
der Mixta- Gruppe. Die erwähnte Einbuchtung im hinteren Teile des ventralen Schalenrandes fehlt
bei allen Sommerformen von Ende Juni an. — Diese Erscheinung, die wohl zweifellos als A n s a t z
z u e i n e r s c hw a c h e n M u c r o b i l d u n g im W i n t e r anzusehen ist, und die ich ebenfalls an
der B. c. coregoni aus Seen des Havel- und Spreegebietes beobachtete, ist äußerst interessant, da sie
ein neuer Beleg für die morphologische Annäherung der Wintertiere an die Stammformen ist. Die
Stammformen von B. c. coregoni besaßen zweifellos einen Mucro (vgl. pag. 63), wie z. B. die rudimentäre
Seta Kurzi beweist, die ich bei Formen von B. c. coregoni beobachtete, und zwar dürften
die Vorfahren der B. c. coregoni in der Miatfa-Gruppe (z. B. in B. c. hessleri) zu suchen sein, deren
Winterformen sich ja auch die von Thallwitz beobachteten Winterformen von B. c. coregoni am
meisten näherten. Neben diesem schwachen Ansatz zur Bildung eines Mucros im Winter bedeutet
die winterliche Reduktion von C + D, A + B, H, und die Vergrößerung von O, die die Formen der
Eucoregoni - Grupp e mit denen der Mixta- Gruppe gemeinsam haben, einen weiteren Schritt rückwärts
zu Charakteren der Longispina-Beihe.
9 Also ähnlich wie bei den Winterformen der B. c. kessleri vom Buckower See (vgl. pag. 85 oben).
Zoologien. H e ft 63.