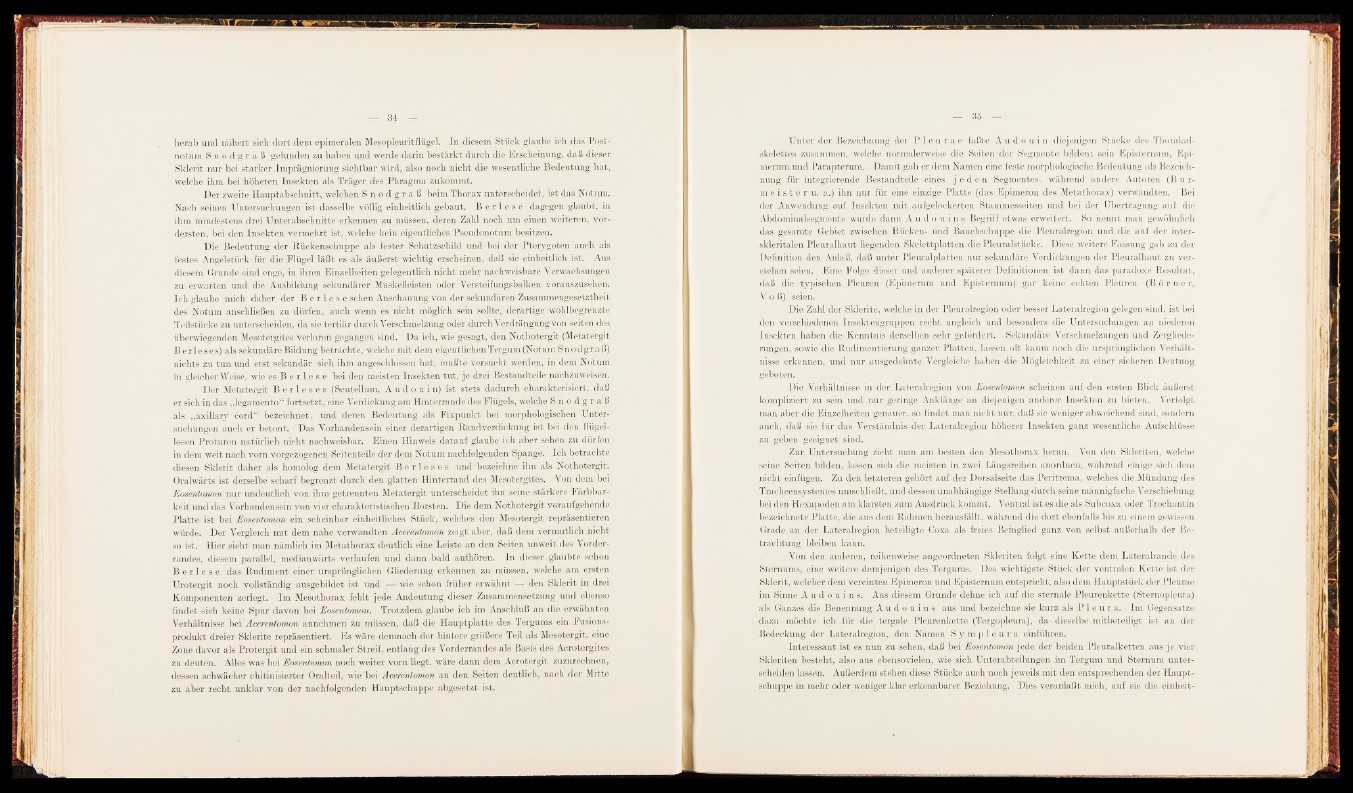
herab und nähert sich dort dem epimeralen Mesopleuritflügel. In diesem Stück glaube ich das Post-
notum S n o d g r a ß gefunden zu haben und werde darin bestärkt durch die Erscheinung, daß dieser
Sklerit nur bei starker Imprägnierung sichtbar wird, also noch nicht die wesentliche Bedeutung hat,
welche ihm bei höheren Insekten als Träger des Phragma zukommt.
Der zweite Hauptabschnitt, welchen S n o d g r a ß beim Thorax unterscheidet, ist das Notum.
Nach seinen Untersuchungen ist dasselbe völlig einheitlich gebaut. B e r 1 e s e dagegen glaubt, in
ihm mindestens drei Unterabschnitte erkennen zu müssen, deren Zahl noch um einen weiteren, vordersten,
bei den Insekten vermehrt ist, welche kein eigentliches Pseudonotum besitzen.
Die Bedeutung der Rückenschuppe als fester Schutzschild und bei der Pterygoten auch als
festes Angelstück für die Flügel läßt es als äußerst wichtig erscheinen, daß sie einheitlich ist. Aus
diesem Grunde sind enge, in ihren Einzelheiten gelegentlich nicht mehr nachweisbare Verwachsungen
zu erwarten und die Ausbildung sekundärer Muskelleisten oder Versteifungsbalken vorauszusehen.
Ich glaube mich daher der B e r 1 e s e sehen Anschauung von der sekundären Zusammengesetztheit
des Notum anschließen zu dürfen, auch wenn es nicht möglich sein sollte, derartige wohlbegrenzte
Teilstücke zu unterscheiden, da sie tertiär durch Verschmelzung oder durch Verdrängung von seiten des
überwiegenden Mesotergites verloren gegangen sind. Da ich, wie gesagt, den Nothotergit (Metatergit
B e r 1 e s e s) als sekundäre Bildung betrachte, welche mit dem eigentlichenTergum (Notum S nodgraß)
nichts zu tun und erst sekundär sich ihm angeschlossen hat, mußte versucht werden, in dem Notum
in gleicher Weise, wie e s B e r l e s e bei den meisten Insekten tut, je drei Bestandteile nachzuweisen.
Der Metatergit B e r l e s e s (Scutellum, A u d o u i n) ist stets dadurch charakterisiert, daß
er sich in das „legamento“ fortsetzt, eine Verdickung am Hinterrande des Flügels, welche S n o d g r a ß
als „axillary cord“ bezeichnet, und deren Bedeutung als Fixpunkt bei morphologischen Untersuchungen
auch er betont. Das Vorhandensein einer derartigen Randverdickung ist bei den flügellosen
Proturen natürlich nicht nachweisbar. Einen Hinweis darauf glaube ich aber sehen zu dürfen
in dem weit nach vorn vorgezogenen Seitenteile der dem Notum nachfolgenden Spange. Ich betrachte
diesen Sklerit daher als homolog dem Metatergit B e r l e s e s und bezeichne ihn als Nothotergit.
Oralwärts ist derselbe scharf begrenzt durch den glatten Hinterrand des Mesotergites. Von dem bei
Eosentomon nur undeutlich von ihm getrennten Metatergit unterscheidet ihn seine stärkere Färbbarkeit
und das Vorhandensein von vier charakteristischen Borsten. Die dem Nothotergit voraufgehende
Platte ist bei Eosentomon ein scheinbar einheitliches Stück, welches den Mesotergit repräsentieren
würde. Der Vergleich mit dem nahe verwandten Acerentomon zeigt aber, daß dem vermutlich nicht
so ist. Hier sieht man nämlich im Metathorax deutlich eine Leiste an den Seiten unweit des Vorderrandes,
diesem parallel, medianwärts verlaufen und dann bald aufhören. In dieser glaubte schon
B e r 1 e s e das Rudiment einer ursprünglichen Gliederung erkennen zu müssen, welche am ersten
Urotergit noch vollständig ausgebildet ist und — wie schon früher erwähnt — den Sklerit in drei
Komponenten zerlegt. Im Mesothorax fehlt jede Andeutung dieser Zusammensetzung und ebenso
findet sich keine Spur davon bei Eosentomon. Trotzdem glaube ich im Anschluß an die erwähnten
Verhältnisse bei Acerentomon annehmen zu müssen, daß die Hauptplatte des Tergums ein Fusionsprodukt
dreier Sklerite repräsentiert. Es wäre demnach der hintere größere Teil als Mesotergit, eine
Zone davor als Protergit und ein schmaler Streif, entlang des Vorderrandes als Basis des Acrotergites
zu deuten. Alles was bei Eosentomon noch weiter vorn liegt, wäre dann dem Acrotergit zuzurechnen,
dessen schwächer chitinisierter Oralteil, wie bei Acerentomon an den Seiten deutlich, nach der Mitte
zu aber recht unklar von der nachfolgenden Hauptschuppe abgesetzt ist.
Unter der Bezeichnung der P 1 e u r a e faßte A u d o u i n diejenigen Stücke des Thorakal -
skelettes zusammen, welche normalerweise die Seiten der Segmente bilden: sein Episternum, Epi-
merum und Parapterum. Damit gab er dem Namen eine feste morphologische Bedeutung als Bezeichnung
für integrierende Bestandteile eines j e d e n Segmentes, während andere Autoren (Bur m
e i s t e r u. a.) ihn nur für eine einzige Platte (das Epimeron des Metathorax) verwandten. Bei
der Anwendung auf Insekten mit aufgelockerten Stammesseiten und bei der Übertragung auf die
Abdominalsegmente wurde dann A u d o u i n s Begriff etwas erweitert. So nennt man gewöhnlich
das gesamte Gebiet zwischen Rücken- und Bauchschuppe die Pleuralregion und die auf der inter-
skleritalen Pleuralhaut liegenden Skelettplatten die Pleuralstücke. Diese weitere Fassung gab zu der
Definition den Anlaß, daß unter Pleuralplatten nur sekundäre Verdickungen der Pleuralhaut zu verstehen
seien. Eine Folge dieser und anderer späterer Definitionen ist dann das paradoxe Resultat,
daß die typischen Pleuren (Epimerum und Episternum) gar keine echten Pleuren ( Bö r n e r ,
V o ß) seien.
Die Zahl der Sklerite, welche in der Pleuralregion oder besser Lateralregion gelegen sind, ist bei
den verschiedenen Insektengruppen recht ungleich und besonders die Untersuchungen an niederen
Insekten haben die Kenntnis derselben sehr gefördert. Sekundäre Verschmelzungen und Zergliederungen,
sowie die Rudimentierung ganzer Platten, lassen oft kaum noch die ursprünglichen Verhältnisse
erkennen, und nur ausgedehnte Vergleiche haben die Mögleichkeit zu einer sicheren Deutung
geboten.D
ie Verhältnisse in der Lateralregion von Eosentomon scheinen auf den ersten Blick äußerst
kompliziert zu sein und nur geringe Anklänge an diejenigen anderer Insekten zu bieten. Verfolgt
man aber die Einzelheiten genauer, so findet man nicht nur, daß sie weniger abweichend sind, sondern
auch, daß sie für das Verständnis der Lateralregion höherer Insekten ganz wesentliche Aufschlüsse
zu geben geeignet sind.
Zur Untersuchung zieht man am besten den Mesothorax heran. Von den Skleriten, welche
seine Seiten bilden, lassen sich die meisten in zwei Längsreihen anordnen, während einige sich dem
nicht einfügen. Zu den letzteren gehört auf der Dorsalseite das Peritrema, welches die Mündung des
Tracheensystemes umschließt, und dessen unabhängige Stellung durch seine mannigfache Verschiebung
bei den Hexapoden am klarsten zum Ausdruck kommt. Ventral ist es die als Subcoxa oder Trochantin
bezeichnete Platte, die aus dem Rahmen herausfällt, während die dort ebenfalls bis zu einem gewissen
Grade an der Lateralregion beteiligte Coxa als freies Beinglied ganz von selbst außerhalb der Betrachtung
bleiben kann.
Von den anderen, reihenweise angeordneten Skleriten folgt eine Kette dem Lateralrande des
Sternums, eine weitere demjenigen des Tergums. Das wichtigste Stück der ventralen Kette ist der
Sklerit, welcher dem vereinten Epimeron und Episternum entspricht, also dem Hauptstück der Pleurae
im Sinne A u d o u i n s . Aus diesem Grunde dehne ich auf die sternale Pleurenkette (Sternopleura)
als Ganzes die Benennung A u d o u i n s aus und bezeichne sie kurz als P l e u r a . Im Gegensätze
dazu möchte ich für die tergale Pleurenkette (Tergopleura), da dieselbe mitbeteiligt ist an der
Bedeckung der Lateralregion, den Namen S y m p l e u r a einführen.
Interessant ist es nun zu sehen, daß bei Eosentomon jede der beiden Pleuralketten aus je vier
Skleriten besteht, also aus ebensovielen, wie sich Unterabteilungen im Tergum und Sternum unterscheiden
lassen. Außerdem stehen diese Stücke auch noch jeweils mit den entsprechenden der Hauptschuppe
in mehr oder weniger klar erkennbarer Beziehung. Dies veranlaßt mich, auf sie die einheit