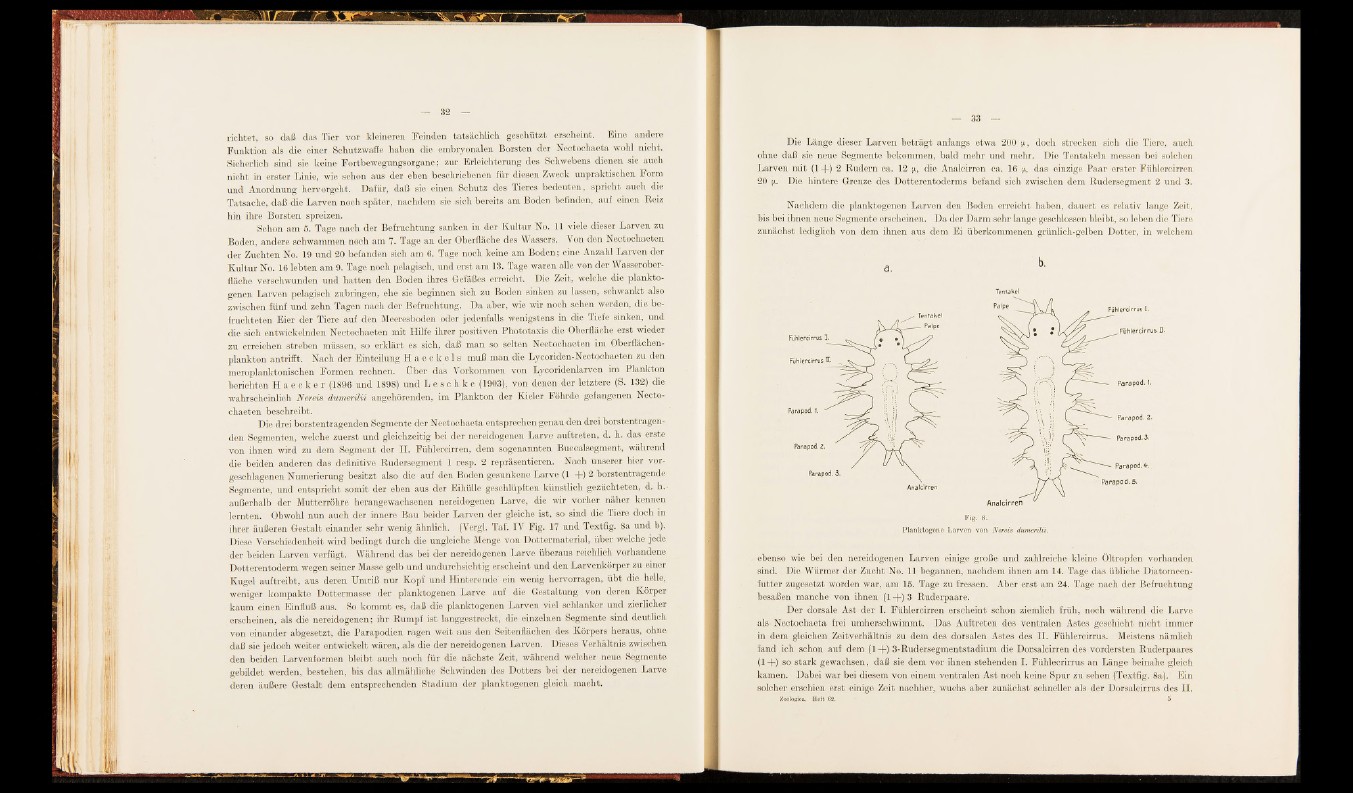
richtet, so daß das Tier vor kleineren Feinden tatsächlich geschützt erscheint. Eine andere
Funktion als die einer SchutzwafEe haben die embryonalen Borsten der Nectochaeta wohl nicht.
Sicherlich sind sie keine Fortbewegungsorgane; zur Erleichterung des Schwebens dienen sie auch
nicht in erster Linie, wie schon aus der eben beschriebenen für diesen Zweck unpraktischen Form
und Anordnung hervorgeht. Dafür, daß sie einen Schutz des Tieres bedeuten, spricht auch die
Tatsache, daß die Larven noch später, nachdem sie sich bereits am Boden befinden, auf einen Reiz
hin ihre Borsten spreizen.
Schon am 5. Tage nach der Befruchtung sanken in der Kultur No. 11 viele dieser Larven zu
Boden, andere schwammen noch am 7. Tage an der Oberfläche des Wassers. Von den Nectochaeten
der Zuchten No. 19 und 20 befanden sich am 6. Tage noch keine am Boden; eine Anzahl Larven der
Kultur No. 16 lebten am 9. Tage noch pelagisch, und erst am 13. Tage waren alle von der Wasseroberfläche
verschwunden und hatten den Boden ihres Gefäßes erreicht. Die Zeit, welche die plankto-
genen Larven pelagisch zubringen, ehe sie beginnen sich zu Boden sinken zu lassen, schwankt also
zwischen fünf und zehn Tagen nach der Befruchtung. Da aber, wie wir noch sehen werden, die befruchteten
Eier der Tiere auf den Meeresboden oder jedenfalls wenigstens in die Tiefe sinken, und
die sich entwickelnden Nectochaeten mit Hilfe ihrer positiven Phototaxis die Oberfläche erst wieder
zu erreichen streben müssen, so erklärt es sich, daß man so selten Nectochaeten im Oberflächenplankton
antrifft. Nach der Einteilung H a e c k e 1 s muß man die Lycoriden-Nectochaeten zu den
meroplanktonischen Formen rechnen. Über das Vorkommen von Lycoridenlarven im Plankton
berichten H a e c k e r (1896 und 1898) und L e s c h k e (1903), von denen der letztere (S. 132) die
wahrscheinlich Nereis dumerilii angehörenden, im Plankton der Kieler Föhrde gefangenen Nectochaeten
beschreibt.
Die drei borstentragenden Segmente der Nectochaeta entsprechen genau den drei borstentragenden
Segmenten, welche zuerst und gleichzeitig bei der nereidogenen Larve auftreten, d. h. das erste
von ihnen wird zu dem Segment der II. Fühlercirren, dem sogenannten Buccalsegment, während
die beiden anderen das definitive Rudersegment 1 resp. 2 repräsentieren. Nach unserer hier vorgeschlagenen
Numerierung besitzt also die auf den Boden gesunkene Larve (1 + ) 2 borstentragende
Segmente, und entspricht somit der eben aus der Eihülle geschlüpften künstlich gezüchteten, d. h.-
außerhalb der Mutterröhre herangewachsenen nereidogenen Larve, die wir vorher näher kennen
lernten. Obwohl nun auch der innere Bau beider Larven der gleiche ist, so sind die. Tiere doch in
ihrer äußeren Gestalt einander sehr wenig ähnlich. (Vergl. Taf. IV Fig. 17 und Textfig. 8a und b).
Diese Verschiedenheit wird bedingt durch die ungleiche Menge von Dottermaterial, über welche jede
der beiden Larven verfügt. Während das bei der nereidogenen Larve überaus reichlich vorhandene
Dotterentoderm wegen seiner Masse gelb und undurchsichtig erscheint und den Larvenkörper zu einer
Kugel auftreibt, aus deren Umriß nur Kopf und Hinterende ein wenig hervorragen, übt die helle,
weniger kompakte Dottermasse der planktogenen Larve auf die Gestaltung von deren Körper
kaum einen Einfluß aus. So kommt es, daß die planktogenen Larven viel schlanker und zierlicher
erscheinen, als die nereidogenen; ihr Rumpf ist langgestreckt, die einzelnen Segmente sind deutlich
von einander abgesetzt, die Parapodien ragen weit aus den Seitenflächen des Körpers heraus, ohne
daß sie jedoch weiter entwickelt wären, .als die der nereidogenen Larven. Dieses Verhältnis zwischen
den beiden Larvenformen bleibt auch noch für die nächste Zeit, während welcher neue Segmente
gebildet werden, bestehen, bis das allmähliche Schwinden des Dotters bei der nereidogenen Larve
deren äußere Gestalt dem entsprechenden Stadium der planktogenen gleich macht.
I
m 33
Die Länge dieser Larven beträgt anfangs etwa 200y., doch strecken sich die Tiere, auch
ohne daß sie neue Segmente bekommen, bald mehr und mehr. Die Tentakeln messen bei solchen
Larven mit (1+) 2 Rudern ca. 12 (x, die Analcirren ca. 16 (x, das einzige Paar erster Fühlercirren
20 (x. Die hintere Grenze des Dotterentoderms befand sich zwischen dem Rudersegment 2 und 3.
Nachdem die planktogenen Larven den Boden erreicht haben, dauert es relativ lange Zeit,
bis bei ihnen neue Segmente erscheinen. Da der Darm sehr lange geschlossen bleibt, so leben die Tiere
zunächst lediglich von dem ihnen aus dem Ei überkommenen grünlich-gelben Dotter, in welchem
b'
Tentakel
Fig. 8.
Planktogene Larven von Nereis dumerilii.
ebenso wie bei den nereidogenen Larven einige große und zahlreiche kleine öltropfen vorhanden
sind. Die Würmer der Zucht No. 11 begannen, nachdem ihnen am 14. Tage das übliche Diatomeenfutter
zugesetzt worden war, am 15. Tage zu fressen. Aber erst am 24. Tage nach der Befruchtung
besaßen manche von ihnen (1 -fr) 3 Ruderpaare.
Der dorsale Ast der I. Fühlercirren erscheint schon ziemlich früh, noch während die Larve
als' Nectochaeta frei umherschwimmt. Das Auftreten des ventralen Astes geschieht nicht immer
in dem gleichen Zeitverhältnis zu dem des dorsalen Astes des II. Fühlercirrus. Meistens nämlich
fand ich schon auf dem (1 + ) 3-Rudersegmentstadium die Dorsalcirren des vordersten Ruderpaares
(1+) so stark gewachsen, daß sie dem vor ihnen stehenden I. Fühlecrirrus an Länge beinahe gleich
kamen. Dabei war bei diesem von einem ventralen Ast noch keine Spur zu sehen (Textfig. 8a). Ein
solcher erschien erst einige Zeit nachher, wuchs aber zunächst schneller als der Dorsalcirrus des II.
Zoologien. H e ft 62.- 5