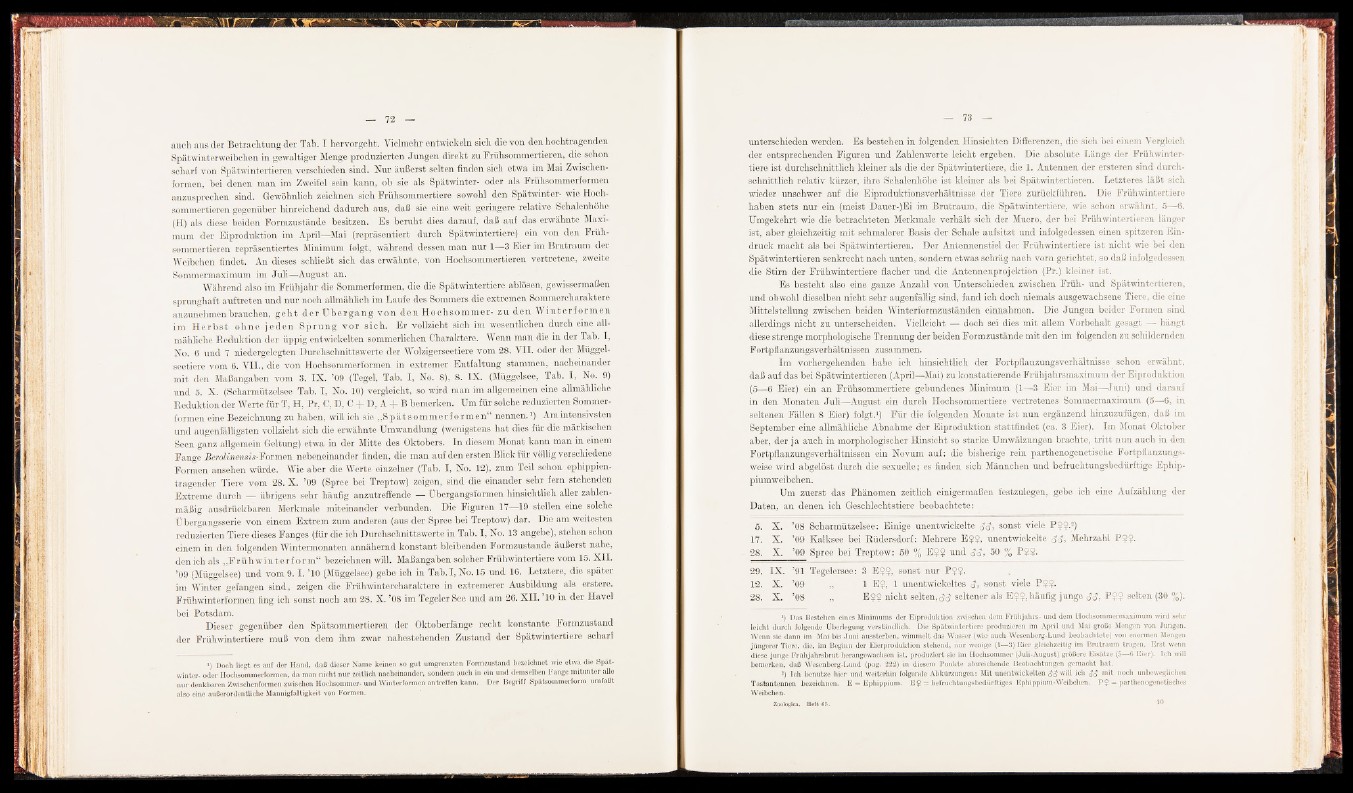
auch aus der Betrachtung der Tab. I hervorgeht. Vielmehr entwickeln sich die von den hochtragenden
Spätwinterweibchen in gewaltiger Menge produzierten Jungen direkt zu Frühsommertieren, die schon
scharf von Spätwintertieren verschieden sind. Nur äußerst selten finden sich etwa im Mai Zwischenformen,
bei denen man im Zweifel sein kann, ob sie als Spätwinter- oder als Frühsommerformen
anzusprechen sind. Gewöhnlich zeichnen sich Frühsommertiere sowohl den Spätwinter- wie Hochsommertieren
gegenüber hinreichend dadurch aus, daß sie eine weit geringere relative Schalenhöhe
(H) als diese beiden Formzustände besitzen. Es beruht dies darauf, daß auf das erwähnte Maximum
der Eiproduktion im April—Mai (repräsentiert durch Spätwintertiere) ein von den Frühsommertieren
repräsentiertes Minimum folgt, während dessen man nur 1—3 Eier im Brutraum der
Weibchen findet. An dieses schließt sich das erwähnte, von Hochsommertieren vertretene, zweite
Sommermaximum im Juli—August an.
Während also im Frühjahr die Sommerformen, die die Spätwintertiere ablösen, gewissermaßen
sprunghaft auftreten und nur noch allmählich im Laufe des Sommers die extremen Sommercharaktere
anzunehmen brauchen, geh t d e r Übe rgan g von den Hochsommer- zu den W i n t e r f o rmen
im He r b s t ohne j e d e n Spr ung v o r sich. Er vollzieht sich im wesentlichen durch eine allmähliche
Reduktion der üppig entwickelten sommerlichen Charaktere. Wenn man die in der Tab. I,
No. 6 und 7 niedergelegten Durchschnittswerte der Wolzigerseetiere vom 28. VII. oder der Müggelseetiere
vom 6. VII., die von Hochsommerformen in extremer Entfaltung stammen, nacheinander
mit den Maßangaben vom 3. IX. ’09 (Tegel, Tab. I, No. 8), 8. IX. (Müggelsee, Tab. I, No. 9)
und 5. X. (Scharmützelsee Tab. I, No. 10) vergleicht, so wird man im allgemeinen eine allmähliche
Reduktion der Werte für T, H, Pr, C, D, C + D, A + B bemerken. Um für solche reduzierten Sommerformen
eine Bezeichnung zu haben, will ich sie „S p ä t s omme r form en “ nennen.1) Am intensivsten
und augenfälligsten vollzieht sich die erwähnte Umwandlung (wenigstens hat dies für die märkischen
Seen ganz allgemein Geltung) etwa in der Mitte des Oktobers. In diesem Monat kann man in einem
Fange Berolinensis - Formen nebeneinander finden, die man auf den ersten Blick für völlig verschiedene
Formen ansehen würde. Wie aber die Werte einzelner (Tab. I, No. 12), zum Teil schon ephippien-
tragender Tiere vom 28. X. ’09 (Spree bei Treptow) zeigen, sind die einander sehr fern stehenden
Extreme durch ■— übrigens sehr häufig anzutreffende — Übergangsformen hinsichtlich aller zahlenmäßig
ausdrückbaren Merkmale miteinander verbunden. Die Figuren 17—19 stellen eine solche
Übergangsserie von einem Extrem zum anderen (aus der Spree bei Treptow) dar. Die am weitesten
reduzierten Tiere dieses Fanges (für die ich Durchschnittswerte in Tab. I, No. 13 angebe), stehen schon
einem in den folgenden Wintermonaten annähernd konstant bleibenden Formzustande äußerst nahe,
den ich als „Fr ü hwi n t e r f orm“ bezeichnen will. Maßangaben solcher Frühwintertiere vom 15. XII.
’09 (Müggelsee) und vom 9 .1. ’10 (Müggelsee) gebe ich in Tab.I, No. 15 und 16. Letztere, die später
im Winter gefangen sind, zeigen die Frühwintercharaktere in extremerer Ausbildung als erstere.
Früh winterformen fing ich sonst noch am 28. X. ’08 im Tegeler See und am 26. XII. ’10 in der Havel
bei Potsdam.
Dieser gegenüber den Spätsommertieren der Oktoberfänge recht konstante Formzustand
der Frühwintertiere muß von dem ihm zwar nahestehenden Zustand der Spätwintertiere scharf
i) Doch liegt es auf der Hand, daß dieser Name keinen so g u t umgrenzten Formzustand bezeichnet wie etwa die S p ä twinter
oder Hochsommerformen, da man nicht n u r zeitlich nacheinander, sondern auch in ein u nd demselben Fange m itunte r alle
n u r denkbaren Zwischenformen zwischen Hochsommer- und W interformen an treffen kann. Der Begriff Spätsommerform umfaßt
also eine außerordentliche Mannigfaltigkeit von Formen.
unterschieden werden. Es bestehen in folgenden Hinsichten Differenzen, die sich bei einem Vergleich
der entsprechenden Figuren und Zahlenwerte leicht ergeben. Die absolute Länge der Frühwintertiere
ist durchschnittlich kleiner als die der Spätwintertiere, die 1. Antennen der ersteren sind durchschnittlich
relativ kürzer, ihre Schalenhöhe ist kleiner als bei Spätwintertieren. Letzteres läßt sich
wieder unschwer auf die Eiproduktionsverhältnisse der Tiere zurückführen. Die Frühwintertiere
haben stets nur ein (meist Dauer-)Ei im Brutraum, die Spätwintertiere, wie schon erwähnt, 5—6.
Umgekehrt wie die betrachteten Merkmale verhält sich der Mucro, der bei Frühwintertieren länger
ist, aber gleichzeitig mit schmalerer Basis der Schale aufsitzt und infolgedessen einen spitzeren Eindruck
macht als bei Spätwintertieren. Der Antennenstiel der Frühwintertiere ist nicht wie bei den
Spätwintertieren senkrecht nach unten, sondern etwas schräg nach vom gerichtet, so daß infolgedessen
die Stirn der Frühwintertiere flacher und die Antennenprojektion (Pr.) kleiner ist.
Es besteht also eine ganze Anzahl von Unterschieden zwischen Früh- und Spätwintertieren,
und obwohl dieselben nicht sehr augenfällig sind, fand ich doch niemals ausgewachsene Tiere, die eine
Mittelstellung zwischen beiden Winterformzuständen einnahmen. Die Jungen beider Formen sind
allerdings nicht zu unterscheiden. Vielleicht — doch sei dies mit allem Vorbehalt gesagt — hängt
diese strenge morphologische Trennung der beiden Formzustände mit den im folgenden zu schildernden
Fortpflanzungsverhältnissen zusammen.
Im vorhergehenden habe ich hinsichtlich der Fortpflanzungsverhältnisse schon erwähnt,
daß auf das bei Spätwintertieren (April—Mai) zu konstatierende Frühjahrsmaximum der Eiproduktion
(5—6 Eier) ein an Frühsommertiere gebundenes Minimum (1—3 Eier im Mai—Juni) und darauf
in den Monaten Juli—August ein durch Hochsommertiere vertretenes Sommermaximum (5—6, in
seltenen Fällen 8 Eier) folgt.1) Für die folgenden Monate ist nun ergänzend hinzuzufügen, daß im
September eine allmähliche Abnahme der Eiproduktion stattfindet (ca. 3 Eier). Im Monat Oktober
aber, der ja auch in morphologischer Hinsicht so starke Umwälzungen brachte, tritt nun auch in den
Fortpflanzungsverhältnissen ein Novum auf: die bisherige rein parthenogenetische Fortpflanzungsweise
wird abgelöst durch die sexuelle; es finden sich Männchen und befruchtungsbedürftige Ephip-
piumweibchen.
Um zuerst das Phänomen zeitlich einigermaßen festzulegen, gebe ich eine Aufzählung der
Daten, an denen ich Geschlechtstiere beobachtete:
5. X. ’08 Scharmützelsee: Einige unentwickelte SS, sonst viele P$$.2)
17. X. ’09 Kalksee bei Rüdersdorf: Mehrere E?$, unentwickelte SS, Mehrzahl P$?.
28. X. ’09 Spree bei Treptow: 50 % E $ ? und SS, 50 % P$$.
29. IX. ’91 Tegelersee: 3 E$$, sonst nur P$$.
12. X. ’09 „ 1 E?, 1 unentwickeltes S, sonst viele P?$.
28. X. ’08 „ E$$ nicht selten,dd seltener als E$$, häufig junge SS, P $ ? selten (30 %).
i) Das Bestehen eines Minimums der Eiproduktion zwischen dem Frühjahrs- und dem Hochsommermaximum wird sehr
leicht durch folgende Überlegung verständlich. Die Spätwintertiere produzieren im April und Mai große Mengen von Jungen.
Wenn sie dann im Mai bis Ju n i aussterben, wimmelt das Wasser (wie auch Wesenberg-Lund beobachtete) von enormen Mengen
jüngerer Tiere, die, im Beginn der Eierproduktion stehend, n u r wenige (1—-3) Eier gleichzeitig im Brutraum tragen. E rs t wenn
diese junge F rühjahrsbrut herangewachsen ist, produziert sie im Hochsommer (Juli-August) größere Eisätze (5—6 Eier). Ich will
bemerken, daß Wesenberg-Lund (pag. 222) in diesem P unkte abweichende Beobachtungen gemacht hat.
®) Ich benutze hier und weiterhin folgende Abkürzungen: Mit unentwickelten S S will ich S S m it noch unbeweglichen
Tastantennen bezeichnen. E = Ephippium. E $ = befruchtungsbedürftiges Ephippium-Weibchen. P ? = parthenogenetisch.es
Weibchen.
Zoologica. H e ft 63. I ß