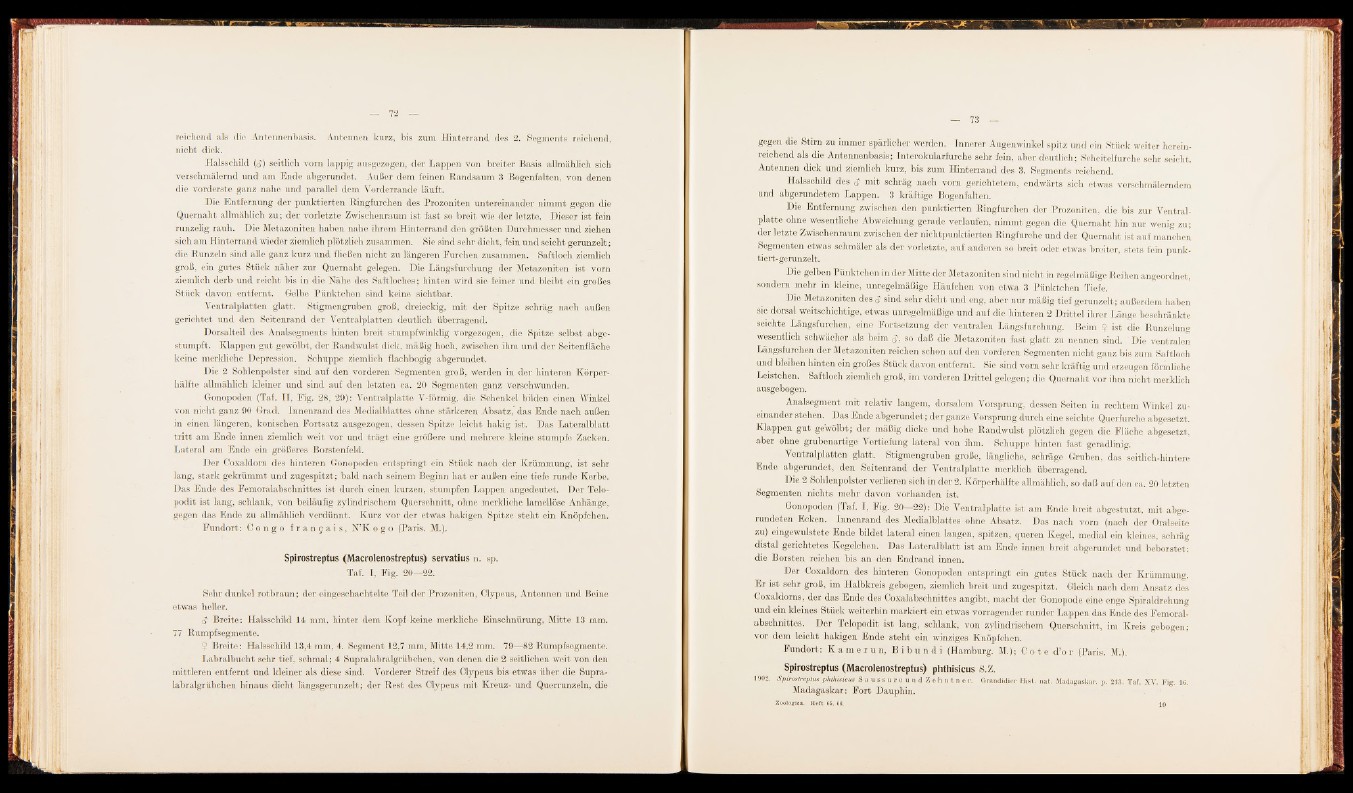
reichend als die Antennenbasis. Antennen kurz, bis zum Hinterrand des 2. Segments reichend,
nicht dick.
Halsschild ($) seitlich vorn lappig ausgezogen, der Lappen von breiter Basis allmählich sich
verschmälernd und am Ende abgerundet. Außer dem feinen Randsaum 3 Bogenfalten, von denen
die vorderste ganz nahe und parallel dem Vorderrande läuft.
Die Entfernung der punktierten Ringfurchen des Prozoniten untereinander nimmt gegen die
Quernaht allmählich zu; der vorletzte Zwischenraum ist fast so breit wie der letzte. Dieser ist fein
runzelig rauh. Die Metazoniten haben nahe ihrem Hinterrand den größten Durchmesser und ziehen
sich am Hinterrand wieder ziemlich plötzlich zusammen. Sie sind sehr dicht, fein und seicht gerunzelt ;
die Runzeln sind alle ganz kurz und fließen nicht zu längeren Furchen zusammen. Saftloch ziemlich
groß, ein gutes Stück näher zur Quernaht gelegen. Die Längsfurchung der Metazoniten ist vorn
ziemlich derb und reicht bis in die Nähe des Saftloches; hinten wird sie feiner und bleibt ein großes
Stück davon entfernt. Gelbe Pünktchen sind keine sichtbar.
Ventralplatten glatt. Stigmengruben groß, dreieckig, mit der Spitze schräg nach außen
gerichtet und den Seitenrand der Ventralplatten deutlich überragend.
Dorsalteil des Analsegments hinten breit stumpfwinklig vorgezogen,. die Spitze selbst abgestumpft.
Klappen gut gewölbt, der Randwulst dick, mäßig hoch, zwischen ihm und der Seitenfläche
keine merkliche Depression. Schuppe ziemlich flachbogig abgerundet.
Die 2 Sohlenpolster sind auf den vorderen Segmenten groß, werden in der hinteren Körperhälfte
allmählich kleiner und sind auf den letzten ca. 20 Segmenten ganz verschwunden.
Gonopoden (Taf. II, Fig. 28, 29): Ventralplatte V-förmig, die Schenkel bilden einen Winkel
von nicht ganz 90 Grad. Innenrand des Medialblattes ohne stärkeren Absatz,' das Ende nach außen
in einen längeren, konischen Fortsatz ausgezogen, dessen Spitze leicht hakig ist. Das Laterälblatt
tritt am Ende innen ziemlich weit vor und trägt eine größere und mehrere kleine stumpfe Zacken.
Lateral am Ende ein größeres Borstenfeld.
Der Coxaldorn des hinteren Gonopoden entspringt ein Stück nach der Krümmung, ist sehr
lang, stark gekrümmt und zugespitzt; bald nach seinem Beginn hat er außen eine tiefe runde Kerbe.
Das Ende des Femoralabschnittes ist durch einen kurzen, stumpfen Lappen angedeutet. Der Telo-
podit ist lang, schlank, von beiläufig zylindrischem Querschnitt, ohne merkliche lamellöse Anhänge,
gegen das Ende zu allmählich verdünnt. Kurz vor der etwas hakigen Spitze steht ein Knöpfchen.
Fundort: C o n g o f r a n ç a i s , N’K o g o (Paris. M.).
Spirostreptus (Macrolenostreptus) servatius n. sp.
Taf. I, Fig. 20—22.
Sehr dunkel rotbraun; der eingeschachtelte Teil der Prozoniten, Clypeus, Antennen und Beine
etwas heller.
c? Breite: Halsschild 14 mm, hinter dem Kopf keine merkliche Einschnürung, Mitte 13 mm.
77 Rumpfsegmente.
$ Breite: Halsschild 13,4 mm, 4. Segment 12,7 mm, Mitte 14,2 mm. 79—82 Rumpfsegmente.
Labralbucht sehr tief, schmal; 4 Supralabralgrübchen, von denen die 2 seitlichen weit von den
mittleren entfernt und kleiner als diese sind. Vorderer Streif des Clypeus bis etwas über die Supralabralgrübchen
hinaus dicht längsgerunzelt; der Rest des Clypeus mit Kreuz- und Querrunzeln, die
gegen die Stirn zu immer spärlicher werden. Innerer Augenwinkel spitz und ein Stück weiter herein-
reichend als die Antennenbasis; Interokularfurche sehr fein, aber deutlich; Scheitelfurche sehr seicht.
Antennen dick und ziemlich kurz, bis zum Hinterrand des 3. Segments reichend.
Halsschild des 3 mit schräg nach vom gerichtetem, endwärts sich etwas verschmälerndem
und abgerundetem Lappen. 3 kräftige Bogenfalten.
Die Entfernung .zwischen den punktierten Ringfurchen der Prozoniten, die bis zur Ventralplatte
ohne wesentliche Abweichung gerade verlaufen, nimmt gegen die Quernaht hin nur Wenig zu;
der letzte Zwischenraum zwischen der nichtpunktierten Ringfurche und der Quemaht ist auf manchen
Segmenten etwas schmäler als der vorletzte, auf anderen so breit oder etwas breiter, stets fein punk-
tiert-gerunzelt.
Die gelben Pünktchen in der Mitte der Metazoniten sind nicht in regelmäßige Reihen angeordnet,
sondern mehr in kleine, unregelmäßige Häufchen von etwa 3 Pünktchen Tiefe.
Die Metazoniten des 3 sind sehr dicht und eng, aber nur mäßig tief gerunzelt; außerdem haben
sie dorsal weitschiohtige, etwas unregelmäßige und auf die hinteren 8 Drittel ihrer Länge beschränkte
seichte Längsfurchen, eine Fortsetzung der ventralen Längsfurchung. Beim £ ist die Runzelung
wesentlich schwächer als beim 3, _so daß die Metazoniten fast glatt zu nennen sind. Die ventralen
Längsfüroheü der Metazoniten reichen schon auf den vorderen Segmenten nicht ganz bis zum Saftloeh
und bleiben hinten ein großes Stück davon entfernt. Sie sind vorn, sehr kräftig und erzeugen förmliche
Leistehen. Saftloch ziemlich: groß, im vorderen Drittel gelegen; die Quemaht vor ihm nicht merklich
ausgebogen.
Analsegment mit relativ langem, dorsalem Vorsprung, dessen Seiten in rechtem Winkel zueinander
stehen. Das Ende abgerundet ; der ganze Vorsprung durch eine seichte Querfurche abgesetzt.
Klappen gut gewölbt; der mäßig dicke und hohe Randwulst plötzlich gegen die Fläche abgesetzt,
aber ohne grubenartige Vertiefung lateral von ihm. Schuppe hinten fast geradlinig.
Ventralplatten glatt. Stigmengruben große, längliche, schräge Gruben, das seitlich-hintere
Ende abgerundet, den Seitenrand der Ventralplatte merklich überragend.
Die 2 Sohlenpolster verlieren sich in der 2. Körperhälfte allmählich, so daß auf den ca. 20 letzten
Segmenten nichts mehr davon vorhanden ist.
Gonopoden (Taf. I, Fig. 20 22): Die Ventralplatte ist am Ende breit abgestutzt, mit abgerundeten
Ecken. Innenrand des Medialblattes ohne Absatz. Das nach vorn (nach der Oralseite
zu) eingewulstete Ende bildet lateral einen langen, spitzen, queren Kegel, medial ein kleines, schräg
distal gerichtetes Kegelchen. Das Lateralblatt ist am Ende innen breit abgerundet und beborstet;
die Borsten reichen bis an den Endrand innen.
Der Coxaldorn des hinteren Gonopoden entspringt ein gutes Stück nach der Krümmung.
Er ist sehr groß, im Halbkreis gebogen, ziemlich breit und zugespitzt. Gleich nach dem Ansatz des
Coxaldorns, der das Ende des Coxalabschnittes angibt, macht der Gonopode eine enge Spiraldrehung
und ein kleines Stück weiterhin markiert ein etwas vorragender runder Lappen das Ende des Femoralabschnittes.
Der Telopodit ist lang, schlank, von zylindrischem Querschnitt, im Kreis gebogen;
vor dem leicht hakigen Ende steht ein winziges Knöpfchen.
Fundort: K am e r u n , B i b u n d i (Hamburg. M.); C o t e d’o r (Paris. M.).
Spirostreptus (Macrolenostreptus) phthisicus S.Z.
1902. Spirostreptus phthisicus S a u s s u r e u n d Z e h n t n e r . Grandidier Hist. nat. Madagaskar, p. 213. Ta f. XV. Fig. 16.
Madagaskar: Fort Dauphin.