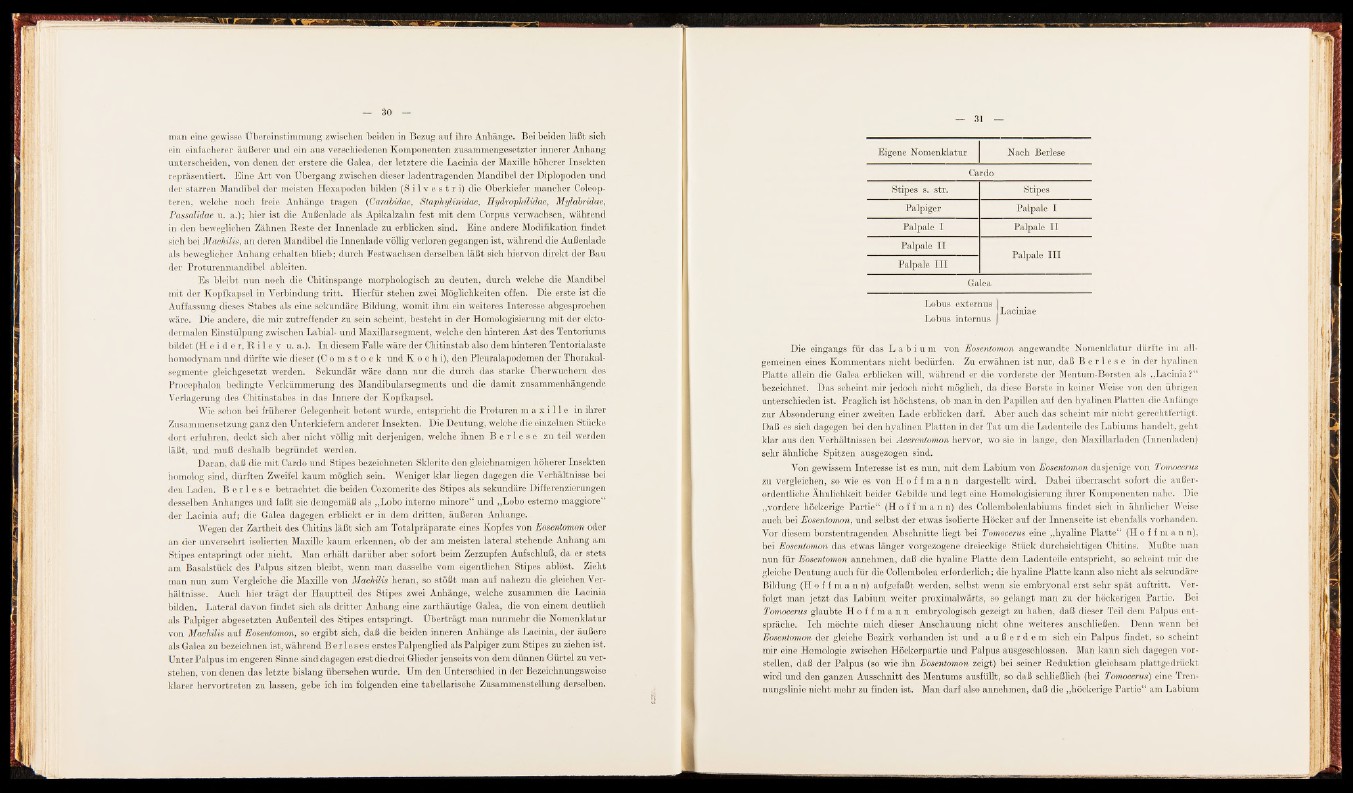
man eine gewisse Übereinstimmung zwischen beiden in Bezug auf ihre Anhänge. Bei beiden läßt sich
ein einfacherer äußerer und ein aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzter innerer Anhang
unterscheiden, von denen der erstere die Galea, der letztere die Lacinia der Maxille höherer Insekten
repräsentiert. Eine Art von Übergang zwischen dieser ladentragenden Mandibel der Diplopoden und
der starren Mandibel der meisten Hexapoden bilden ( S i l v e s t r i ) die Oberkiefer mancher Coleop-
teren, welche noch freie Anhänge tragen (Carabidae, Staphylinidae, Hydrophüidae, Myldbridae,
Passalidae u. a.); hier ist die Außenlade als Apikalzahn fest mit dem Corpus verwachsen, während
in den beweglichen Zähnen Reste der Innenlade zu erblicken sind. Eine andere Modifikation findet
sich bei Machüis, an deren Mandibel die Innenlade völlig verloren gegangen ist, während die Außenlade
als beweglicher Anhang erhalten blieb; durch Festwachsen derselben läßt sich hiervon direkt der Bau
der Proturenmandibel ableiten.
Es bleibt nun noch die Chitinspange morphologisch zu deuten, durch welche die Mandibel
mit der Kopfkapsel in Verbindung tritt. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten offen. Die erste ist die
Auffassung dieses Stabes als eine sekundäre Bildung, womit ihm ein weiteres Interesse abgesprochen
wäre. Die andere, die mir zutreffender zu sein scheint, besteht in der Homologisierung mit der ekto-
dermalen Einstülpung zwischen Labial- und Maxillarsegment, welche den hinteren Ast des Tentoriums
bildet ( He i d e r , R i l e y u. a.). In diesem Falle wäre der Chitinstab also dem hinteren Tentorialaste
homodynam und dürfte wie dieser ( C oms t o c k und K o c h i), den Pleuralapodemen der Thorakalsegmente
gleichgesetzt werden. Sekundär wäre dann nur die durch das starke Überwuchern des
Procephalon bedingte Verkümmerung des Mandibularsegments und die damit zusammenhängende
Verlagerung des Chitinstabes in das Innere der Kopfkapsel.
Wie schon bei früherer Gelegenheit betont wurde, entspricht die Proturen m a x i l l e in ihrer
Zusammensetzung ganz den Unterkiefern anderer Insekten. Die Deutung, welche die einzelnen Stücke
dort erfuhren, deckt sich aber nicht völlig mit derjenigen, welche ihnen B e r l e s e zu teil werden
läßt, und muß deshalb begründet werden.
Daran, daß die mit Cardo und Stipes bezeichneten Sklerite den gleichnamigen höherer Insekten
homolog sind, dürften Zweifel kaum möglich sein. Weniger klar liegen dagegen die Verhältnisse bei
den Laden. B e r l e s e betrachtet die beiden Coxomerite des Stipes als sekundäre Differenzierungen
desselben Anhanges und faßt sie demgemäß als „Lobo interno minore“ und „Lobo esterno maggiore“
der Lacinia auf; die Galea dagegen erblickt er in dem dritten, äußeren Anhänge.
Wegen der Zartheit des Chitins läßt sich am Totalpräparate eines Kopfes von Eosentomon oder
an der unversehrt isolierten Maxille kaum erkennen, ob der am meisten lateral stehende Anhang am
Stipes entspringt oder nicht. Man erhält darüber aber sofort beim Zerzupfen Aufschluß, da er stets
am Basalstück des Palpus sitzen bleibt, wenn man dasselbe vom eigentlichen Stipes ablöst. Zieht
man nun zum Vergleiche die Maxille von Machüis heran, so stößt man auf nahezu die gleichen Verhältnisse.
Auch hier trägt der Hauptteil des Stipes zwei Anhänge, welche zusammen die Lacinia
bilden. Lateral davon findet sich als dritter Anhang eine zarthäutige Galea, die von einem deutlich
als Palpiger abgesetzten Außenteil des Stipes entspringt. Überträgt man nunmehr die Nomenklatur
von Machüis auf Eosentomon, so ergibt sich, daß die beiden inneren Anhänge als Lacinia, der äußere
als Galea zu bezeichnen ist, während B e r le s es erstes Palpenglied als Palpiger zum Stipes zu ziehen ist.
Unter Palpus im engeren Sinne sind dagegen erst die drei Glieder jenseits von dem dünnen Gürtel zu verstehen,
von denen das letzte bislang übersehen wurde. Um den Unterschied in der Bezeichnungsweise
klarer hervortreten zu lassen, gebe ich im folgenden eine tabellarische Zusammenstellung derselben.
Eigene Nomenklatur Nach Berlese
Cardo
Stipes s. str. Stipes
Palpiger Palpale I
Palpale I Palpale II
Palpale II
Palpale III
Palpale I II
Galea
Lobus externus
> Lacimae
Lobus internus J
Die eingangs für das L a b i u m von Eosentomon angewandte Nomenklatur dürfte im allgemeinen
eines Kommentars nicht bedürfen. Zu erwähnen ist nur, daß B e r l e s e in der hyalinen
Platte allein die Galea erblicken will, während er die vorderste der Mentum-Borsten als „Lacinia?“
bezeichnet. Das scheint mir jedoch nicht möglich, da diese Borste in keiner Weise von den übrigen
unterschieden ist. Fraglich ist höchstens, ob man in den Papillen auf den hyalinen Platten die Anfänge
zur Absonderung einer zweiten Lade erblicken darf. Aber auch das scheint mir nicht gerechtfertigt.
Daß es sich dagegen bei den hyalinen Platten in der Tat um die Ladenteile des Labiums handelt, geht
klar aus den Verhältnissen bei Acerentomon hervor, wo sie in lange, den Maxillarladen (Innenladen)
sehr ähnliche Spitzen ausgezogen sind.
Von gewissem Interesse ist es nun, mit dem Labium von Eosentomon dasjenige von Tomocerus
zu vergleichen, so wie es von H o f f m a n n dargestellt wird. Dabei überrascht sofort die außerordentliche
Ähnlichkeit beider Gebilde und legt eine Homologisierung ihrer Komponenten nahe. Die
„vordere höckerige Partie“ (H o f f m a n n) des Collembolenlabiums findet sich in ähnlicher Weise
auch bei Eosentomon, und selbst der etwas isolierte Höcker auf der Innenseite ist ebenfalls vorhanden.
Vor diesem borstentragenden Abschnitte liegt bei Tomocerus eine „hyaline Platte“ (H o f f m a n n),
bei Eosentomon das etwas länger vorgezogene dreieckige Stück durchsichtigen Chitins. Mußte man
nun für Eosentomon annehmen, daß die hyaline Platte dem Ladenteile entspricht, so scheint mir die
gleiche Deutung auch für die Colleinbolen erforderlich; die hyaline Platte kann also nicht als sekundäre
Bildung (H o f f m a n n) aufgefaßt werden, selbst wenn sie embryonal erst sehr spät auftritt. Verfolgt
man jetzt das Labium weiter proximalwärts, so gelangt man zu der höckerigen Partie. Bei
Tomocerus glaubte H o f f m a n n embryologisch gezeigt zu haben, daß dieser Teil dem Palpus entspräche.
Ich möchte mich dieser Anschauung nicht ohne weiteres anschließen. Denn wenn bei
Eosentomon der gleiche Bezirk vorhanden ist und a u ß e r d e m sich ein Palpus findet, so scheint
mir eine Homologie zwischen Höckerpartie und Palpus ausgeschlossen. Man kann sich dagegen vorstellen,
daß der Palpus (so wie ihn Eosentomon zeigt) bei seiner Reduktion gleichsam plattgedrückt
wird und den ganzen Ausschnitt des Mentums ausfüllt, so daß schließlich (bei Tomocerus) eine Trennungslinie
nicht mehr zu finden ist. Man darf also annehmen, daß die „höckerige Partie“ am Labium