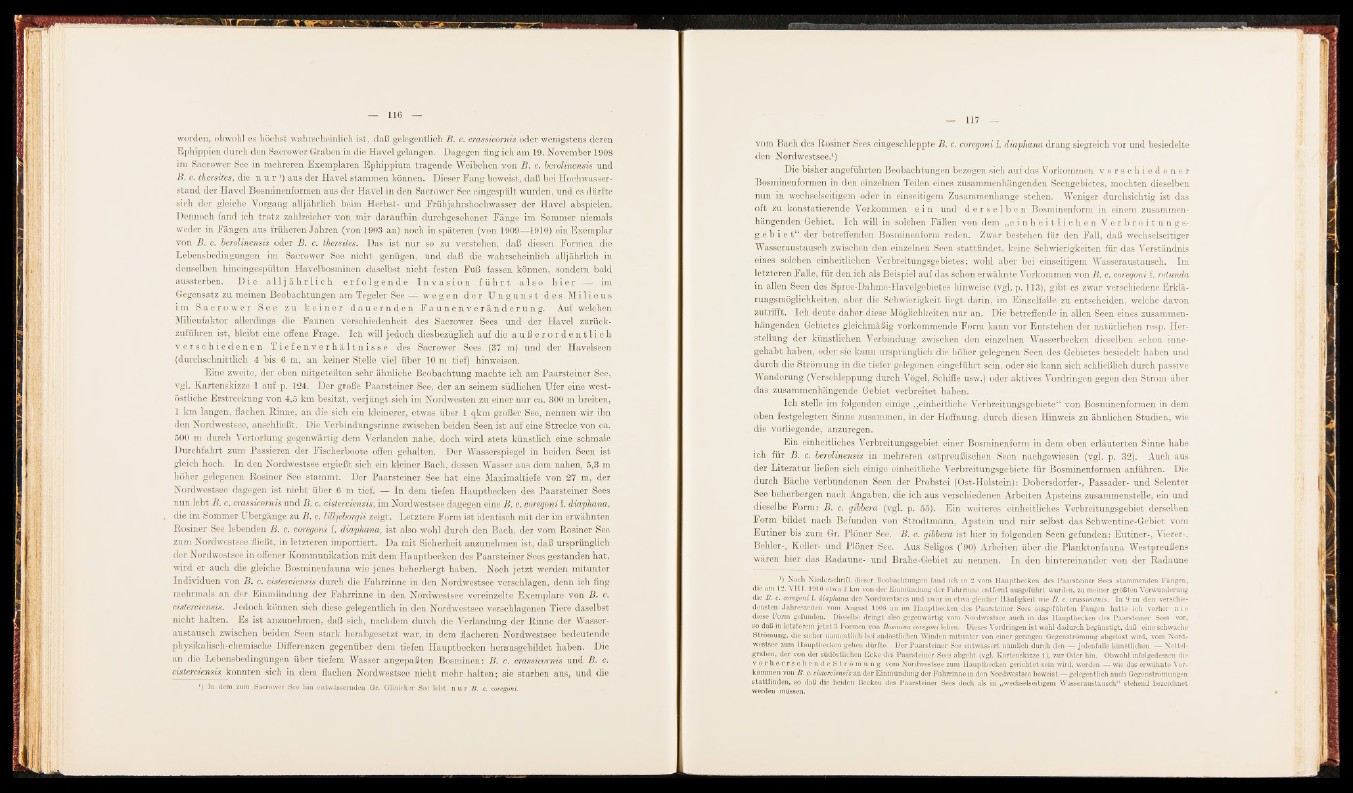
worden, obwohl es höchst wahrscheinlich ist, daß gelegentlich B. c. crassicornis oder wenigstens deren
Ephippien durch den Sacrower Graben in die Havel gelangen. Dagegen fing ich am 19. November 1908
im Sacrower See in mehreren Exemplaren Ephippium tragende Weibchen von B. c. berolinensis und
B. c. thersites, die n u r 1) aus der Havel stammen können. Dieser Fang beweist, daß bei Hochwasserstand
der Havel Bosminenformen aus der Havel in den Sacrower See eingespült wurden, und es dürfte
sich der gleiche Vorgang alljährlich beim Herbst- und Frühjahrshochwasser der Havel abspielen.
Dennoch fand ich trotz zahlreicher von mir daraufhin durchgesehener Fänge im Sommer niemals
weder in Fängen aus früheren Jahren (von 1903 an) noch in späteren (von 1909—1910) ein Exemplar
von B. c. berolinensis oder B. c. thersites. Das ist nur so zu verstehen, daß diesen Formen die
Lebensbedingungen im Sacrower See nicht genügen, und daß die wahrscheinlich alljährlich in
denselben hineingespülten Havelbosminen daselbst nicht festen Fuß fassen können, sondern bald
aussterben. D i e a l l j ä h r l i c h e r f o l g e n d e I n v a s i o n f ü h r t a l s o h i e r im
Gegensatz zu meinen Beobachtungen am Tegeler See S w e g e n d e r U n g u n s t d e s Mi l i e u s
im S a c r o w e r See zu k e i n e r d a u e r n d e n F a u n e n v e r ä n d e r u n g . Auf welchen
Milieufaktor allerdings die Faunen Verschiedenheit des Sacrower Sees und der Havel zurückzuführen
ist, bleibt eine offene Frage. Icii will jedoch diesbezüglich auf die a u ß e r o r d e n t l i c h
v e r s c h i e d e n e n T i e f e n v e r h ä l t n i s s e des Sacrower Sees (37 m) und der Havelseen
(durchschnittlich 4 bis 6 m, an keiner Stelle viel über 10 m tief) hinweisen.
Eine zweite, der eben mitgeteilten sehr ähnliche Beobachtung machte ich am Paarsteiner See,
vgl. Kartenskizze 1 auf p. 124. Der große Paarsteiner See, der an seinem südlichen Ufer eine westöstliche
Erstreckung von 4,5 km besitzt, verjüngt sich im Nordwesten zu einer nur ca. 300 m breiten,
1 km langen, flachen Rinne, an die sich ein kleinerer, etwas über 1 qkm großer See, nennen wir ihn
den Nordwestsee, anschließt. Die Verbindungsrinne zwischen beiden Seen ist auf eine Strecke von ca.
500 m durch Vertorfung gegenwärtig dem Verlanden nahe, doch wird stets künstlich eine schmale
Durchfahrt zum Passieren der Fischerboote offen gehalten. Der Wasserspiegel in beiden Seen ist
gleich hoch. In den Nordwestsee ergießt sich ein kleiner Bach, dessen Wasser aus dem nahen, 5,3 m
höher gelegenen Rosiner See stammt. Der Paarsteiner See hat eine Maximaltiefe von 27 m, der
Nordwestsee dagegen ist nicht über 6 m tief. — In dem tiefen Hauptbecken des Paarsteiner Sees
nun lebt B. c. crassicornis und B. c. cisterciensis, im Nordwestsee dagegen eine B. c. coregoni f. diaphana,
die im Sommer Übergänge zu B. c. lilljeborgii zeigt. Letztere Form ist identisch mit der im erwähnten
Rosiner See lebenden B. c. coregoni f. diaphana, ist also wohl durch den Bach, der vom Rosiner See
zum Nordwestsee fließt, in letzteren importiert. Da mit Sicherheit anzunehmen ist, daß ursprünglich
der Nordwestsee in offener Kommunikation mit dem Hauptbecken des Paarsteiner Sees gestanden hat,
wird er auch die gleiche Bosminenfauna wie jenes beherbergt haben. Noch jetzt werden mitunter
Individuen von B. c. cisterciensis durch die Fahrrinne in den Nordwestsee verschlagen, denn ich fing
mehrmals an der Einmündung der Fahrrinne in den Nord westsee vereinzelte Exemplare von B. c.
cisterciensis. Jedoch können sich diese gelegentlich in den Nord westsee verschlagenen Tiere daselbst
nicht halten. Es ist anzunehmen, daß sich, nachdem durch die Verlandung der Rinne der Wasseraustausch
zwischen beiden Seen stark herabgesetzt war, in dem flacheren Nordwestsee bedeutende
physikalisch-chemische Differenzen gegenüber dem tiefen Hauptbecken herausgebildet haben. Die
an die Lebensbedingungen über tiefem Wasser angepaßten Bosminen: B. c. crassicornis und B. c.
cisterciensis konnten sich in dem flachen Nordwestsee nicht mehr halten; sie starben aus, und die
l) In dem zum Sacrower See hin entwässernden Gr. Glinicker See lebt n u r B. c. coregoni.
—
vom Bach des Rosiner Sees eingeschleppte B. c. coregoni f. diaphana drang siegreich vor und besiedelte
den Nord westsee.1)
Die bisher angeführten Beobachtungen bezogen sich auf das Vorkommen v e r s c h i e d e n e r
Bosminenformen in den einzelnen Teilen eines zusammenhängenden Seengebietes, mochten dieselben
nun in wechselseitigem oder in einseitigem Zusammenhänge stehen. Weniger durchsichtig ist das
oft zu konstatierende Vorkommen e i n und d e r s e l b e n Bosminenform in einem zusammenhängenden
Gebiet. Ich will in solchen Fällen von dem „ e i n h e i t l i c h e n V e r b r e i t u n g s g
e b i e t “ der betreffenden Bosminenform reden. Zwar bestehen für den Fall, daß wechselseitiger
Wasseraustausch zwischen den einzelnen Seen stattfindet, keine Schwierigkeiten für das Verständnis
eines solchen einheitlichen Verbreitungsgebietes; wohl aber bei einseitigem Wasseraustausch. Im
letzteren Falle, für den ich als Beispiel auf das schon erwähnte Vorkommen von B. c. coregoni f. rotunda
in allen Seen des Spree-Dahme-Havelgebietes hinweise (vgl. p. 113), gibt es zwar verschiedene Erklärungsmöglichkeiten,
aber die Schwierigkeit liegt darin, im Einzelfalle zu entscheiden, welche davon
zutrifft. Ich deute daher diese Möglichkeiten nur an. Die betreffende in allen Seen eines zusammenhängenden
Gebietes gleichmäßig vorkommende Form kann vor Entstehen der natürlichen resp. Herstellung
der künstlichen Verbindung zwischen den einzelnen Wasserbecken dieselben schon innegehabt
haben, oder sie kann ursprünglich die höher gelegenen Seen des Gebietes besiedelt haben und
durch die Strömung in die tiefer gelegenen eingeführt sein, oder sie kann sich schließlich durch passive
Wanderung (Verschleppung durch Vögel, Schiffe usw.) oder aktives Vordringen gegen den Strom über
das zusammenhängende Gebiet verbreitet haben.
Ich stelle im folgenden einige „einheitliche Verbreitungsgebiete“ von Bosminenformen in dem
oben festgelegten Sinne zusammen,, in der Hoffnung, durch diesen Hinweis zu ähnlichen Studien, wie
die vorliegende, anzuregen.
Ein einheitliches Verbreitungsgebiet einer Bosminenform in dem oben erläuterten Sinne habe
ich für B. c. berolinensis in mehreren ostpreußischen Seen nachgewiesen (vgl. p. 32). Auch aus
der Literatur ließen sich einige einheitliche Verbreitungsgebiete für Bosminenformen anführen. Die
durch Bäche verbundenen Seen der Probstei (Ost-Holstein): Dobersdorfer-, Passader- und Selenter
See beherbergen nach Angaben, die ich aus verschiedenen Arbeiten Apsteins zusammenstelle, ein und
dieselbe Form: B. c. gibbera (vgl. p. 55). Ein weiteres einheitliches Verbreitungsgebiet derselben
Form bildet nach Befunden von Strodtmann, Apstein und mir selbst das Schwentine-Gebiet vom
Eutiner bis zum Gr. Plöner See. B. c. gibbera ist hier in folgenden Seen gefunden: Eutiner-, Vierer-,
Behler-, Keller- und Plöner See. Aus Seligos (’90) Arbeiten über die Planktonfauna Westpreußens
waren hier das Radaune- und Brahe-Gebiet zu nennen. In den hintereinander von der Radaune
l ) Nach Niederschrift dieser Beobachtungen fand ich in 2 vom Hauptbecken des Paarsteiner Sees stammenden Fängen,
die am 12. VIII. 1910 etwa 2 km von der Einmündung der Fahrrinne entfe rnt ausgeführt wurden, zu m einer größten Verwunderung
die B. c. coregoni f. diaphana des Nordwestsees und zwar in etwa gleicher Häufigkeit wie B. c. crassicornis. In 9 zu den verschiedensten
Jahreszeiten vom August 1908 an im Hauptbecken des Paarsteiner Sees ausgeführten Fängen h a tte ich vorher n i e
diese Form gefunden. Dieselbe dringt also gegenwärtig vom Nordwestsee auch in das Hauptbecken des Paarsteiner Sees vor,
so daß in letzterem je tz t 3 Formen von Bosmina coregoni leben. Dieses Vordringen is t wohl dadurch begünstigt, daß eine schwache
Strömung, die sicher namentlich bei südöstlichen Winden mitunte r von einer geringen Gegenströmung abgelöst wird, vom Nordwestsee
zum Hauptbecken gehen dürfte. Der Paarsteiner See entwässert nämlich durch den — jedenfalls künstlichen — Netteigraben,
der von der südöstlichen Ecke des Paarsteiner Sees abgeht (vgl. Kartenskizze 1), zur Oder hin. Obwohl infolgedessen die
v o r h e r r s c h e n d e S t r ö m u n g vom Nordwestsee zum Hauptbecken gerichtet sein wird, werden — wie das erwähnte Vorkommen
von B. c. cisterciensis an der Einmündung der Fahrrinne in den Nordwestsee b eweist— gelegentlich auch Gegenströmungen
stattfinden, so daß die beiden Becken des Paarsteiner Sees doch als in „wechselseitigem Wasseraustausch“ stehend bezeichnet
werden müssen.