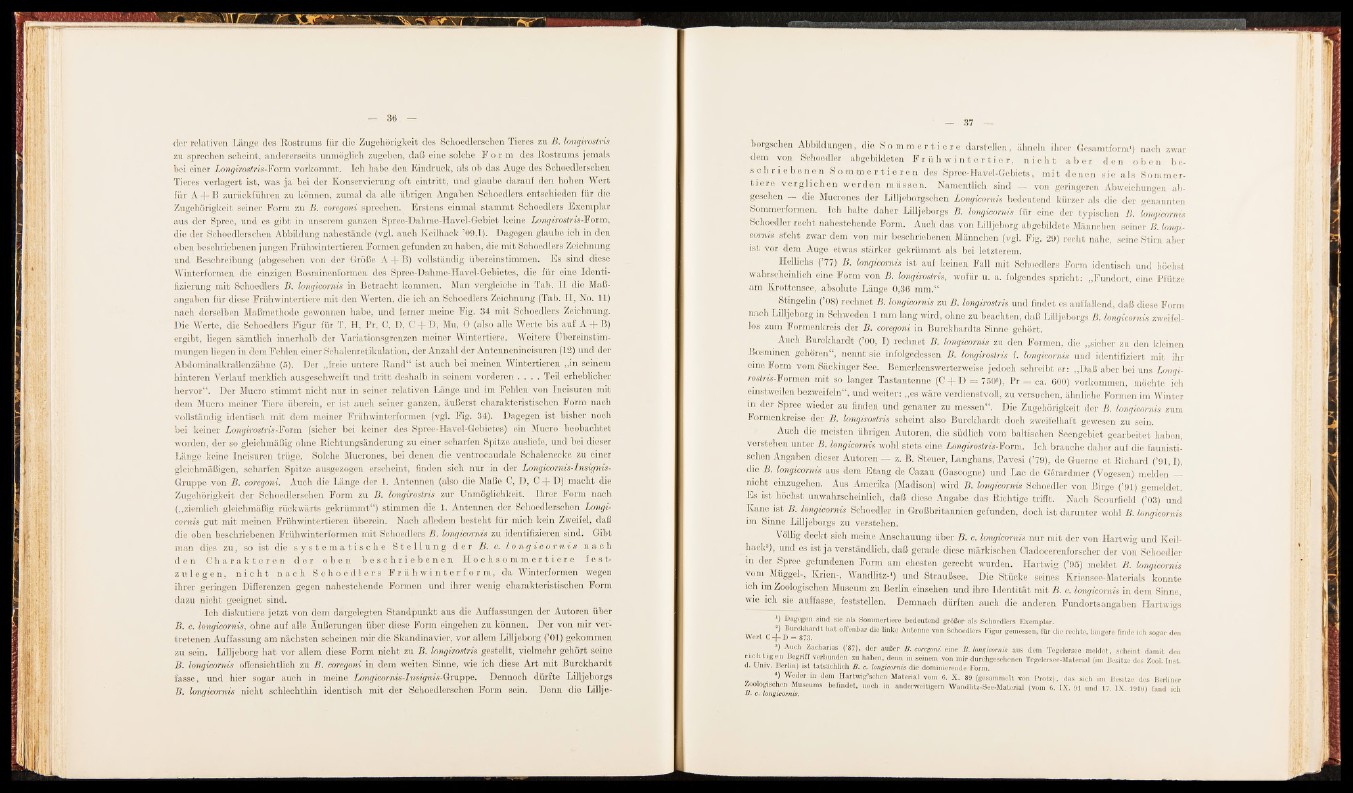
der relativen Länge des Rostrums für die Zugehörigkeit des Schoedlerschen Tieres zu B. longirostris
zu sprechen scheint, andererseits unmöglich zugeben, daß eine solche F o rm des Rostrums jemals
bei einer Longirostris - Form vorkommt. Ich habe den Eindruck, als ob das Auge des Schoedlerschen
Tieres verlagert ist, was ja'bei der Konservierung oft eintritt, und glaube darauf den hohen Wert
für A + B zurückführen zu können, zumal da alle übrigen Angaben Schoedlers entschieden für die
Zugehörigkeit seiner Form zu B. coregoni sprechen. Erstens einmal stammt Schoedlers Exemplar
aus der Spree, und es gibt in unserem ganzen Spree-Dahme-Havel-Gebiet keine Longirostris-J?orm,
die der Schoedlerschen Abbildung nahestände (vgl. auch Keilhack ’09,1). Dagegen glaube ich in den
oben beschriebenen jungen Frühwintertieren Formen gefunden zu haben, die mit Schoedlers Zeichnung
und Beschreibung (abgesehen von der Größe A + B) vollständig übereinstimmen. Es sind diese
Winterformen die einzigen Bosminenformen des Spree-Dahme-Havel-Gebietes, die für eine Identifizierung
mit Schoedlers B. longicornis in Betracht kommen. Man vergleiche in Tab. I I die Maßangaben
für diese Frühwintertiere mit den Werten, die ich an Schoedlers Zeichnung (Tab. II, No. 11)
nach derselben Maßmethode gewonnen habe, und ferner meine Fig. 34 mit Schoedlers Zeichnung.
Die Werte, die Schoedlers Figur für T, H, Pr, C, D, C + D, Mu, 0 (also alle Werte bis auf A + B)
ergibt, liegen sämtlich innerhalb der Variationsgrenzen meiner Vintertiere. Weitere Übereinstimmungen
hegen in dem Fehlen einer Schalenretikulation, der Anzahl der Antennenincisuren (12) und der
Abdominalkrallenzähne (5). Der „freie untere Rand“ ist auch bei meinen Wintertieren „in seinem
hinteren Verlauf merklich ausgeschweift und tritt deshalb in seinem vorderen . . . . Teil erheblicher
hervor“. Der Mucro stimmt nicht nur in seiner relativen Länge und im Fehlen von Incisuren mit
dem Mucro meiner Tiere überein, er ist auch seiner ganzen, äußerst charakteristischen Form nach
vollständig identisch mit dem meiner Frühwinterformen (vgl. Fig. 34). Dagegen ist bisher noch
bei keiner Longirostris-^orm (sicher bei keiner des Spree-Havel-Gebietes) ein Mucro beobachtet
worden, der so gleichmäßig ohne Richtungsänderung zu einer scharfen Spitze ausliefe, und bei dieser
Länge keine Incisuren trüge. Solche Mucrones, bei denen die ventrocaudale Schalenecke zu einer
gleichmäßigen, scharfen Spitze ausgezogen erscheint, finden sich nur in der Longicornis-Insignis-
Gruppe von B. coregoni. Auch die Länge der 1. Antennen (also die Maße C, D, C + D) macht die
Zugehörigkeit der Schoedlerschen Form zu B. longirostris zur Unmöglichkeit. Ihrer Form nach
(„ziemlich gleichmäßig rückwärts gekrümmt“) stimmen die 1. Antennen der Schoedlerschen Longicornis
gut mit meinen Frühwintertieren überein. Nach alledem besteht für mich kein Zweifel, daß
die oben beschriebenen Frühwinterformen mit Schoedlers B. longicornis zu identifizieren sind. Gibt
man dies zu, so ist die s y s t e m a t i s c h e S t e l l u n g d e r B. c. l o n g i c o r n i s n a c h
d e n C h a r a k t e r e n d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n H o c h s o m m e r t i e r e f e s t z
u l e g e n , n i c h t n a c h S c h o e d l e r s F r ü h w i n t e r f o r m , da Winterformen wegen
ihrer geringen Differenzen gegen nahestehende Formen und ihrer wenig charakteristischen Form
dazu nicht geeignet sind.
Ich diskutiere jetzt von dem dargelegten Standpunkt aus die Auffassungen der Autoren über
B. c. longicornis, ohne auf alle Äußerungen über diese Form eingehen zu können. Der von mir vertretenen
Auffassung am nächsten scheinen mir die Skandinavier, vor allem Lilljeborg (’01) gekommen
zu sein. Lilljeborg hat vor allem diese Form nicht zu B. longirostris gestellt, vielmehr gehört seine
B. longicornis offensichtlich zu B. coregoni in dem weiten Sinne, wie ich diese Art mit Burckhardt
fasse, und hier sogar auch in meine Longicornis-Insignis-Qiup'pe. Dennoch dürfte Lilljeborgs
B. longicornis nicht schlechthin identisch mit der Schoedlerschen Form sein. Denn die Lilljeborgschen
Abbildungen, die S o m m e r t i e r e darateUen, ähneln ihrer Gesamtform1) nach zwar
dem von Schoedler abgebildeten 1?r i i h w i n t e r t i er , n i c h t a b e r d e n o b e n bes
c h r i e b e n e n S o m m e r t i e r e n des Spree-Havel-Gebiets, m it denen sie als Sommer t
iere vergl ichen werden müssen. Namentlich sind — von geringeren Abweichungen abgesehen
— die Mucrones der Lilljeborgschen Longicornis bedeutend kürzer als die der genannten
Sommerformen. Ich halte daher Lilljeborgs B. longicornis für eine der typischen B. longicornis
Schoedler recht nahestehende Form. Auch das von Lilljeborg abgebildete Männchen seiner B. longicornis
steht zwar dem von mir beschriebenen Männchen .(vgl. Fig. 29) recht nahe, seine Stirn aber
ist vor dem Auge etwas stärker gekrümmt als bei letzterem.
Helliehs (’77) B. longicornis ist auf keinen Fall mit Schoedlers Form identisch und höchst
wahrscheinlich eine Form von B. longirostris, wofür u. a. folgendes spricht: „Fundort, eine Pfütze
am Krottensee, absolute Länge 0,36 mm.“
Stingelin (’08) rechnet B. longicornis zu B. longirostris und findet es auffallend, daß diese Form
nach Lilljeborg in Schweden 1 mm lang wird, ohne zu beachten, daß Lilljeborgs B. longicornis zweifellos
zum Formenkreis der B. coregoni in Burckhardts Sinne gehört.
Auch Burckhardt (’00, I) rechnet B. longicornis zu den Formen, die ^sicher zu den kleinen
Bosmmen gehören“, nennt sie infolgedessen B. longirostris f. longicornis und identifiziert mit ihr
eine Form vom Säckinger See. Bemerkenswerterweise jedoch schreibt er: „Daß aber bei uns Longi-
rostns-Formen mit so langer Tastantenne (C + D HlßO*), Pr = ca. 600) Vorkommen, möchte ich
einstweilen bezweifeln“, und weiter: „es wäre verdienstvoll, zu versuchen, ähnliche Formen im Winter
in der Spree wieder zu finden und genauer zu messen“. Die Zugehörigkeit der B. longicornis zum
Formenkreise der B. longirostris scheint also Burckhardt doch zweifelhaft gewesen zu sein.
Auch die meisten übrigen Autoren, die südlich vom baltischen Seengebiet gearbeitet haben,
verstehen unter B. longicornis wohl stets eine Longwoslris-Jorm. Ich brauche daher auf die faunisti-
« h e n Angaben dieser Autoren — z. B. Steuer, Langhans, Pavesi (’79), de Guerne et Richard (’91,1),
die B. longicornis aus dem Etang de Cazau (Gascogne) und Lac de Gerardmer (Vogesen) melden_
nicht einzugehen. Aus Amerika (Madison) wird B. longicornis Schoedler von Birge (’91) gemeldet.
Es ist höchst unwahrscheinlich, daß diese Angabe das Richtige trifft. Nach Scourfield (’03) und
Kane ist B. longicornis Schoedler in Großbritannien gefunden, doch ist darunter wohl B. longicornis
im Sinne Lilljeborgs zu verstehen.
Völlig deckt sich meine Anschauung über B. c. longicornis nur mit der von Hartwig und Keil-
hack3), und es ist ja verständlich, daß gerade diese märkischen Cladocerenforscher der von Schoedler
m der Spree gefundenen Form am ehesten gerecht wurden. Hartwig (’95) meldet B. longicornis
vom Müggel-, Krien-, Wandlitz-4) und Straußsee. Die Stücke seines Kriensee-Materials konnte
ich im Zoologischen Museum zu Berlin einsehen und ihre Identität mit B. c. longicornis in dem Sinne,
wie ich sie auffasse, feststellen. Demnach dürften auch die anderen Fundortsangaben Hartwigs
x) Dagegen sind sie als Sommertiere bedeutend größer als Schoedlers Exemplar.
) Burckhardt h a t offenbar die linke Antenne von Schoedlers Figur gemessen, für die rechte, längere finde ich sogar den
Wert C + - D = 873.
) Auch Zacharias (’87), d er außer B. coregoni eine B. longicornis aus dem Tegelersee meldet, scheint d am it den
r i c h t i g e n Begriff verbunden zu haben, denn in seinem von mir durchgesehenen Tegelersee-Material (im Besitze des Zool. Inst,
d. Univ. Berlin) ist tatsächlich B. c. longicornis die dominierende Form.
. ^ Weder in dem Hartwig’schen Material vom 6. X. 89 (gesammelt von P ro tz ), das sich im Besitze des Berliner
Zoologischen Museums befindet,- noch in anderweitigem Wandlitz-See-Material (vom 6. IX . 91 und 17. IX . 1910) fand ich
B. c. longicornis.