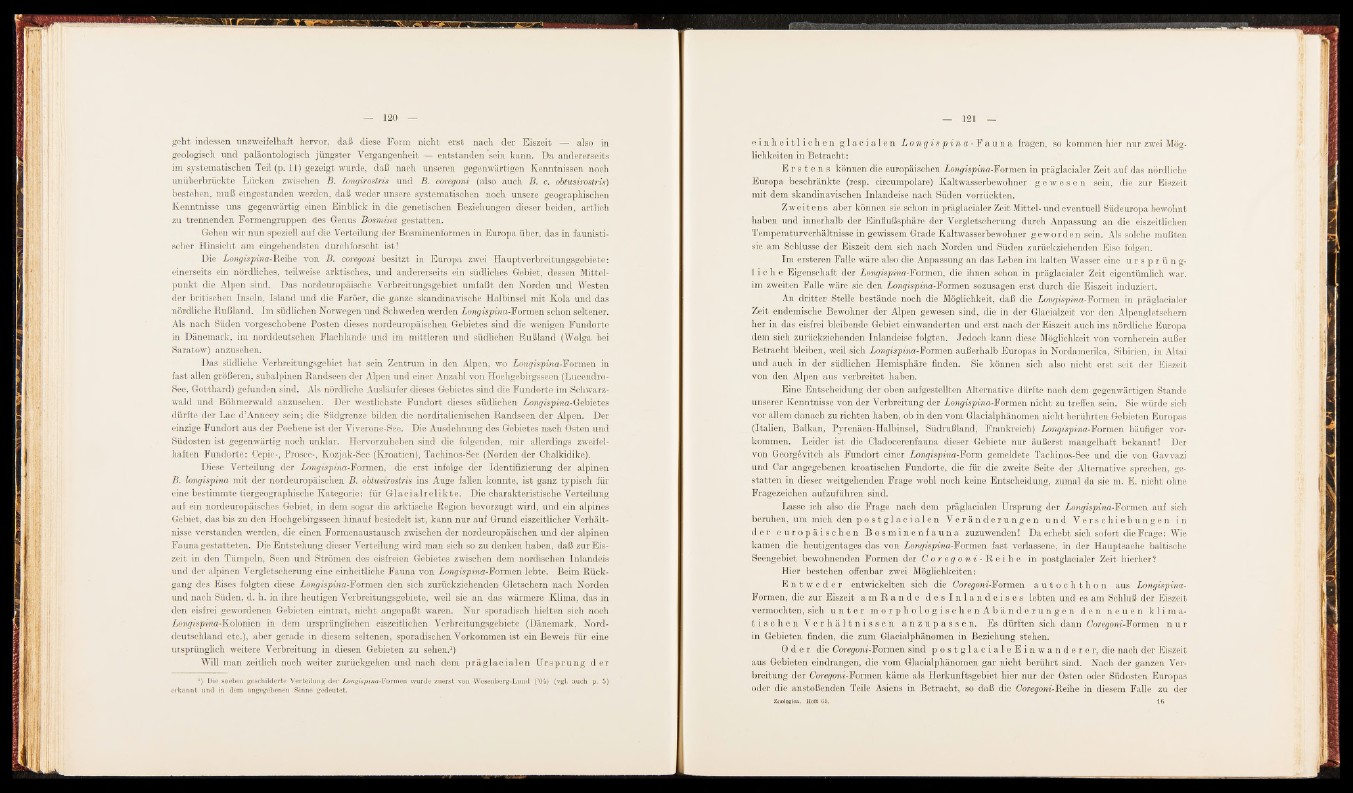
gellt indessen unzweifelhaft hervor, daß diese Form nicht erst nach der Eiszeit — also in
geologisch und paläontologisch jüngster Vergangenheit — entstanden "sein kann. Da andererseits
im systematischen Teil (p. 11) gezeigt wurde, daß nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen noch
unüberbrückte Lücken zwischen B. longirostris und B. coregoni (also auch B. c. obtusirostris)
bestehen, muß eingestanden werden, daß weder unsere systematischen noch unsere geographischen
Kenntnisse uns gegenwärtig einen Einblick in die genetischen Beziehungen dieser beiden, artlich
zu trennenden Formengruppen des Genus Bosmina gestatten.
Gehen wir nun speziell auf die Verteilung der Bosminenformen in Europa über, das in faunisti-
scher Hinsicht am eingehendsten durchforscht ist!
Die Longispina-Reihe von B. coregoni besitzt in Europa zwei Hauptverbreitungsgebiete:
einerseits ein nördliches, teilweise arktisches, und andererseits ein südliches Gebiet, dessen Mittelpunkt
die Alpen sind. Das nordeuropäische Verbreitungsgebiet umfaßt den Norden und Westen
der britischen Inseln, Island und die Faröer, die ganze skandinavische Halbinsel mit Kola und das
nördliche Kußland. Im südlichen Norwegen und Schweden werden Longispina-Formen schon seltener.
Als nach Süden vorgeschobene Posten dieses nordeuropäischen Gebietes sind die wenigen Fundorte
in Dänemark, im norddeutschen Flachlande und im mittleren und südlichen Rußland (Wolga bei
Saratow) anzusehen.
Das südliche Verbreitungsgebiet hat sein Zentrum in den Alpen, wo Longispina-Formen in
fast allen größeren, subalpinen Randseen der Alpen und einer Anzahl von Hochgebirgsseen (Lucendro-
See, Gotthard) gefunden sind. Als nördliche Ausläufer dieses Gebietes sind die Fundorte im Schwarzwald
und Böhmerwald anzusehen. Der westlichste Fundort dieses südlichen Longispina- Gebietes
dürfte der Lac d’Annecy sein; die Südgrenze bilden die norditalienischen Randseen der Alpen. Der
einzige Fundort aus der Poebene ist der Viverone-See. Die Ausdehnung des Gebietes nach Osten und
Südosten ist gegenwärtig noch unklar. Hervorzuheben sind die folgenden, mir allerdings zweifelhaften
Fundorte: Cepic-, Prosce-, Kozjak-See (Kroatien), Tachinos-See (Norden der Chalkidike).
Diese Verteilung der Longispina-Formen, die erst infolge ¿er Identifizierung der alpinen
B. longispina mit der nordeuropäischen B. obtusirostris ins Auge fallen konnte, ist ganz typisch für
eine bestimmte tiergeographische Kategorie: für G la c ia lr e lik te . Die charakteristische Verteilung
auf ein nordeuropäisches Gebiet, in dem sogar die arktische Region bevorzugt wird, und ein alpines,
Gebiet, das bis zu den Hochgebirgsseen hinauf besiedelt ist, kann nur auf Grund eiszeitlicher Verhältnisse
verstanden werden, die einen Formenaustausch zwischen der nordeuropäischen und der alpinen
Fauna gestatteten. Die Entstehung dieser Verteilung wird man sich so zu denken haben, daß zur Eiszeit
in den Tümpeln, Seen und Strömen des eisfreien Gebietes zwischen dem nordischen Inlandeis
und der alpinen Vergletscherung eine einheitliche Fauna von Longispina-Formen lebte. Beim Rückgang
des Eises folgten diese Longispina-Formen den sich zurückziehenden Gletschern nach Norden
und nach Süden, d. h. in ihre heutigen Verbreitungsgebiete, weil sie an das wärmere Klima, das in
den eisfrei gewordenen Gebieten eintrat, nicht angepaßt waren. Nur sporadisch hielten sich noch
Longispi/na-Kolonien in dem ursprünglichen eiszeitlichen Verbreitungsgebiete (Dänemark, Norddeutschland
etc.), aber gerade in diesem seltenen, sporadischen Vorkommen ist ein Beweis für eine
ursprünglich weitere Verbreitung in diesen Gebieten zu sehen.1)
Will man zeitlich noch weiter zurückgehen und nach dem p r ä g la c ia le n Ur sprung der
l) Die soeben geschilderte Verteilung der Longispina-Formen wurde zuerst von Wesenberg-Lund (’04) (vgl. auch p. 5)
e rkannt und in dem angegebenen Sinne gedeutet.
e i n h e i t l i c h e n g l a c i a l e n L o n g i s p i n a - F %, uns, fragen, so kommen hier nur zwei Möglichkeiten
in Betracht:
E r s t e n s können die europäischen Longispina-Formen in präglacialer Zeit auf das nördliche
Europa beschränkte (resp. circumpolare) Kaltwasserbewohner g e w e s e n sein, die zur Eiszeit
mit dem skandinavischen Inlandeise nach Süden vorrückten.
Zw e iten s aber können sie schon in präglacialer Zeit Mittel- und eventuell Südeuropa bewohnt
haben und innerhalb der Einflußsphäre der Vergletscherung durch Anpassung an die eiszeitlichen
Temperatur Verhältnisse in gewissem Grade Kaltwasserbewohner geworden sein. Als solche mußten
sie am Schlüsse der Eiszeit dem sich nach Norden und Süden zurückziehenden Eise folgen.
Im ersteren Falle wäre also die Anpassung an das Leben im kalten Wasser eine u r s p r ü n g l
i c h e Eigenschaft der Longispina-Formen, die ihnen schon in präglacialer Zeit eigentümlich war.
im zweiten Falle wäre sie den Longispina-F ormeo. sozusagen erst durch die Eiszeit induziert.
An dritter Stelle bestände noch die Möglichkeit, daß die Longispina-F oimen in präglacialer
Zeit endemische Bewohner der Alpen gewesen sind, die in der Glacialzeit vor den Alpengletschern
her in das eisfrei bleibende Gebiet einwanderten und erst nach der Eiszeit auch ins nördliche Europa
dem sich zurückziehenden Inlandeise folgten. Jedoch kann diese Möglichkeit von vornherein außer
Betracht bleiben, weil sich Longispina-Formen außerhalb Europas in Nordamerika, Sibirien, in Altai
und auch in der südlichen Hemisphäre finden. Sie können sich also nicht erst seit der Eiszeit
von den Alpen aus verbreitet haben.
Eine Entscheidung der oben aufgestellten Alternative dürfte nach dem gegenwärtigen Stande
unserer Kenntnisse von der Verbreitung der Longispina-Formen nicht zu treffen sein. Sie würde sich
vor allem danach zu richten haben, ob in den vom Glacialphänomen nicht berührten Gebieten Europas
(Italien, Balkan, Pyrenäen-Halbinsel, Südrußland, Frankreich) Longispina-Formen häufiger Vorkommen.
Leider ist die Cladocerenfauna dieser Gebiete nur äußerst mangelhaft bekannt! Der
von Georgevitch als Fundort einer Longispina-F orm. gemeldete Tachinos-See und die von Gavvazi
und Car angegebenen kroatischen Fundorte, die für die zweite Seite der Alternative sprechen, gestatten
in dieser weitgehenden Frage wohl noch keine Entscheidung, zumal da sie m. E. nicht ohne
Fragezeichen aufzuführen sind.
Lasse ich also die Frage nach dem präglacialen Ursprung der Longispina-Formen auf sich
beruhen, um mich den p o s t g l a c i a l e n V e r ä n d e r u n g e n u n d V e r s c h i e b u n g e n in
d e r e u r o p ä i s c h e n B o s m i n e n f a u n a zuzuwenden! Da erhebt sich sofort die Frage: Wie
kamen die heutigentages das von Longispina-F ormen fast verlassene, in der Hauptsache baltische
Seengebiet bewohnenden Formen der G o r e g o n i - ' R e i h e in postglacialer Zeit hierher?
Hier bestehen offenbar zwei Möglichkeiten:
E n t w e d e r entwickelten sich die Coregoni-Formen a u t o c h t h o n aus Longispina-
Formen, die zur Eiszeit a m R a n d e d e s I n l a n d e i s e s lebten und es am Schluß der Eiszeit
vermochten, sich u n t e r m o r p h o l o g i s c h e n A b ä n d e r u n g e n d e n n e u e n k l i m a t
i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n a n z u p a s s e n . Es dürften sich dann Coregoni-Foimen n u r
in Gebieten finden, die zum Glacialphänomen in Beziehung stehen.
O d e r die Coregoni- Formen sind p o s t g l a c i a l e E i n w a n d e r e r , die nach der Eiszeit
aus Gebieten eindrangen, die vom Glacialphänomen gar nicht berührt sind. Nach der ganzen Verbreitung
der Coregoni-Formen käme als Herkunftsgebiet hier nur der Osten oder Südosten Europas
oder die anstoßenden Teile Asiens in Betracht, so daß die Coregoni-Reihe in diesem Falle zu der
Zoologica. H e ft 63. 1 6