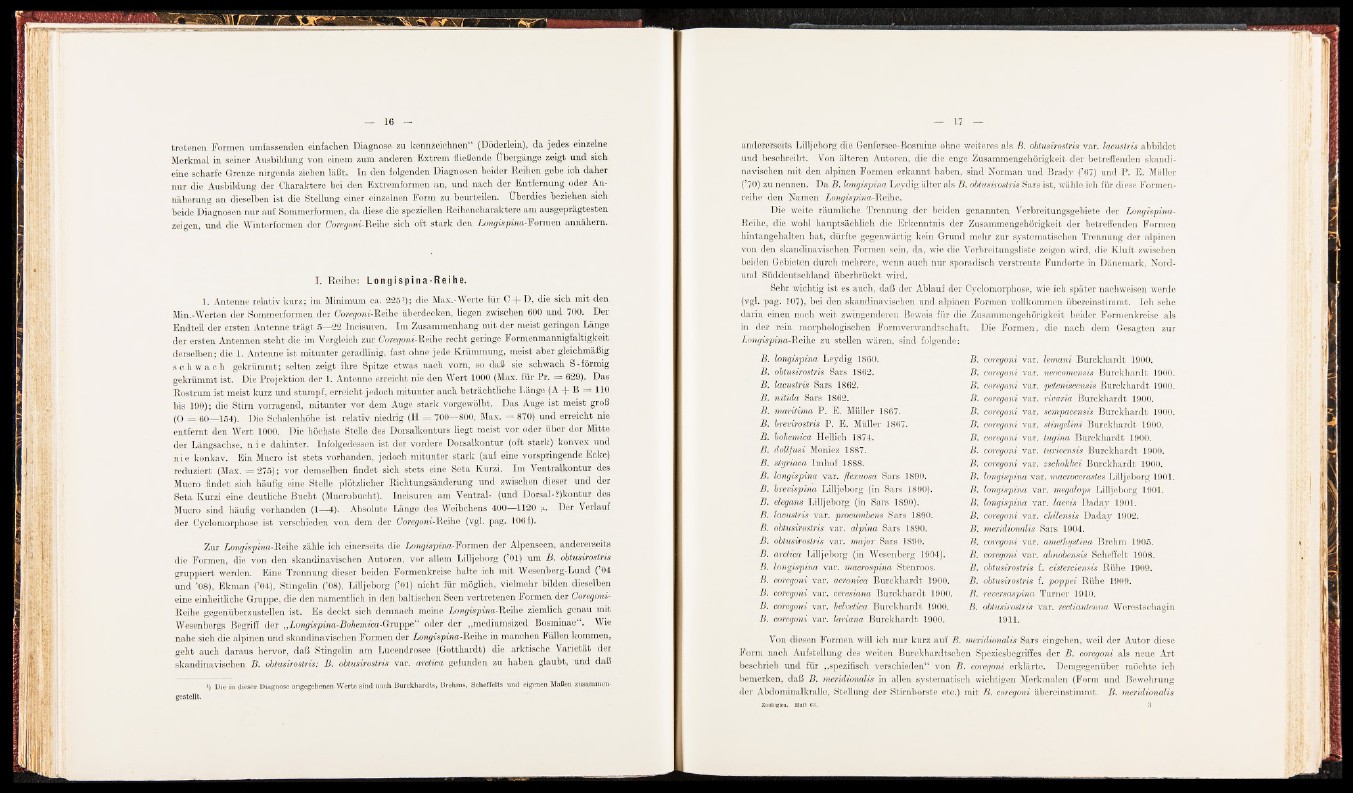
tretenen Formen umfassenden einfachen Diagnose- zu kennzeichnen“ (Döderlein), da jedes einzelne
Merkmal in seiner Ausbildung von einem zum anderen Extrem fließende Übergänge zeigt und sich
eine scharfe Grenze nirgends ziehen läßt. In den folgenden Diagnosen beider Reihen gebe ich daher
nur die Ausbildung der Charaktere bei den Extremformen an, und nach der Entfernung oder Annäherung
an dieselben ist die Stellung einer einzelnen Form zu beurteilen. Überdies beziehen sich
beide Diagnosen nur auf Sommerformen, da diese die speziellen Reihencharaktere am ausgeprägtesten
zeigen, und die Winterformen der Coregoni-Reihe sich oft stark den Longispina-Bormen annähern.
I. Reihe: Long i spi n a -Re ih e .
1. Antenne relativ kurz; im Minimum ca. 225x); die Max.-Werte für C + D, die sich mit den
Min.-Werten der Sommerformen der Coregoni-Reihe überdecken, liegen zwischen 600 und 700. Der
Endteil der ersten Antenne trägt 5—22 Incisuren. Im Zusammenhang mit der meist geringen Länge
der ersten Antennen steht die im Vergleich zur Coregoni-Reihe recht geringe Formenmannigfaltigkeit
derselben; die 1. Antenne ist mitunter geradlinig, fast ohne jede Krümmung, meist aber gleichmäßig
s c h w a c h gekrümmt; selten zeigt ihre Spitze etwas nach vorn, so daß sie schwach S-förmig
gekrümmt ist. Die Projektion der 1. Antenne erreicht nie den Wert 1000 (Max. für Pr. = 629). Das
Rostrum ist meist kurz und stumpf, erreicht jedoch mitunter auch beträchtliche Länge (A + B = 110
bis 190); die Stirn vorragend, mitunter vor dem Auge stark vorgewölbt. Das Auge ist meist groß
(0 = 60—154). Die Schalenhöhe ist relativ niedrig (H = 700—800, Max. — 870) und erreicht nie
entfernt den Wert 1000. Die höchste Stelle des Dorsalkonturs liegt meist vor oder über der Mitte
der Längsachse, n i e dahinter. Infolgedessen ist der vordere Dorsalkontur (oft stark) konvex und
n ie konkav. Ein Mucro ist stets vorhanden, jedoch mitunter stark (auf eine vorspringende Ecke)
reduziert (Max. = 275); vor demselben findet sich stets eine Seta Kurzi. Im Ventralkontur des
Mucro findet sich häufig eine Stelle plötzlicher Richtungsänderung und zwischen dieser und der
Seta Kurzi eine deutliche Bucht (Mucrobucht). Incisuren am Ventral- (und Dorsal-?)kontur des
Mucro sind häufig vorhanden (1—4). Absolute Länge des Weibchens 400—1120 p. Der Verlauf
der Cyclomorphose ist verschieden von dem der Cora/om-Reihe (vgl. pag. 106f).
Zur Longispina-Reihe zähle ich einerseits die Ijongispina-Formen der Alpenseen, andererseits
die Formen, die von den skandinavischen Autoren, vor allem Lilljeborg (’01) um B. öbtusirostris
gruppiert werden. Eine Trennung dieser beiden Formenkreise halte ich mit Wesenberg-Lund (04
und ’08), Ekman (’04), Stingelin (’08), Lilljeborg (’01) nicht für möglich, vielmehr bilden dieselben
eine einheitliche Gruppe, die den namentlich in den baltischen Seen vertretenen Formen der Coregoni-
Reihe gegenüberzustellen ist. Es deckt sich demnach meine Longispina-Reihe ziemlich genau mit
Wesenbergs Begriff der ,,Longispina-Bohemica-Qioppö‘ oder der ,,mediumsized Bosminae . Wie
nahe sich die alpinen und skandinavischen Formen der Longispina-Reihe in manchen Fällen kommen,
geht auch daraus hervor, daß Stingelin am Lucendrosee (Gotthardt) die arktische Varietät der
skandinavischen B. öbtusirostris: B. öbtusirostris var. arctica gefunden zu haben glaubt, und daß
x) Die in dieser Diagnose angegebenen Werte sind nach Burckhardts, Brehms, Scheffelts und eigenen Maßen zusammengestellt.
andererseits Lilljeborg die Genfersee-Bosmine ohne weiteres als B. öbtusirostris var. lacustris abbildet
und beschreibt. Von älteren Autoren, die die enge Zusammengehörigkeit der betreffenden skandinavischen
mit den alpinen Formen erkannt haben, sind Norman und Brady (’67) und P. E. Müller
(’70) zu nennen. Da B. longispina Leydig älter als B. öbtusirostris Sars ist, wähle ich für diese Formenreihe
den Namen Longispina-Beihe.
Die weite räumliche Trennung der beiden genannten Verbreitungsgebiete der Longispina-
Reihe, die wohl hauptsächlich die Erkenntnis der Zusammengehörigkeit der betreffenden Formen
hintangehalten hat, dürfte gegenwärtig kein Grund mehr zur systematischen Trennung der alpinen
von den skandinavischen Formen sein, da, wie die Verbreitungsliste zeigen wird, die Kluft zwischen
beiden Gebieten durch mehrere, wenn auch nur sporadisch verstreute Fundorte in Dänemark, Nord-
und Süddeutschland überbrückt wird.
Sehr wichtig ist es auch, daß der Ablauf der Cyclomorphose, wie ich später nachweisen werde
(vgl. pag. 107), bei den skandinavischen und alpinen Formen vollkommen übereinstimmt. Ich sehe
darin einen noch weit zwingenderen Beweis für die Zusammengehörigkeit beider Formenkreise als
in der rein morphologischen Formverwandtschaft. Die Formen, die nach dem Gesagten zur
Longispina-Reihe zu stellen wären, sind folgende:
B. longispina Leydig 1860. B.
B. öbtusirostris Sars 1862. B.
B. lacustris Sars 1862. B.
B. nitida Sars 1862. B.
B. maritima P. E. Müller 1867. B.
B. brevirostris P. E. Müller 1867. B.
B. böhemica Hellich 1874. B.
B. dollfusi Moniez 1887. B.
B. styriaca Imhof 1888. B.
B. longispina var. flexuosa Sars 1890. B.
B. brevispina Lilljeborg (in Sars 1890). B.
B. degans Lilljeborg (in Sars 1890). B.
B. lacustris var. procumbens Sars 1890. B.
B. öbtusirostris var. alpina Sars 1890. B.
B. öbtusirostris var. major Sars 1890. B.
B. arctica Lilljeborg (in Wesenberg 1904). B.
B. longispina var. macrospina Stenroos. B.
B. coregoni var. acronica Burckhardt 1900. B.
B. coregoni var. ceresiana Burckhardt 1900. B.
B. coregoni var. helvetica Burckhardt 1900. B.
B. coregoni var. lariana Burckhardt 1900.
coregoni var. lemani Burckhardt 1900.
coregoni var. neocomensis Burckhardt 1900.
coregoni var. peteniscensis Burckhardt 1900.
coregoni var. rivaria Burckhardt 1900.
coregoni var. sempacensis Burckhardt 1900.
coregoni var. stingdini Burckhardt 1900.
coregoni var. tugina Burckhardt 1900.
coregoni var. turicensis Burckhardt 1900.
coregoni var. zschókkei Burckhardt 1900.
longispina var. macrocerastes Lilljeborg 1901.
longispina var. megalops Lilljeborg 1901.
longispina var. laevis Daday 1901.
coregoni var. chilensis Daday 1902.
meridionalis Sars 1904.
coregoni var. ametìiystina Brehm 1905.
coregoni var. abnobensis Scheffelt 1908.
obtusirostris f. cisterciensis Riihe 1909.
obtusirostris f. poppei Riihe 1909.
reversaspina Turner 1910.
obtusirostris var. rectiantenna Werestschagin
1911.
Von diesen Formen will ich nur kurz auf B. meridionalis Sars eingehen, weil der Autor diese
Form nach Aufstellung des weiten Burckhardtschen Speziesbegriffes der B. coregoni als neue Art
beschrieb und für „spezifisch verschieden“ von B. coregoni erklärte. Demgegenüber möchte ich
bemerken, daß B. meridionalis in allen systematisch wichtigen Merkmalen (Form und Bewehrung
der Abdominalkralle, Stellung der Stirnborste etc.) mit B. coregoni übereinstimmt, B. meridionalis
Zoologien. H e ft 68. 3