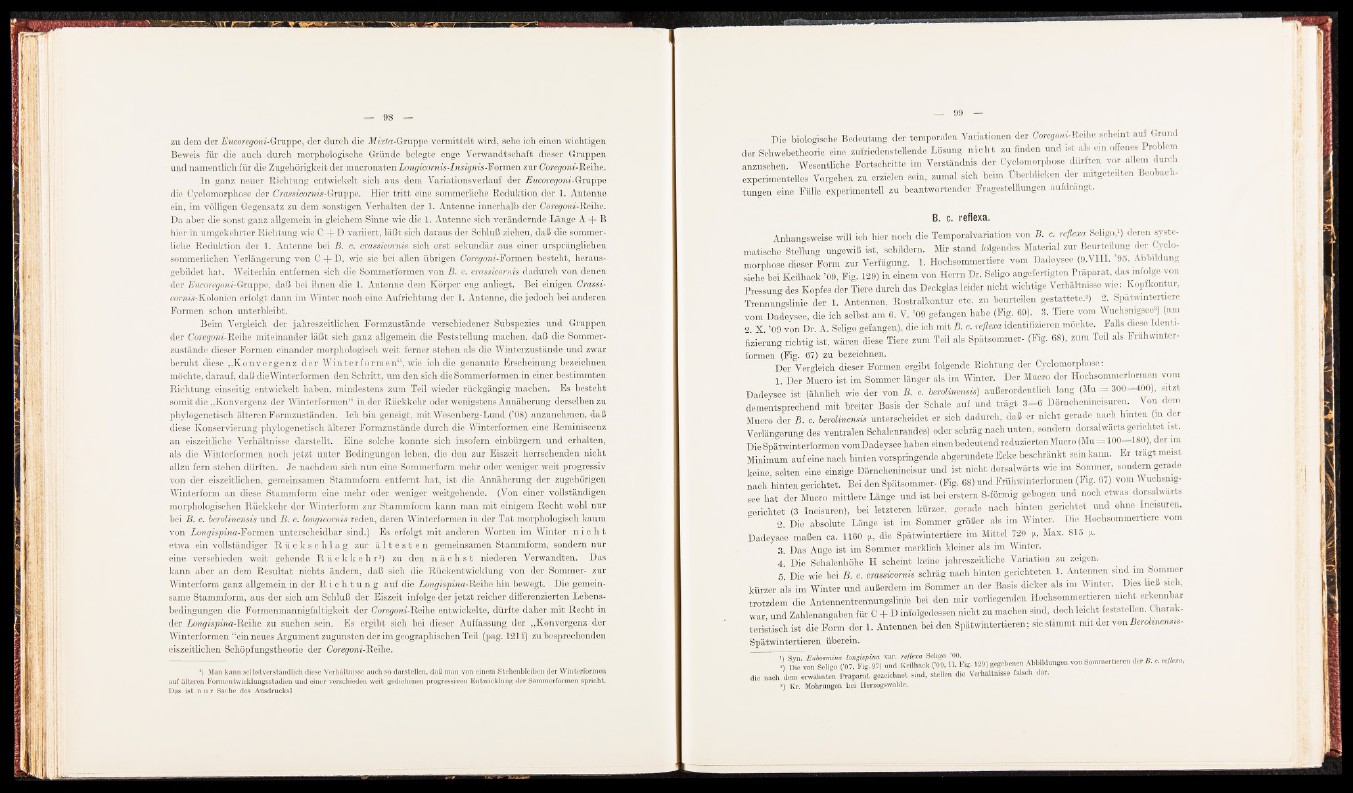
zu dem der Eucoregoni-Gruppe, der durch die ATiatfa-Gruppe vermittelt wird, sehe ich einen wichtigen
Beweis für die auch durch morphologische Gründe belegte enge Verwandtschaft dieser Gruppen
und namentlich für die Zugehörigkeit der mucronaten Longicornis-Insignis-^?oimen zur Coregoni-Reihe.
In ganz neuer Richtung entwickelt sich aus dem Variationsverlauf der Eucoregoni-Gruppe
die Cyclomorphose der Crassicornis- Gruppe. Hier tritt eine sommerliche Reduktion der 1. Antenne
ein, im völligen Gegensatz zu dem sonstigen Verhalten der 1. Antenne innerhalb der Coregoni-Reihe.
Da aber die sonst ganz allgemein in gleichem Sinne wie die. 1. Antenne sich verändernde Länge A + B
hier in umgekehrter Richtung wie C + D variiert, läßt sich daraus der Schluß ziehen, daß die sommerliche
Reduktion der 1. Antenne bei B. c. crassicornis sich erst sekundär aus einer ursprünglichen
sommerlichen Verlängerung von C -j- D, wie sie bei allen übrigen Coregoni-Formen besteht, herausgebildet
hat. Weiterhin entfernen sich die Sommerformen von B. c. crassicornis dadurch von denen
der Eucoregoni- Gruppe, daß bei ihnen die 1. Antenne dem Körper eng anliegt. Bei einigen Crassi-
eorm’s-Kolonien erfolgt dann im Winter noch eine Aufrichtung der 1. Antenne, die jedoch bei anderen
Formen schon unterbleibt.
Beim Vergleich der jahreszeitlichen Formzustände verschiedener Subspezies und Gruppen
der Coregoni-Reihe miteinander läßt sich ganz allgemein die Feststellung machen, daß die Sommerzustände
dieser Formen einander morphologisch weit ferner stehen als die Winterzustände und zwar
beruht diese „Konv e r gen z der W in t e r f o rme n “, wie ich die genannte Erscheinung bezeichnen
möchte, darauf, daß die Winterformen den Schritt, um den sich die Sommerformen in einer bestimmten
Richtung einseitig entwickelt haben, mindestens zum Teil wieder rückgängig machen. Es besteht
somit die „Konvergenz der Winterformen“ in der Rückkehr oder wenigstens Annäherung derselben zu
phylogenetisch älteren Formzuständen. Ich bin geneigt, mit Wesenberg-Lund (’08) anzunehmen, daß
diese Konservierung phylogenetisch älterer Formzustände durch die Winterformen eine Reminiscenz
an eiszeitliche Verhältnisse darstellt. Eine solche konnte sich insofern einbürgern und erhalten,
als die Winterformen noch jetzt unter Bedingungen leben, die den zur Eiszeit herrschenden nicht
allzu fern stehen dürften. Je nachdem sich nun eine Sommerform mehr oder weniger weit progressiv
von der eiszeitlichen, gemeinsamen Stammform entfernt hat, ist die Annäherung der zugehörigen
Winterform an diese Stammform eine mehr oder weniger weitgehende. (Von einer vollständigen
morphologischen Rückkehr der Winterform zur Stammform kann man mit einigem Recht wohl nur
bei B. c. berolinensis und B. c. longicornis reden, deren Winterformen in der Tat morphologisch kaum
von Longispina-Formen unterscheidbar sind.) Es erfolgt mit anderen Worten im Winter n i c h t
etwa ein vollständiger R ü c k s c h l a g zur ä l t e s t e n gemeinsamen Stammform, sondern nur
eine verschieden weit gehende R ü c k k e h r 1) zu den n ä c h s t niederen Verwandten. Das
kann aber an dem Resultat nichts ändern, daß sich die Rückentwicklung von der Sommer- zur
Winterform ganz allgemein in der R i c h t u n g auf die Longispina-Reihe hin bewegt. Die gemeinsame
Stammform, aus der sich am Schluß der Eiszeit infolge der jetzt reicher differenzierten Lebensbedingungen
die Formenmannigfaltigkeit der Coregoni-Reihe entwickelte, dürfte daher mit Recht in
der Longispina-Reihe zu suchen sein. Es ergibt sich bei dieser Auffassung der „Konvergenz der
Winterformen “ein neues Argument zugunsten der im geographischen Teil (pag. 121 f) zu besprechenden
eiszeitlichen Schöpfungstheorie der Coregoni-Reihe.
*) Man kann selbstverständlich diese Verhältnisse auch so darstellen, daß man von einem Stehenbleiben der Winterformen
auf älteren Formentwicklungsstadien und einer verschieden weit gediehenen progressiven Entwicklung der Sommerformen spricht.
Das is t n u r Sache des Ausdrucks!
Die biologische Bedeutung der temporalen Variationen der Coregoni-Beihe scheint auf Grund
der Schwebetheorie eine zufriedenstellende Lösung n i ch t zu finden und ist als ein offenes Problem
anzusehen. Wesentliche Fortschritte im Verständnis der Cyclomorphose dürften v o t allem durch
experimentelles Vorgehen zu erzielen sein, zumal sich beim Überblicken der mitgeteilten Beobachtungen
eine Fülle experimentell zu beantwortender Fragestellungen aufdrangt.
B. c. reflexa.
Anhangsweise will ich hier noch die Temporalvariation von B. c. reflexa Seligo,1) deren systematische
Stellung ungewiß i l schildern. Mir stand folgendes Material zur Beurteilung der Cyclomorphose
dieser Form zur Verfügung. 1. Hochsommertiere vom Dadeysee (9.VIII. 95, Abbildung
siehe bei Keilhack ’09 Fig. 129) in einem von Herrn Dr. Seligo angefertigten Präparat, das infolge von
Pressung des M I Tiere durch das Deckglas leider nicht wichtige Verhältnisse wie: Kopfkontur,
Trennungslinie der 1. Antennen, Rostralkontur etc. zu beurteilen gestattete.*) 2. Spatwmtertiere
vom Dadeysee, die ich selbst am 6. V. ’09 gefangen habe (Fig. 69). 3. Tiere vom Wuchsnigsee3) (am
2 X ’09 von Dr A. Seligo gefangen), die ich mit B. c. reflexa identifizieren möchte. Falls diese Identifizierung
richtig ist, wären diese Tiere zum Teil als Spätsommer- (Fig. 68), zum Teil als Frühwmterformen
(Fig. 67) zu bezeichnen.
Der Vergleich dieser Formen ergibt folgende Richtung der Cyclomorphose:
1. Der Mucro ist im Sommer länger als im Winter. Der Mucro der Hochsommerformen vom
Dadeysee ist (ähnlich wie der von R. c. berolinensis) außerordentlich lang (Mu = 300—400), sitzt
dementsprechend mit breiter Basis der Schale auf und trägt 3 ^ 6 Dömchenincisuren. Von dem
Mucro der B. c. berolinensis unterscheidet er sich dadurch, daß er nicht gerade nach hinten (in der
Verlängerung des ventralen Schalenrandes) oder schräg nach unten,-sondern dorsalwärts gerichtet ist.
Die Spätwinterformen vomDadeysee haben einenbedeutend reduzierten Mucro (Mu = 100—180), der im
Minimum auf eine nach hinten vorspringende abgerundete Ecke beschränkt sein kann. Er tragt meist
keine selten eine einzige Dömchenincisür und ist nicht dorsalwärts wie im Sommer, sondern gerade
nach hinten gerichtet. Bei den Spätsommer- (Fig. 68) und Frühwinterformen (Fig. 67) vom Wuchsmg-
see hat der Mucro mittlere Länge und ist bei erstem S-förmig gebogen und noch etwas dorsalwärts
gerichtet (3 Incisuren), bei letzteren kürzer, gerade nach hinten gerichtet und ohne Incisuren.
2. Die absolute Länge ist im Sommer größer als im Winter. Die Hochsommertiere vom
Dadeysee maßen ca. 1160 |i, die Spätwintertiere im Mittel 720 n, Max. 815 (i.
3. Das Auge ist im Sommer merklich kleiner als im Winter.
4. Die Schalenhöhe H scheint keine jahreszeitliche Variation zu zeigen.
5. Die wie bei B. c. crassicornis schräg nach hinten gerichteten 1. Antennen sind im Sommer
kürzer als im Winter und außerdem im Sommer an der Basis dicker als im Winter. Dies ließ sic ,
trotzdem die Antennentrennungslinie bei den mir vorliegenden Hochsommertieren nicht erkennbar
war und Zahlenangaben für C + D infolgedessen nicht zu machen sind, doch leicht feststellen. Charakteristisch
ist die Form der 1. Antennen bei den Spätwintertieren; sie stimmt mit der von Berohnensxs-
Spätwintertieren überein.
il Svn. Eubosmina longispina var. reflexa Seligo ’00. ~ ___
>) Die von Seligo ('07, F ig .97) und Keilhack ('09,11, Fig. 129) gegebenen Abbildungen von Sommert,eien der B. c. reflexa,
die nach dem erwähnten P räp a ra t gezeichnet sind, stellen die Verhältnisse falsch dar.
3) Kr. Mohrungen bei Herzogswalde.