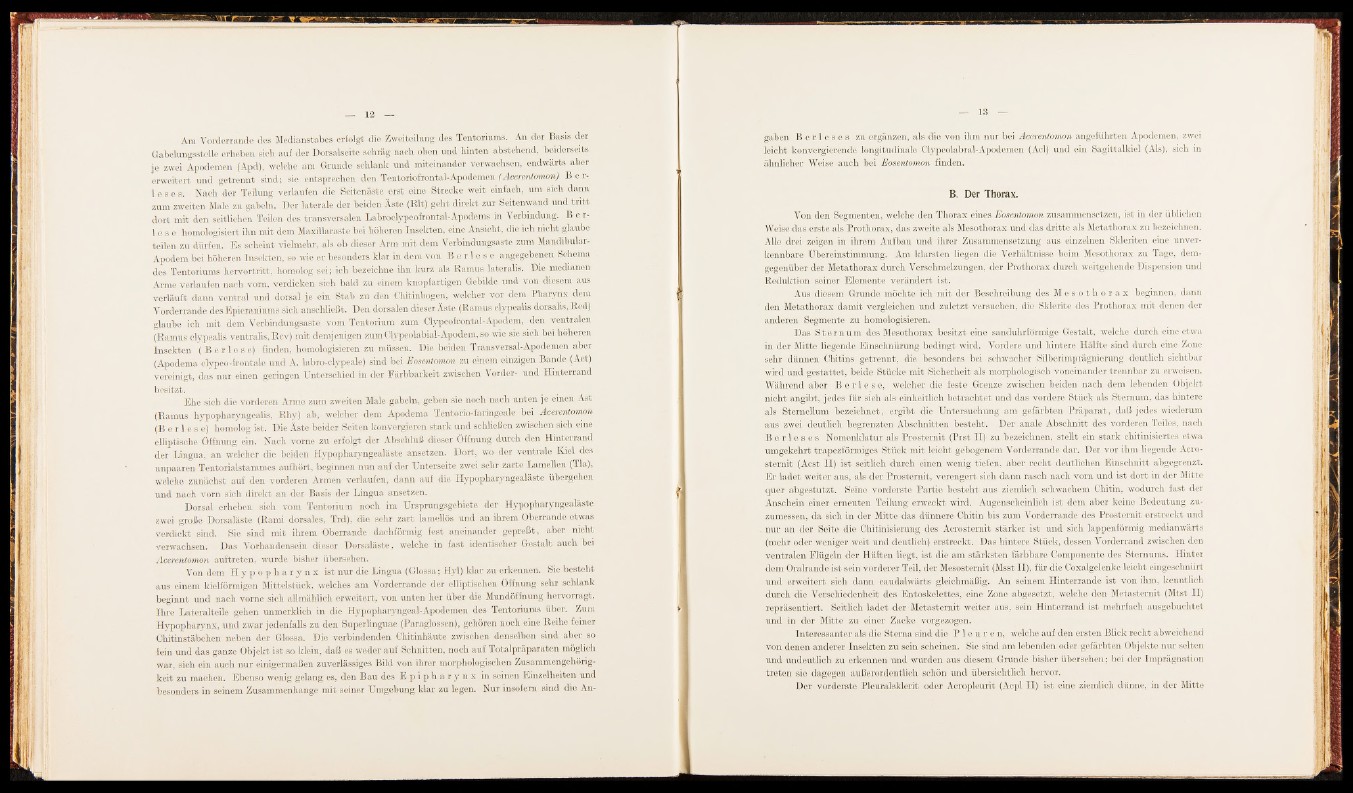
Am Vorderrande des Medianstabes erfolgt die Zweiteilung des Tentoriums. An der Basis der
Gabelungsstelle erheben sich auf der Dorsalseite schräg nach oben und hinten abstehend, beiderseits
je zwei Apodemen (Apd), welche am Grunde schlank und miteinander verwachsen, endwärts aber
erweitert und getrennt sind; sie entsprechen den Tentoriofrontal-Apodemen (Acerentomon) B e r l
e s e s. Nach der Teilung verlaufen die Seitenäste erst eine Strecke weit einfach, um sich dann
zum zweiten Male zu gabeln. Der laterale der beiden Äste (Elt) geht direkt zur Seitenwand und tritt
dort mit den seitlichen Teilen des transversalen Labroclypeofrontal-Apodems in Verbindung. B e r-
1 e s e homologisiert ihn mit dem Maxillaraste bei höheren Insekten, eine Ansicht, die ich nicht glaube
teilen zu dürfen. Es scheint vielmehr, als ob dieser Arm mit dem Verbindungsaste zum Mandibular-
Apodem bei höheren Insekten, so wie er besonders klar in dem von B e r l e s e angegebenen Schema
des Tentoriums hervortritt, homolog sei; ich bezeichne ihn kurz als Ramus lateralis. Die medianen
Arme verlaufen nach vom, verdicken sich bald zu einem knopfartigen Gebilde und von diesem aus
verläuft dann ventral und dorsal je ein Stab zu den Chitinbogen, welcher vor dem Pharynx dem
Vorderrande des Epicraniums sich anschließt. Den dorsalen dieser Äste (Ramus clypealis dorsalis, Red)
glaube ich mit dem Verbindungsaste vom Tentorium zum Clypeofrontal-Apodem, den ventralen
(Ramus clypealis ventralis, Rcv) mit demjenigen zumClypeolabial-Apodem, so wie sie sich bei höheren
Insekten ( B e r l e s e ) finden, homologisieren zu müssen. Die beiden Transversal-Apodemen aber
(Apodema clypeo-frontale und A. labro-elypeale) sind bei Eosentomon zu einem einzigen Bande (Act)
vereinigt, das nur einen geringen Unterschied in der Färbbarkeit zwischen Vorder- und Hinterrand
besitzt.
Ehe sich die vorderen Arme zum zweiten Male gabeln, geben sie noch nach unten je einen Ast
(Ramus hypopharyngealis, Rhy) ab, welcher dem Apodema Tentorio-faringeale bei Acerentomon
(B e r l e s e ) homolog ist. Die Äste beider Seiten konvergieren stark und schließen zwischen sich eine
elliptische Öffnung ein. Nach vome zu erfolgt der Abschluß dieser Öffnung durch den Hinterrand
der Lingua, an welcher die beiden Hypopharyngealäste ansetzen. Dort, wo der ventrale Kiel des
unpaaren Tentorialstammes auf hört, beginnen nun auf der Unterseite zwei sehr zarte Lamellen (Tla),
welche zunächst auf den vorderen Armen verlaufen, dann auf die Hypopharyngealäste übergehen
und nach vorn sich direkt an der Basis der Lingua ansetzen.
Dorsal erheben sich vom Tentorium noch im Ursprungsgebiete der Hypopharyngealäste
zwei große Dorsaläste (Rami dorsales, Trd), die sehr zart lamellös und an ihrem Oberrande etwas
verdickt sind. Sie sind mit ihrem Oberrande dachförmig fest aneinander gepreßt, aber nicht
verwachsen. Das Vorhandensein dieser Dorsaläste, welche in fast identischer Gestalt auch bei
Acerentomon auftreten, wurde bisher übersehen.
Von dem H y p o p h a r y n x ist nur die Lingua (Glossa; Hyl) klar zu erkennen. Sie besteht
aus einem kielförmigen Mittelstück, welches am Vorderrande der elliptischen Öffnung sehr schlank
beginnt und nach vorne sich allmählich erweitert, von unten her über die Mundöffnung hervorragt.
Ihre Lateralteile gehen unmerklich in die Hypopharyngeal-Apodemen des Tentoriums über. Zum
Hypopharynx, und zwar jedenfalls zu den Superlinguae (Paraglossen), gehören noch eine Reihe feiner
Chitinstäbchen neben der Glossa. Die verbindenden Chitinhäute zwischen denselben sind aber so
fein und das ganze Objekt ist so klein, daß es weder auf Schnitten, noch auf Totalpräparaten möglich
war, sich ein auch nur einigermaßen zuverlässiges Bild von ihrer morphologischen Zusammengehörigkeit
zu machen. Ebenso wenig gelang es, den Bau des E p i p h a r y n x in seinen Einzelheiten und
besonders in seinem Zusammenhänge mit seiner Umgebung klar zu legen. Nur insofern sind die Angaben
B e r 1 e s e s zu ergänzen, als die von ihm nur bei Acerentomon angeführten Apodemen, zwei
leicht konvergierende longitudinale Clypeolabral-Apodemen (Acl) und ein Sagittalkiel (Als), sich in
ähnlicher Weise auch bei Eosentomon finden.
B. Der Thorax.
Von den Segmenten, welche den Thorax eines Eosentomon zusammensetzen, ist in der üblichen
Weise das erste als Prothorax, das zweite als Mesothorax und das dritte als Metathorax zu bezeichnen.
Alle drei zeigen in ihrem Aufbau und ihrer Zusammensetzung aus einzelnen Skleriten eine unverkennbare
Übereinstimmung. Am klarsten liegen die Verhältnisse beim Mesothorax zu Tage, demgegenüber
der Metathorax durch Verschmelzungen, der Prothorax durch weitgehende Dispersion und
Reduktion seiner Elemente verändert ist.
Aus diesem Grunde möchte ich mit der Beschreibung des M e s o t h o r a x beginnen, dann
den Metathorax damit vergleichen und zuletzt versuchen, die Sklerite des Prothorax mit denen der
anderen Segmente zu homologisieren.
Das S t e r n um des Mesothorax besitzt eine sanduhxförmige Gestalt, welche durch eine etwa
in der Mitte liegende Einschnürung bedingt wird. Vordere und hintere Hälfte sind durch eine Zone
sehr dünnen Chitins getrennt, die besonders bei schwacher Silberimprägnierung deutlich sichtbar
wird und gestattet, beide Stücke mit Sicherheit als morphologisch voneinander trennbar zu erweisen.
Während aber B e r l e s e , welcher die feste Grenze zwischen beiden nach dem lebenden Objekt
nicht angibt, jedes für sich als einheitlich betrachtet und das vordere Stück als Sternum, das hintere
als Sternellum bezeichnet, ergibt die Untersuchung am gefärbten Präparat, daß jedes wiederum
aus zwei deutlich begrenzten Abschnitten besteht. Der anale Abschnitt des vorderen Teiles, nach
B e r l e s e s Nomenklatur als Prosternit (Prst II) zu bezeichnen, stellt ein stark chitinisiertes etwa
umgekehrt trapezförmiges Stück mit leicht gebogenem Vorderrande dar. Der vor ihm liegende Acro-
sternit (Acst II) ist seitlich durch einen wenig tiefen, aber recht deutlichen Einschnitt abgegrenzt.
Er ladet weiter aus, als der Prosternit, verengert sich dann rasch nach vorn und ist dort in der Mitte
quer abgestutzt. Seine vorderste Partie besteht aus ziemlich schwachem Chitin, wodurch fast der
Anschein einer erneuten Teilung erweckt wird. Augenscheinlich ist dem aber keine Bedeutung zuzumessen,
da sich in der Mitte das dünnere Chitin bis zum Vorderrande des Prosternit erstreckt und
nur an der Seite die Chitinisierung des Acrosternit stärker ist und sich lappenförmig medianwärts
(mehr oder weniger weit und deutlich) erstreckt. Das hintere Stück, dessen Vorderrand zwischen den
ventralen Flügeln der Hüften liegt, ist die am stärksten färbbare Componente des Sternums. Hinter
dem Oralrande ist sein vorderer Teil, der Mesosternit (Msst II), für die Coxalgelenke leicht eingeschnürt
und erweitert sich dann caudalwärts gleichmäßig. An seinem Hinterrande ist von ihm, kenntlich
durch die Verschiedenheit des Entoskelettes, eine Zone abgesetzt, welche den Metasternit (Mtst II)
repräsentiert. Seitlich ladet der Metasternit weiter aus, sein Hinterrand ist mehrfach ausgebuchtet
und in der Mitte zu einer Zacke vorgezogen.
Interessanter als die Sterna sind die P l e u r e n , welche auf den ersten Blick recht abweichend
von denen anderer Insekten zu sein scheinen. Sie sind am lebenden oder gefärbten Objekte nur selten
und undeutlich zu erkennen und wurden aus diesem Grunde bisher übersehen; bei der Imprägnation
treten sie dagegen außerordentlich schön und übersichtlich hervor.
Der vorderste Pleuralsklerit oder Acropleurit (Acpl II) ist eine ziemlich dünne, in der Mitte