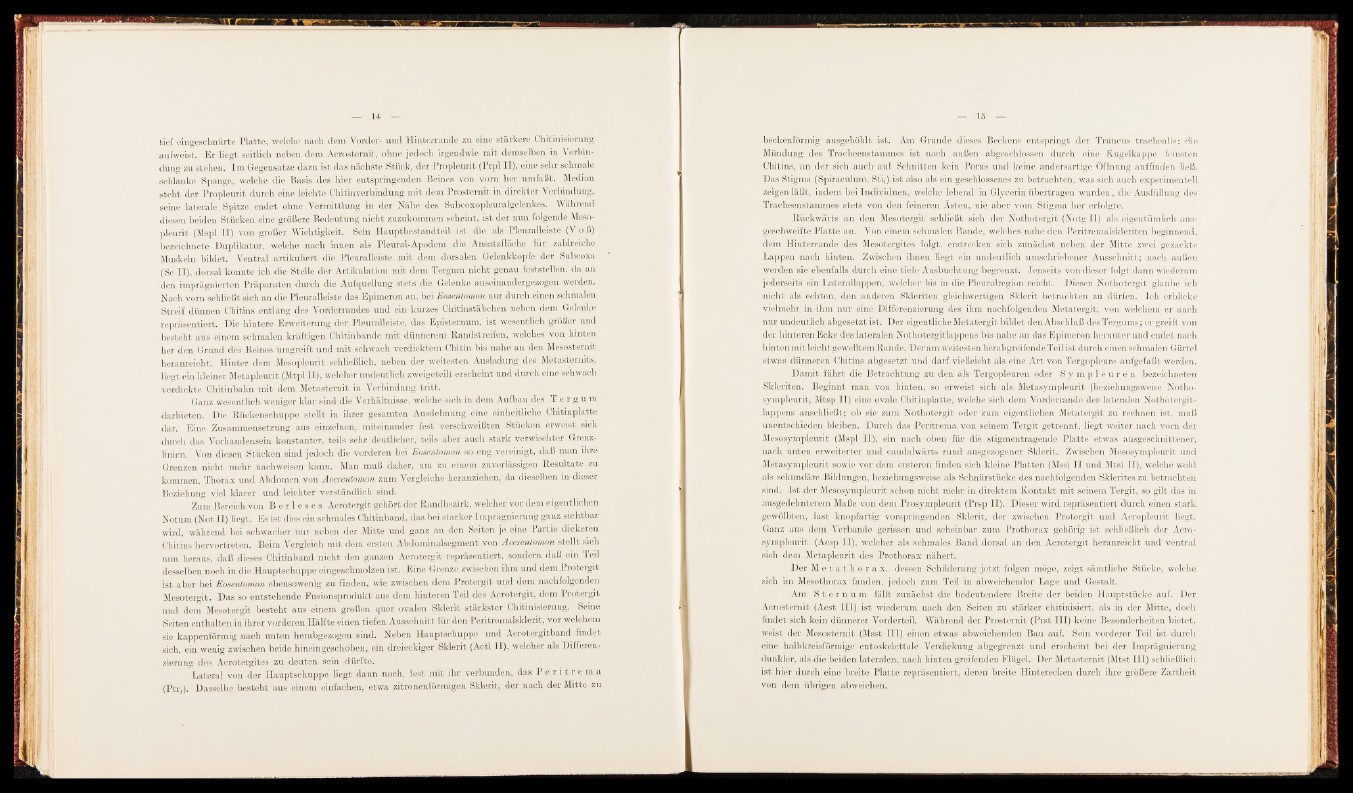
tief eingeschnürte Platte, welche nach dem Vorder- und Hinterrande zu eine stärkere Chitinisierung
aufweist.. Br liegt seitlich neben dem Acrosternit, ohne jedoch irgendwie mit demselben in Verbindung
zu stehen. Im Gegensätze dazu ist das nächste Stück, der Propleurit (Prpl II), eine sehr schmale
schlanke Spange, welche die Basis des .hier entspringenden Beines von vorn her umfaßt. Median
steht der Propleurit durch eine leichte Chitinverbindung mit dem Prosternit in direkter Verbindung,
seine laterale Spitze endet ohne Vermittlung in der Nähe des Subcoxopleuralgelenkes. Während
diesen beiden Stücken eine größere Bedeutung nicht zuzukommen scheint, ist der nun folgende Mcso-
pleurit (Mspl II) von großer Wichtigkeit. . Sein Hauptbestandteil ist die als Pleuralleiste (V o ß)
bezeichnete Duplikatur, welche nach innen als Pleural-Apodem die Ansatzfläche für zahlreiche
Muskeln bildet. Ventral artikuliert die Pleuralleiste mit dem dorsalen Gelenkkopfe der Subcoxa
(Sc II), dorsal konnte ich die Stelle der Artikulation mit dem Tergum nicht genau feststellen, da an
den imprägnierten Präparaten durch die Aufquellung stets die Gelenke auseinandergezogen werden.
Nach vorn schließt sich an die Pleuralleiste das Epimeron an, bei Eosentomon nur durch einen schmalen
Streif dünnen Chitins entlang des Vorderrandes und ein kurzes Chitinstäbchen neben dem Gelenke
repräsentiert. Die hintere Erweiterung der Pleuralleiste, das Epistemum, ist wesentlich größer und
besteht aus einem schmalen kräftigen Chitinbande mit dünnerem Randstreifen, welches von hinten
her den Grund des Beines umgreift und mit schwach verdicktem Chitin bis nahe an den Mcsostermt
heranreicht. Hinter dem Mesopleurit schließlich, neben der weitesten Ausladung des Metasternits,
liegt ein kleiner Metapleurit (Mtpl II), weloher undeutlich zweigeteilt erscheint und durch eine schwach
verdickte Chitinbahn mit dem Metasternit in Verbindung tritt.
Ganz wesentlich weniger klar sind die Verhältnisse, welche sich in dem Aufbau des T e r g u m
darbieten. Die Rückenschuppe stellt in ihrer gesamten Ausdehnung eine einheitliche Chitinplatte
dar. Eine Zusammensetzung aus einzelnen, miteinander fest verschweißten Stücken erweist sich
durch das Vorhandensein konstanter, teils sehr deutlicher, teils aber auch stark verwischter Grenzlinien.
Von diesen Stücken sind jedoch die vorderen bei Eosentomon so eng vereinigt, daß man ihre
Grenzen nicht mehr nachweisen kann. Man muß daher, um zu einem zuverlässigen Resultate zu
kommen, Thorax und Abdomen von Acerentomon zum Vergleiche heranziehen, da dieselben in dieser
Beziehung viel klarer und leichter verständlich sind.
Zum Bereich von B e r 1 e s e s Acrotergit gehört der Randbezirk, welcher vor dem eigentlichen
Notum (Not II) hegt. Es ist dies ein schmales Chitinband, das bei starker Imprägnierung ganz sichtbar
wird, während bei schwacher nur neben der Mitte und ganz an den Seiten je eine Partie dickeren
Chitins hervortreten. Beim Vergleich mit dem ersten Abdominalsegment von Acerentomon stellt sich
nun heraus, daß dieses Chitinband nicht den ganzen Acrotergit repräsentiert, sondern daß ein Teil
desselben noch in die Hauptschuppe eingeschmolzen ist. Eine Grenze zwischen ihm und dem Protergit
ist aber bei Eosentomon ebensowenig zu finden, wie zwischen dem Protergit und dem nachfolgenden
Mesotergit. Das so entstehende Fusionsprodukt aus dem hinteren Teil des Acrotergit, dem Protergit
und dem Mesotergit besteht aus einem großen quer ovalen Sklerit stärkster Chitinisierung. Seine
Seiten enthalten in ihrer vorderen Hälfte einen tiefen Ausschnitt für den Peritremalsklerit, vor welchem
sie kappenförmig nach unten herabgezogen sind. Neben Hauptschuppe und Acrotergitband findet
sich, ein wenig zwischen beide hineingeschoben, ein dreieckiger Sklerit (Actl II), welcher als Differenzierung
de3 Acrotergites zu deuten sein dürfte.
Lateral von der Hauptschuppe liegt dann noch, fest mit ihr verbunden, das P e r i t r e m a
(Ptrx). Dasselbe besteht aus einem einfachen, etwa zitronenförmigen Sklerit, der nach der Mitte zu
beckenförmig ausgehöhlt ist. Am Grunde dieses Beckens entspringt der Truncus trachealis; die
Mündung des Tracheenstammes ist nach außen abgeschlossen durch eine Kugelkappe feinsten
Chitins, an der sich auch auf Schnitten kein Porus und keine andersartige Öffnung auffinden ließ.
Das Stigma (Spiraculum, Stix) ist also als ein geschlossenes zu betrachten, was sich auch experimentell
zeigen läßt, indem bei Individuen, welche lebend in Glycerin übertragen wurden, die Ausfüllung des
Tracheenstammes stets von den feineren Ästen, nie aber vom Stigma her erfolgte.
Rückwärts an den Mesotergit schließt sich der Nothotergit (Notg II) als eigentümlich ausgeschweifte
Platte an. Von einem schmalen Bande, welches nahe den Peritremalskleriten beginnend,
dem Hinterrande des Mesotergites folgt, erstrecken sich zunächst neben der Mitte zwei gezackte
Lappen nach hinten. Zwischen ihnen liegt ein undeutlich umschriebener Ausschnitt; -nach außen
werden sie ebenfalls durch eine tiefe Ausbuchtung begrenzt. Jenseits von dieser fo lgt dann wiederum
jederseits ein Laterallappen, welcher bis in die Pleuralregion reicht. Diesen Nothotergit glaube ich
nicht als echten, den anderen Skleriten gleichwertigen Sklerit betrachten zu dürfen. Ich erblicke
vielmehr in ihm nur eine Differenzierung des ihm nachfolgenden Metatergit, von welchem er auch
nur undeutlich abgesetzt ist. Der eigentliche Metatergit bildet den Abschluß des Tergums; er greift von
der hinteren Ecke des lateralen Nothotergitlappens bis nahe an das Epimeron herunter und endet nach
hinten mit leicht gewelltem Rande. Der am weitesten herabgreifende Teil ist durch einen schmalen Gürtel
etwas dünneren Chitins abgesetzt und darf vielleicht als eine Art von Tergopleure aufgefaßt werden.
Damit führt die Betrachtung zu den als Tergopleuren oder S y m p l e u r e n bezeichneten
Skleriten. Beginnt man von hinten, so erweist sich als Metasympleurit (beziehungsweise Notho-
sympleurit, Mtsp II) eine ovale Chitinplatte, welche sich dem Vorderrande des lateralen Nothotergitlappens
anschließt; ob sie zum Nothotergit oder zum eigentlichen Metatergit zu rechnen ist, muß
unentschieden bleiben. Durch das Peritrema von seinem Tergit getrennt, liegt weiter nach vorn der
Mesosympleurit (Mspl II), ein nach oben für die stigmentragende Platte etwas ausgeschnittener,
nach unten erweiterter und caudalwärts rund ausgezogener Sklerit. Zwischen Mesosympleurit und
Metasympleurit sowie vor dem ersteren finden sich kleine Platten (Mssi I I und Mtsi II), welche wohl
als sekundäre Bildungen, beziehungsweise als Schnürstücke des nachfolgenden Sklerites zu betrachten
sind. Ist der Mesosympleurit schon nicht mehr in direktem Kontakt mit seinem Tergit, so gilt das in
ausgedehnterem Maße von dem Prosympleurit (Prsp II). Dieser wird repräsentiert durch einen stark
gewölbten, fast knopfartig vorspringenden Sklerit, der zwischen Protergit und Acropleurit liegt.
Ganz aus dem Verbände gerissen und scheinbar zum Prothorax gehörig ist schließlich der Acro-
sympleurit (Acsp II), welcher als schmales Band dorsal an den Acrotergit heranreicht und ventral
sich-dem Metapleurit des Prothorax nähert.
Der M e t a t h o r a x , dessen Schilderung jetzt folgen möge, zeigt sämtliche Stücke, welche
sich im Mesothorax fanden, jedoch zum Teil in abweichender Lage und Gestalt.
Am S t e r n u m fällt zunächst die bedeutendere Breite der beiden Hauptstücke auf. Der
Acrosternit (Acst III) ist wiederum nach den Seiten zu stärker chitinisiert, als in der Mitte, doch
findet sich kein dünnerer Vorderteil. Während der Prosternit (Prst III) keine Besonderheiten bietet,
weist der Mesosternit (Msst III) einen etwas abweichenden Bau auf. Sein vorderer Teil ist durch
eine halbkreisförmige entoskelettale Verdickung abgegrenzt und erscheint bei der Imprägnierung
dunkler, als die beiden lateralen, nach hinten greifenden Flügel. Der Metasternit (Mtst III) schließlich
ist hier durch eine breite Platte repräsentiert, deren breite Hinterecken durch ihre größere Zartheit
von dem übrigen abweichen.