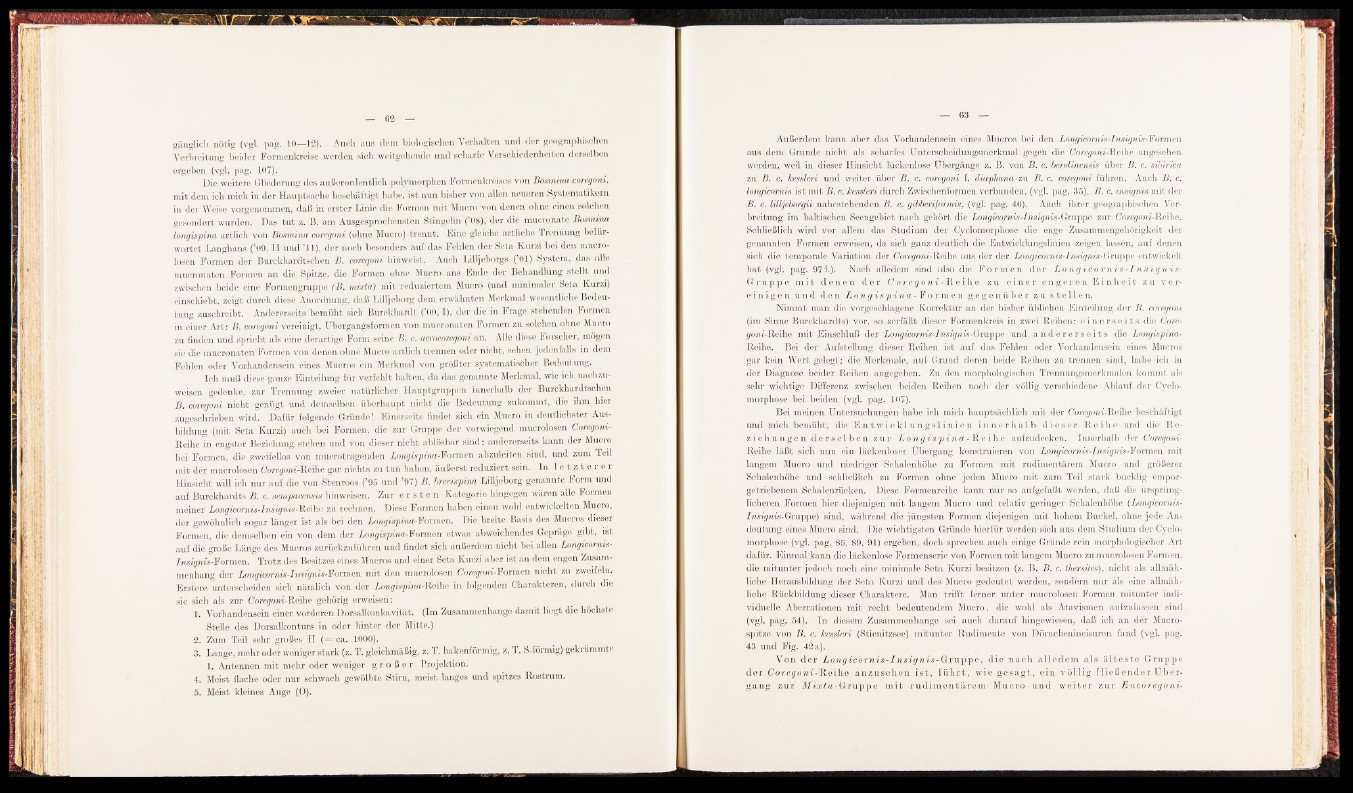
gänglich nötig (vgl. pag. 10—12). Auch aus dem biologischen Verhalten und der geographischen
Verbreitung beider Formenkreise werden sich weitgehende und scharfe Verschiedenheiten derselben
ergeben (vgl. pag. 107).
Die weitere Gliederung des außerordentlich polymorphen Formenkreises von Bosmina coregoni,
mit dem ich mich in der Hauptsache beschäftigt habe, ist nun bisher von allen neueren Systematikern
in der Weise vorgenommen, daß in erster Linie die Formen mit Mucro von denen ohne einen solchen
gesondert wurden. Das tu t z. B. am Ausgesprochensten Stingelin (’08), der die mucronate Bosmina
longispina artlich von Bosmina coregoni (ohne Mucro) trennt. Eine gleiche artliche Trennung befürwortet
Langhans (’09, I I und ’11), der noch besonders auf das Fehlen der Seta Kurzi bei den mucro-
losen Formen der Burckhardtschen B. coregoni hinweist. Auch Lilljeborgs (’01) System, das alle
mucronaten Formen an die Spitze, die Formen ohne Mucro ans Ende der Behandlung stellt und
zwischen beide eine Formengruppe (B. mixta) mit reduziertem Mucro (und minimaler Seta Kurzi)
einschiebt, zeigt durch diese Anordnung, daß Li 11 jeborg dem erwähnten Merkmal wesentliche Bedeutung
zuschreibt. Andererseits bemüht sich Burckhardt (’0 0 ,1), der die in Frage stehenden Formen
in einer Art: B. coregoni vereinigt, Übergangsformen von mucronaten Formen zu solchen ohne Mucro
zu finden und spricht als eine derartige Form seine B. c. acrocoregoni an. Alle diese Forscher, mögen
sie die mucronaten Formen von denen ohne Mucro artlich trennen oder nicht, sehen jedenfalls in dem
Fehlen oder Vorhandensein eines Mucros ein Merkmal von größter systematischer Bedeutung.
Ich muß diese ganze Einteilung für verfehlt halten, da das genannte Merkmal, wie ich nachzuweisen
gedenke, zur Trennung zweier natürlicher Hauptgruppen innerhalb der Burckhardtschen
B. coregoni nicht genügt und demselben überhaupt nicht die Bedeutung zukommt, die ihm hier
zugeschrieben wird. Dafür folgende Gründe! Einerseits findet sich ein Mucro in deutlichster Ausbildung
(mit Seta Kurzi) auch bei Formen, die zur Gruppe der vorwiegend mucrolosen Goregoni-
Reihe in engster Beziehung stehen und von dieser nicht ablösbar sind; andererseits kann der Mucro
bei Formen, die zweifellos von mucrotragenden Longispina-Formen abzuleiten sind, und zum Teil
mit, der mucrolosen Coregoni-Ba ihe gar nichts zu tun haben, äußerst reduziert sein. In l e t z t e r e r
Hinsicht will ich nur auf die von Stenroos (’95 und ’97) B. brevispina Lilljeborg genannte Form und
auf Burckhardts B. c. sempacensis hinweisen. Zur e r s t e n Kategorie hingegen wären alle Formen
meiner Longicornis-Insignis-Beihe zu rechnen. Diese Formen haben einen wohl entwickelten Mucro,
der gewöhnlich sogar länger ist als bei den Longispina-Formen. Die breite Basis des Mucros dieser
Formen, die demselben ein von dem der Longispina-Formen etwas abweichendes Gepräge gibt, ist
auf die große Länge des Mucros zurückzuführen und findet sich außerdem nicht bei allen Longicornis-
Insignis-Formen. Trotz des Besitzes eines Mucros und einer Seta Kurzi aber ist an dem engen Zusammenhang
der Longicornis-Insignis-Formen mit den mucrolosen Coregoni-Formen nicht zu zweifeln.
Erstere unterscheiden sich nämlich von der Longispina-Beihe in folgenden Charakteren, durch die
sie sich als zur Coregoni-Beihe gehörig erweisen:
1. Vorhandensein einer vorderen Dorsalkonkavität. (Im Zusammenhänge damit liegt die höchste'
Stelle des Dorsalkonturs in oder hinter der Mitte.)
2. Zum Teil sehr großes H (= ca. 1000).
3. Lange, mehr oder weniger stark (z. T. gleichmäßig, z. T. hakenförmig, z. T. S-förmig) gekrümmte
1. Antennen mit mehr oder weniger g r o ß e r Projektion.
4. Meist flache oder nur schwach gewölbte Stirn, meist langes und spitzes Rostrum.
5. Meist kleines Auge (O).
Außerdem kann aber das Vorhandensein eines Mucros bei den Longicornis-Insignis-Formen
aus dem Grunde nicht als scharfes Unterscheidungsmerkmal gegen die Coregoni-Reihe angesehen
werden, weil in dieser Hinsicht lückenlose Übergänge z. B. von B. c. berolinensis über B. c. sibirica
zu B. c. kessleri und weiter über B. c. coregoni f. diaphana zu B. c. coregoni führen. Auch B. c.
longicornis ist mit B. c. kessleri durch Zwischenformen verbunden, (vgl. pag. 35), B. c. insignis mit der
B. c. lilljeborgii nahestehenden B. c. gibberiformis, (vgl. pag. 46). Auch ihrer geographischen Verbreitung
im baltischen Seengebiet nach gehört die Longicornis-Insignis-Gciuppe zur Coregoni-Reihe.
Schließlich wird vor allem das Studium der Cyclomorphose die enge Zusammengehörigkeit der
genannten Formen erweisen, da sich ganz deutlich die Entwicklungslinien zeigen lassen, auf denen
sich die temporale Variation der (7om/om-Reihe aus der der Longicornis -1nsignis -Gruppe entwickelt
hat (vgl. pag. 97f.). Nach alledem sind also die F o r m e n der L o n g i c o r n i s - I n s i g n i s -
G r u p p e m i t d e n e n d e r Co r e g o n i - R e i h e zu e i n e r e n g e r e n E i n h e i t zu v e r e
i n i g e n u n d de n L o n g i s p i n a - F o rme n g e g e n ü b e r zu s t e l l en.
Nimmt man die vorgeschlagene Korrektur an der bisher üblichen Einteilung der B. coregoni
(im Sinne Burckhardts) vor, so zerfällt dieser Formenkreis in zwei Reihen: e i n e r s e i t s die Core-
(/om-Reihe mit Einschluß der Longicornis-Insignis-Gruppe und a n d e r e r s e i t s die Longispina-
Reihe. Bei der Aufstellung dieser Reihen ist auf das Fehlen oder Vorhandensein eines Mucros
gar kein Wert gelegt; die Merkmale, auf Grund deren beide Reihen zu trennen sind, habe ich in
der Diagnose beider Reihen angegeben. Zu den morphologischen Trennungsmerkmalen kommt als
sehr wichtige Differenz zwischen beiden Reihen noch der völlig verschiedene Ablauf der Cyclomorphose
bei beiden (vgl. pag. 107).
Bei meinen Untersuchungen habe ich mich hauptsächlich mit der Coregoni-Reihe beschäftigt
und mich bemüht, die E n t w i c k l u n g s l i n i e n i n n e r h a l b d i e s e r R e i h e und die Bez
i e h u n g e n d e r s e l b e n zur L o n g i s p i n a - B e i he aufzudecken. Innerhalb der Coregoni-
Reihe läßt sich nun ein lückenloser Übergang konstruieren von Longicornis-Insignis-Foimen mit
langem Mucro und niedriger Schalenhöhe zu Formen mit rudimentärem Mucro und größerer
Schalenhöhe und schließlich zu Formen ohne jeden Mucro mit zum Teil stark bucklig emporgetriebenem
Schalenrücken. Diese Formenreihe kann nur so aufgefaßt werden, daß die ursprünglicheren
Formen hier diejenigen mit langem Mucro und relativ geringer Schalenhöhe (Longicornis-
Insignis-Gruppe) sind, während die jüngsten Formen diejenigen mit hohem Buckel, ohne jede Andeutung
eines Mucro sind. Die wichtigsten Gründe hierfür werden sich aus dem Studium der Cyclomorphose
(vgl. pag. 85, 89, 91) ergeben, doch sprechen auch einige Gründe rein morphologischer Art
dafür. Einmal kann die lückenlose Formenserie von Formen mit langem Mucro zu mucrolosen Formen,
die mitunter jedoch noch eine minimale Seta Kurzi besitzen (z. B. B. c. thersites), nicht als allmähliche
Herausbildung der Seta Kurzi und des Mucro gedeutet werden, sondern nur als eine allmähliche
Rückbildung dieser Charaktere. Man trifft ferner unter mucrolosen Formen mitunter individuelle
Aberrationen mit recht bedeutendem Mucro, die wohl als Atavismen aufzufassen sind
(vgl. pag. 54). In diesem Zusammenhänge sei auch darauf hingewiesen, daß ich an der Mucro-
spitze von B. c. kessleri (Stienitzsee) mitunter Rudimente von Dörnchenincisuren fand (vgl. pag.
43 und Fig. 42 a).
Von d e r Long i c o rn i s - I n s i g n i s -C iu p p e , d ie nach a l ledem als äl tes t e Gruppe
der Coregoni -Reihe anzusehen ist , führ t , wie gesagt , ein völ l ig f l ießender Über gang
zur Mi xt a-Gci uppe mi t r udiment ä r em Mucro und wei ter zur Eucoregoni